30.01.2026 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Die Schulter - ein empfindliches Gelenk
Aus der Vortragsreihe GesundheitAKTIV

Schulterschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden des Bewegungsapparates und können Menschen in jedem Lebensalter betreffen – vom jungen Sportler bis ins hohe Alter. Warum die Schulter besonders anfällig für Verletzungen ist, welche Beschwerden typisch für unterschiedliche Altersgruppen sind und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen, erläutert Dr. med. Florian Zoffl, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, in einem Vortrag. mehr...
Die Schulter unterscheidet sich deutlich von anderen großen Gelenken wie Hüfte oder Knie. Sie ermöglicht ein besonders großes Bewegungsausmaß, wird aber nur von einer vergleichsweise kleinen Gelenkpfanne geführt. Stabilität erhält sie vor allem durch Muskeln, Sehnen und Bänder. Diese Konstruktion macht die Schulter zwar sehr beweglich, zugleich aber auch anfällig für Verletzungen, Überlastungen und Verschleißerscheinungen.
Wenn die Schulter rausfliegt
Bei jungen, sportlich aktiven Menschen sind es vor allem akute Unfallverletzungen, die zu Schulterschmerzen führen. Häufig kommt es zur Schulterluxation, also zur Ausrenkung des Gelenks, und damit ist es nach dem Einrenken in der Notaufnahme meist nicht getan. Denn nicht selten wird dabei zusätzlich die Gelenklippe verletzt, die zur Stabilität der Schulter beiträgt. „Genau diese Begleitverletzungen sind der Grund, warum die Schulter nach einer Ausrenkung häufig instabil bleibt“, sagt Dr. Zoffl. Bleiben Betroffene sportlich aktiv, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Schulter erneut ausrenkt. In solchen Fällen werde deshalb häufig operativ stabilisiert, um wiederholte Ausrenkungen zu verhindern. Dabei wird die verletzte Gelenklippe meist minimalinvasiv wieder am Gelenk fixiert und die Schulter so stabilisiert, dass sie im Alltag und beim Sport besser „hält“.
Ebenfalls typisch bei Jüngeren ist eine Verletzung des Schultereckgelenks, oft nach Stürzen auf die Schulter, etwa beim Radfahren. „Dabei kann dann das Schultereckgelenk aufreißen“, weiß Zoffl. Je nach Ausprägung werde auch diese Verletzung häufig operativ behandelt. Ziel ist dann, das Gelenk wieder zu stabilisieren, etwa durch eine Rekonstruktion der gerissenen Bandverbindungen oder durch eine vorübergehende Fixierung.
Schulter am Limit
Im mittleren Lebensalter stehen meist schleichende Überlastungsschäden im Vordergrund. Häufig betroffen ist die sogenannte Rotatorenmanschette, eine Sehnenstruktur, die den Oberarmkopf führt und dafür sorgt, dass der Arm angehoben werden kann. Über Jahre hinweg kann es durch körperliche Arbeit, Sport oder Tätigkeiten über Kopf zu einem Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit kommen. Die Folge sind Schmerzen, vor allem beim Heben des Arms, und ein zunehmender Kraftverlust. Reißt die Sehne, lässt sich der Arm im Extremfall kaum oder gar nicht mehr aktiv anheben. Ebenfalls typisch ist das sogenannte Impingement, eine Schulterenge unter dem Schulterdach. „Dabei werden Sehnen und Schleimbeutel bei bestimmten Bewegungen eingeengt, was auch hier beim Anheben des Arms zu starken Schmerzen führt“, so Dr. Zoffl. Bleibt diese Enge über längere Zeit bestehen, kann sie die Sehnen zusätzlich schädigen und einen Riss der Rotatorenmanschette begünstigen. Die beiden Probleme hängen also häufig zusammen.
Knochen geben nach
Bei älteren Menschen spielen vor allem die Knochenqualität und Sturzverletzungen eine größere Rolle. „Je nach Altersgruppe unterscheidet sich die Knochenqualität, und entsprechend unterscheiden sich auch die Verletzungen“, erklärt Dr. Zoffl. Häufig sind Brüche im Bereich des Oberarms beziehungsweise des Oberarmkopfs, die aufgrund der geminderten Knochenfestigkeit oft operativ versorgt werden müssen. In der Regel erfolgt das durch eine Stabilisierung mit einer Platte. „Wenn zu viel zerstört ist, ist in sehr seltenen Fällen eine Prothesenoperation notwendig“, sagt der Chefarzt. Langfristig können zudem unbehandelte oder über lange Zeit bestehende Schulterprobleme in eine Arthrose des Schultergelenks münden, die dann, ähnlich wie bei Hüfte oder Knie, einen Gelenkersatz erforderlich machen kann.
Was die Schulter für Facharzt Dr. Zoffl besonders anspruchsvoll und anfällig für Vernarbungen und Bewegungseinschränkungen macht, ist das feine Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Sehnen. Umso wichtiger sei heute ein ausgewogenes Vorgehen nach Verletzungen oder Operationen. Dank moderner, meist minimalinvasiver Verfahren könne die Schulter in vielen Fällen frühzeitig wieder bewegt werden. Längere Ruhigstellungen, wie sie früher üblich waren, würden bewusst vermieden, sagt er.
Im Vortrag „Schulterschmerzen – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“ informiert Dr. med. Florian Zoffl, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, über typische Ursachen von Schulterschmerzen in verschiedenen Lebensphasen und welche modernen Behandlungs- und Operationsverfahren heute zur Verfügung stehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhall statt und ist Teil der Reihe „GesundheitAktiv“ der Kliniken Südostbayern (KSOB). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.
29.01.2026 - Klinikum Traunstein
Krebsmedizin im Wandel: Von der Angstdiagnose zur Heilungschance
Zum Weltkrebstag am 4. Februar: Warum Prävention und Früherkennung so wichtig sind – und warum spezialisierte Zentren Leben verlängern können

Ein Wort, das den Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und doch gehört zur Wahrheit heute auch: Immer mehr Menschen können geheilt werden, oder leben viele Jahre gut mit der Krankheit. Die Medizin hat aufgeholt – mit präziser Diagnostik, besseren Operationstechniken, wirksameren Medikamenten, zielgerichteten Therapien und Immuntherapien zur Einbeziehung des körpereigenen Abwehrsystems. Krebs ist längst nicht mehr automatisch ein Todesurteil. Entscheidend ist, wann ein Tumor entdeckt wird. Und wo er behandelt wird. mehr...
Denn Krebs ist nicht gleich Krebs. Und Behandlung ist nicht gleich Behandlung. Wer früh zur Vorsorge geht, gibt sich selbst einen Vorsprung. Und wer sich in einem spezialisierten, zertifizierten Zentrum behandeln lässt, erhöht nachweislich seine Chancen. Genau hier setzt das von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierte Onkologische Zentrum am Klinikum Traunstein an. Es bündelt Fachwissen, Erfahrung und abgestimmte Abläufe – und wird regelmäßig auf Qualität geprüft.
„Wir erleben täglich, dass Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Krebs heute deutlich mehr Perspektiven haben als noch vor zehn oder zwanzig Jahren“, sagt Dr. Thomas Kubin, Chefarzt der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Traunstein und Sprecher des Onkologischen Zentrums. „Selbst bei metastasierten Tumoren oder weit fortgeschrittenen Leukämien oder Lymphknotenkrebsen sehen wir immer mehr Langzeitverläufe oder auch Heilungen. Am besten ist es natürlich, wenn man eine bösartige Erkrankung bereits im Frühstadium erkennt.“
Vorsorge ist kein Luxus – sie ist Lebenszeit
Wer Krebs früh entdeckt, hat in vielen Fällen beste Chancen. Ein Tumor im Anfangsstadium ist häufig lokal begrenzt, gut operabel, mitunter ohne aggressive Therapie behandelbar. Das gilt etwa für Darmkrebs, Brustkrebs, Hautkrebs, Prostatakrebs – und andere häufige Tumorarten.
Prävention beginnt dabei nicht erst im Wartezimmer. Sie beginnt im Alltag: Nichtrauchen, viel Bewegung, gesunde Ernährung, Schutz vor UV-Strahlung, maßvoller Alkoholkonsum, Optimierung des Körpergewichtes. Und sie setzt sich fort in den Vorsorgeprogrammen: Hautcheck, Darmspiegelung, gynäkologische Untersuchungen, Mammographie-Screening, Prostatakrebsvorsorge – je nach Alter und Risiko.
„Früherkennung ist kein Angstprogramm, sondern eine Chance“, sagt Dr. Kubin „Viele kommen zu spät, weil sie das Thema wegschieben. Dabei kann genau diese Untersuchung den Unterschied machen.“
Spezialisiert behandeln lassen – der Vorteil ist messbar
Neben der Früherkennung spielt ein zweiter Punkt eine immer größere Rolle: die Behandlung im richtigen Umfeld. In Deutschland gibt es ein strukturiertes Netz DKG-zertifizierter Krebszentren, die klare Anforderungen erfüllen müssen – etwa bei Erfahrung, Mindestfallzahlen, interdisziplinären Tumorkonferenzen, modernsten Therapieverfahren, dokumentierter Qualität und jährlichen Überprüfungen.
Und: Es gibt inzwischen belastbare Hinweise aus großen Datenauswertungen, dass Patientinnen und Patienten davon profitieren. Eine Analyse unter anderem auf Basis von Versorgungsdaten zeigte: Wer in zertifizierten Zentren behandelt wird, hat über verschiedene Tumorarten hinweg einen Überlebensvorteil. Das ist keine Werbebotschaft. Das ist Statistik. Und sie hat einen einfachen Kern: Routine schafft Sicherheit. Spezialisierung schafft Präzision. Und gute Abläufe sparen Zeit – die bei Krebs oft entscheidend ist.
Das Onkologische Zentrum Traunstein: zertifizierte und spezialisierte Qualität unter einem Dach
Das Onkologische Zentrum in Traunstein vereint seit 2012 mehrere spezialisierte Krebszentren und unterstützende Fachdisziplinen für die Region Südostbayern. Ziel ist eine koordinierte Behandlung – von der raschen Diagnose über eine auf den Patienten zugeschnittene Therapie bis zur Nachsorge. Der Anspruch: Therapie nach offiziellen Leitlinien oder darüber hinaus nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, abgestimmt im Team, transparent dokumentiert. Und: überprüft durch die DKG. „Zertifizierung bedeutet nicht nur ein Siegel auf Papier“, betont Dr. Kubin. „Es bedeutet gelebte Struktur. Jeder Fall wird im wöchentlichen interdisziplinären Tumorboard besprochen, jeder Schritt ist abgestimmt, und wir messen unsere Qualität – immer wieder.“
Am Klinikum Traunstein sind mehrere spezialisierte Bereiche gebündelt: Das Brustkrebszentrum, das Gynäkologische Krebszentrum, das Viszeralonkologische Zentrum für Darm- und Pankreaskrebs, das Urogenitale Krebszentrum für Prostata-, Hoden- und Nierenkrebs sowie das Hämatologische Zentrum für Leukämien und Lymphome. Mit diesen onkologischen Fachbereichen arbeiten viele weitere Disziplinen zusammen: Chirurgie, Radiologie, Strahlentherapie, Pathologie, Studienzentrum, Fachpflege, Psychoonkologie, Sozialdienst. Das Ziel ist kein Nebeneinander, sondern ein Miteinander.
Eine Neuerung unter dem Dach des Onkologischen Zentrums kann Dr. Kubin ebenfalls vermelden: „Seit kurzem haben wir auch das Lungenkrebszentrum Südostbayern ins Leben gerufen, in Traunstein neu mit dem Bereich onkologische und interventionelle Pneumologie. In enger Zusammenarbeit der KSOB mit dem InnKlinikum liegt hier der Schwerpunkt auf der Diagnostik und Behandlung von Lungenkrebs sowie auf bronchoskopischen Eingriffen.“ Geleitet wird die Pneumologie in Traunstein von Priv.-Doz. Dr. Arno Mohr, zugleich Chefarzt der Pneumologie am InnKlinikum Mühldorf. In enger Kooperation mit der breit aufgestellten Thoraxchirurgie und der internistischen Onkologie sowie weiteren Fachabteilungen ist so in Traunstein ein Lungenkrebszentrum im Aufbau, das demnächst zur Zertifizierung anstehen wird.
Was Patientinnen und Patienten heute konkret gewinnen
Die moderne Onkologie hat große Fortschritte gemacht mit früheren Diagnosen durch bessere Bildgebung, Screening, Sensibilität. Durch bessere Therapien durch Kombinationen aus Operation, Bestrahlung und medikamentösen Verfahren und, wo möglich, bereits auf dem Boden der Eigenschaften von Tumoren auf Grund ihrer individuellen genetischen Veränderungen. Und durch bessere Steuerung durch Zentren, Tumorkonferenzen und zertifizierte Prozesse. „Die Menschen hören ‘Krebs’ – und denken sofort an Endstation“, sagt Dr. Kubin. „Dabei ist die Realität meist eine andere: Viele Tumorerkrankungen sind heute gut behandelbar. Und bei einigen sprechen wir längst von Heilung. Die moderne Medizin entwickelt dank der biotechnologischen Möglichkeiten immer schneller und immer mehr hochinnovative, bislang ungeahnte Behandlungsmöglichkeiten.“ Wer heute über Krebs spricht, muss zwei Sätze gleichzeitig sagen können. Der erste: Ja, Krebs ist eine ernste Erkrankung. Der zweite: Nein, es ist nicht mehr automatisch ein Todesurteil. Prävention und Früherkennung sind der erste Hebel. Sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln zu lassen, ist der zweite. Und zusammen ergeben sie die beste Nachricht, die Medizin derzeit geben kann: Es gibt Wege. Und es gibt Chancen. Oder, wie Dr. Kubin es formuliert: „Man muss Krebs sehr ernst nehmen. Aber man muss ihm längst nicht mehr die letzte Antwort überlassen.“
Hilfe, die nicht im Arztbrief steht: „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“
Zur Medizin gehört aber auch das, was man nicht operieren kann: Sorgen, Erschöpfung, Ängste, Familienfragen, Bürokratie. Der Moment, in dem man nachts wachliegt und nicht weiß, wie man den nächsten Tag schaffen soll. In Traunstein gibt es dafür eine wichtige Adresse: „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“ Der Verein unterstützt Betroffene und Angehörige – ehrenamtlich, unabhängig, orientierend. Das ist die zweite Seite der Versorgung: nicht nur Therapie, sondern Halt. Nicht nur Leitlinie, sondern Menschlichkeit. „Eine Krebserkrankung trifft nie nur ein Organ“, sagt Dr. Kubin. „Sie trifft ein ganzes Leben und das gesamte familiäre Umfeld. Darum ist dieses Angebot so wertvoll.“ Kontakt aufnehmen können Betroffene oder Angehörige unter: oder telefonisch unter der Nummer 0176 43151575.
29.01.2026 - Kreisklinik Trostberg
„Persönlich, zugewandt, beste Arbeitsbedingungen“
Die Kreisklinik Trostberg ist einer von „Deutschlands ausgezeichneten Arbeitgebern Pflege“ des Magazins Stern

Die aktuelle Stern-Studie 2025 hat „Pflege als Beruf: Hier finden Sie attraktive Arbeitgeber“ zum Thema, die von der stern-Redaktion in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut MINQ entwickelt wurde. Sie beleuchtet, in welchen Einrichtungen in Deutschland gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu finden sind – ein Thema, das in Zeiten des Fachkräftemangels und hoher Belastungen im Pflegealltag enorm an Bedeutung gewonnen hat. mehr...
Grundlage der Untersuchung ist eine mehrstufige, datenbasierte Analyse: Neben Qualitätsberichten wurden Patientenbewertungen, Arbeitgeberangaben zur Vergütung, familienfreundliche Angebote, Arbeitsbedingungen sowie Perspektiven für Mitarbeitende ausgewertet.
In der Studie wurden über 2400 Krankenhäuser und 1100 Rehakliniken in Deutschland überprüft. Einrichtungen mussten in mehreren Kriterien überdurchschnittlich gut abschneiden, um als „attraktiver Arbeitgeber“ gelistet zu werden. Besonderes Gewicht erhielten dabei Qualität und Arbeitsbedingungen.
Vor diesem Hintergrund rückt die Kreisklinik Trostberg als regionaler Gesundheitsversorger in ein positives Licht. Als Standort der Kliniken Südostbayern AG fand sie als eine von nur 104 Kliniken in ganz Deutschland Eingang in die Liste der ausgezeichneten „Kleineren Krankenhäuser“ mit weniger als 400 Betten.
Die besten Einstufungen erzielte die Kreisklinik für die folgenden Kriterien: Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vergütung, sowie für Perspektive im Unternehmen.
Durch steigende Anforderungen im Gesundheitswesen ist die Kreisklinik Trostberg daher nicht nur ein zentraler Gesundheitsversorger, sondern auch ein Arbeitgeber, der im Sinne der aktuellen Studie für attraktive Arbeitsbedingungen steht – und damit ein wichtiger Anlaufpunkt in der Region ist auch für Fachkräfte in medizinisch-technischen Assistenzberufen, wie Operations- und Anästhesie-technische Assistenten.
Dunja Wondra, Pflegedirektorin der Kreisklinik Trostberg, freut sich über die Auszeichnung: „Die hohe Einstufung der Kreisklinik Trostberg in der stern-Studie verdeutlicht, dass der Erfolg einer Einrichtung immer auf der Zusammenarbeit aller Berufsgruppen basiert. Die gute Arbeitsatmosphäre und die attraktiven Bedingungen sind daher nicht nur das Resultat einer erfolgreichen Klinikstrategie, sondern auch das Ergebnis des Engagements und der Expertise der Mitarbeitenden vor Ort. Denn sie stehen hinter der Qualität und dem Erfolg der Klinik.“
29.01.2026 - Klinikum Traunstein
Millimeterarbeit mit System – Hightech am Operationstisch
Wie der Einsatz des OP-Roboters daVinci selbst Mastdarmkrebs-Operationen besser beherrschbar macht
Am Klinikum Traunstein wurde der OP-Roboter daVinci in 2023 installiert. Seitdem nutzen verschiedene Fachbereiche diese neue Technik, unter anderem die Urologie, die Gynäkologie und die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Letztes Jahr wurden am Klinikum insgesamt 267 Eingriffe mit robotischer Hilfe durchgeführt, mehr als die Hälfte davon, nämlich 140, in der Allgemein- und Viszeralchirurgie – ein klares Signal: Diese Technik ist nicht Experiment, sondern Routine und wertvolle Ergänzung, denn sie verspricht mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. mehr...
In 2025 wurden diese Patientinnen und Patienten am Darm, am Magen, an der Nebenniere und an der Bauchspeicheldrüse operiert. Neben dem Einsatz bei Tumorpatienten werden zunehmend auch Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen robotisch gestützt operiert.
Besonders bei Mastdarmkrebs operieren die Chirurginnen und Chirurgen in einer anatomischen Engstelle: tief im Becken und dicht an Nerven, die über Kontinenz und Sexualfunktion entscheiden. Genau hier tritt daVinci in Aktion, denn in diesem Bereich ist wenig Platz, aber viel Verantwortung. Mastdarmkrebs, medizinisch Rektumkarzinom, sitzt häufig in einer Zone, in der millimetergenaue Entscheidungen über das Leben nach der Operation bestimmen: Kann der Patient Stuhl und Urin halten? Bleibt die Sexualfunktion erhalten? Und gelingt zugleich die onkologisch saubere Entfernung des Tumors und damit das verbesserte Langzeitüberleben?
„Die chirurgische Behandlung des Mastdarmkrebses ist anspruchsvoll, weil der Tumor im engen Becken liegt und wichtige Nervenstrukturen direkt benachbart sind“, sagt Prof. Dr. Christian Jurowich, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Wir müssen radikal genug operieren, um den Krebs sicher zu entfernen – und gleichzeitig so schonend wie möglich, um die Funktionen zu erhalten.“
Was im OP den Unterschied macht: Exakt sehen und präzise behandeln
Robotische Systeme arbeiten nicht selbstständig. Sie sind keine „Maschinenärzte“, sondern hochpräzise Instrumente, die vollständig durch die Operateurin oder den Operateur gesteuert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: bessere Sicht, bessere Beweglichkeit, bessere Kontrolle. Im Becken, wo herkömmliche Instrumente an Grenzen stoßen, kann der Roboter die Hand der Chirurgin und des Chirurgen verlängern und verfeinern.
Dr. Birgit Reinisch, Oberärztin Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie, und Darmzentrumskoordinatorin, erklärt: „Die Bildgebung ist hochauflösend, die Darstellung vergrößert. Und die Instrumente lassen sich in Winkeln bewegen, die menschliche Handgelenke nicht leisten. Das schafft Spielraum, gerade bei anatomisch so beengten Raumverhältnissen wie im kleinen Becken. Die Abwinkelung der Instrumente hilft uns damit besonders bei tiefsitzenden Tumoren. Wir können präziser präparieren und haben eine sehr gute Übersicht. Das ist entscheidend, wenn es um die Schonung der Nerven geht, die Kontinenz und Sexualfunktion steuern.“
Das Versprechen und der Vorteil dahinter sind klar: möglichst komplette Entfernung des Tumors, aber ohne Kollateralschäden. Denn früher war die Mastdarmkrebs-Chirurgie eine Geschichte des Entweder-oder: Tumor sicher entfernt, aber Kontinenz und Sexualfunktion verloren. Die Robotik verspricht jetzt ein Sowohl-als-auch.
Für welche Krankheitsbilder eignet sich der Einsatz des Roboters besonders?
Nicht jeder Eingriff braucht Robotik. Aber manche profitieren deutlich. Dr. Reinisch erläutert: „Besonders geeignet ist der daVinci-Einsatz bei Mastdarmkrebs im mittleren und unteren Drittel, denn hier zählt jeder Millimeter, weil der Tumor tief im Becken liegt und die Präparation eng an nervalen Strukturen verläuft. Außerdem bei komplexen anatomischen Verhältnissen, etwa bei einem engen Becken, bei Adipositas oder schwierigen Tumorlagen. Auch Rekonstruktionen und feine Nahttechniken, bei denen Präzision über eventuelle Komplikationen entscheidet, können durch die Unterstützung des OP-Roboters noch besser behandelt werden.“ Längst hat sich am Klinikum Traunstein die robotische Operation aber auch bei anderen Dickdarmtumoren sowie bei Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs durchgesetzt: Die Patientinnen und Patienten haben postoperativ deutlich weniger Schmerzen und erholen sich schnell von selbst großen und komplizierten Operationen.
In der Viszeralchirurgie dominieren Tumorerkrankungen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Gallenblasen- und Leistenhernien-Operationen, Eingriffe an Magen und Darm und an der Bauchspeicheldrüse. Das zweite große Feld, in dem Robotik vielerorts eingesetzt wird, sind urologische Eingriffe – etwa an der Prostata.
Was sagt die Forschung?
Die robotische Chirurgie wird bereits breit angewandt, doch fehlten lange Zeit belastbare Langzeitdaten. Nun liefert die internationale REAL-Studie neue Argumente aus dem Bereich des Mastdarmkrebses: In einer anonymisierten Untersuchung mit 1.240 Patientinnen und Patienten aus elf Zentren wurden robotische und laparoskopische Operationen verglichen. Bewertet wurden unter anderem lokales Wiederkehren, krankheitsfreies und Gesamtüberleben sowie funktionelle Ergebnisse, wie Urin- und Stuhlinkontinenz und sexuelle Funktionsstörungen. Die Ergebnisse nach drei Jahren fielen zugunsten der Robotik aus: Die lokale Rückfallrate war niedriger (1,6% vs. 4,0%), und bei niedrig sitzenden Tumoren zeigte sich ein Vorteil im krankheitsfreien Überleben.
Prof. Dr. Jurowich fasst zusammen: „Robotische Chirurgie ist kein Zauber, sondern Unterstützung. Sie ersetzt nicht Erfahrung, Planung und ein gutes Team. Aber sie verschiebt Grenzen dort, wo Grenzen bislang zu oft zulasten der Patientinnen und Patienten gingen. Denn am Ende zählt nicht, ob wir modern operieren. Sondern ob die Patientin oder der Patient nach der Operation gut leben können.“
Eines der weltweit modernsten roboterassistierten Operationssysteme
Das Klinikum Traunstein verfügt als eine der wenigen Kliniken in Deutschland über zwei Steuerungskonsolen für den Betrieb des OP-Roboters daVinci. Neben der Allgemein- und Viszeralchirurgie nutzen auch die Operateure der Urologie und der Gynäkologie diese unterstützende Technologie.
Mit dem daVinci-System erfolgt der Zugang zum Operationsfeld in der Körperhöhle genauso wie bei der konventionellen laparoskopischen Operation mit der sogenannten Schlüssellochtechnik über mehrere millimeterkurze Schnitte. Über diese Zugänge werden dann die verschiedenen Hochpräzisions-Instrumente eingeführt. Dank einer Miniaturkamera mit Licht und des Softwaresystems sieht der Operateur das Operationsfeld in der Optik der Steuerkonsole in einer hochaufgelösten, drei-dimensionalen Ansicht in zehnfacher Vergrößerung. Dadurch ist die räumliche Struktur und Lage der Organe genau erkennbar. Dank der intuitiven Steuerung mittels Konsole sowie der Mehrachsigkeit und Präzisionsmechanik können die Miniaturinstrumente wesentlich genauer bewegt werden. Die Vorteile für den Patienten liegen auf der Hand: Tumore lassen sich bei operativen Eingriffen wesentlich präziser präparieren. Dank spezieller Sicherheitsfeatures und der Möglichkeit zum Einspielen wichtiger Patientendaten beim Operieren behält der Operateur während des ganzen Eingriffs die komplette Kontrolle über das Geschehen. Der Blutverlust sowie Gewebeschädigungen oder Stressreaktionen des Körpers fallen deutlich geringer aus. Das führt zu einer schnelleren Genesung der Behandelten und verringert ihre Verweildauer im Krankenhaus.
28.01.2026 - Klinikum Traunstein
Blick hinter die Kulissen der Strahlentherapie
Oberstufenkurs Biophysik des Chiemgau Gymnasiums besucht das Klinikum Traunstein
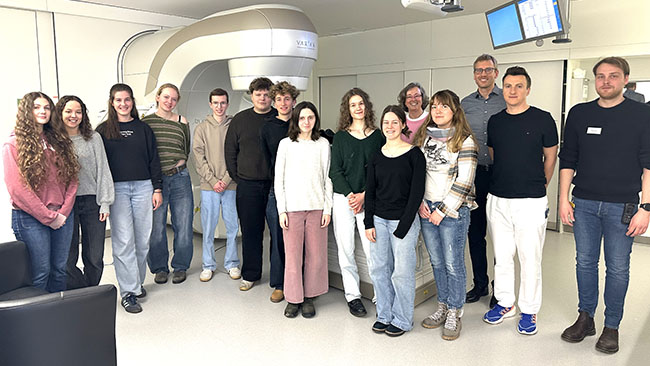
Einen besonderen Einblick in die moderne Medizin erhielt eine kleine Schülergruppe des Oberstufenkurses Biophysik: Elf Schülerinnen und Schüler besuchten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Monika Mende-Plenk die Abteilung Strahlentherapie am Klinikum Traunstein. mehr...
Ziel des Besuchs war es, die Abläufe und technischen Möglichkeiten der Abteilung kennenzulernen – und dabei Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Ende letzten Jahres hatte Herr PD Dr. Matthias Hautmann, Chefarzt der Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie, im Rahmen einer Unterrichtsstunde am Chiemgaugymnasium bereits über die Grundlagen der Strahlentherapie referiert.
Beim Termin in der Abteilung stand vor allem im Mittelpunkt, hinter die Kulissen der Geräte zur Strahlenerzeugung sowie der Planung der Bestrahlungen zu schauen. Für die Jugendlichen bot sich die Gelegenheit aus erster Hand zu erfahren, wie präzise Behandlungen vorbereitet werden und welche Schritte im Klinikalltag notwendig sind, bevor Patientinnen und Patienten ihre Therapie erhalten.
„Ein Einblick in unsere hochkomplexen Abläufe und Planungen und die Technik hinter der Strahlenbehandlung ist wichtig – um zu sehen, warum einiges an theoretischem Schulwissen auch im Arbeitsalltag benötigt wird“, betonte PD Dr. Hautmann.
Auch Monika Mende-Plenk zeigte sich überzeugt: „Das im Lehrplan vorgesehene Kapitel Strahlenbiophysik lässt sich durch diesen Praxisbezug ideal ergänzen. Der persönliche Kontakt und das Kennenlernen der Abläufe waren für die Schülerinnen und Schüler sehr gewinnbringend.“ Der Besuch machte deutlich: Wissen wird besonders greifbar, wenn Lerninhalte direkt vor Ort erlebbar werden. Daher ist auch für die Zukunft geplant, dass Schüler des Chiemgaugymnasiums Unterrichtsgänge vor Ort erleben und so Theorie und Praxis verbinden.
15.01.2026 - Klinikum Traunstein
Nach 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Ärztlichen Direktorat
PD Dr. Tom-Philipp Zucker übergibt das Amt des Ärztlichen Direktors an Prof. Dr. Carsten Böger

Nach zehn Jahren als Stellvertreter des Ärztlichen Direktors und acht Jahren in der Verantwortung als Ärztlicher Direktor am Klinikum Traunstein freut sich Privatdozent Dr. Tom-Philipp Zucker, diesen wichtigen Posten zum 1. Januar 2026 an Prof. Dr. Carsten Böger, Chefarzt der Abteilung für Nephrologie, Diabetologie und Rheumatologie, übergeben zu haben. mehr...
Prof. Dr. Böger war bereits in den letzten acht Jahren als Stellvertreter von Dr. Zucker intensiv in die Aufgaben und Herausforderungen des Amtes eingebunden und konnte sich somit hervorragend auf diese neue verantwortungsvolle Position vorbereiten. Er übernimmt nun die Leitung als Ärztlichen Direktor und wird gemeinsam mit dem Ärztlichen Team die medizinische Versorgung sowie die strategische Ausrichtung des Klinikums Traunstein weiter vorantreiben.
Für PD Dr. Tom-Philipp Zucker ist die Übergabe des Amtes ein wichtiger Schritt. „Es ist nicht immer ganz leicht, Verantwortung abzugeben“, kommentiert er. „Die acht Jahre als Ärztlicher Direktor waren zudem eine lange und fordernde Zeit, insbesondere während der Pandemie. Ich blicke aber auf eine äußerst spannende und bereichernde Zeit zurück und bin sehr dankbar, dass ich dieses Amt ausfüllen durfte.“
Zucker wird auch weiterhin als Chefarzt die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Traunstein leiten und damit die medizinische Versorgung in diesen hochkomplexen Bereichen sicherstellen. „Ich freue mich darauf, weiterhin fachübergreifende Aufgaben wahrzunehmen“, fügt er hinzu. „Neben meiner Tätigkeit als Chefarzt werde ich auch in den kommenden Jahren in der Transfusionsmedizin aktiv sein, das Ethik-Komitee leiten und als Koordinator der Studentinnen und Studenten im Praktischen Jahr tätig sein.
Prof. Dr. Carsten Böger, der ab Januar 2026 offiziell das Amt des Ärztlichen Direktors übernommen hat, betont: „Es ist mir eine große Ehre und Verantwortung, das Ärztliche Direktorat am Klinikum Traunstein zu übernehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen das hohe Niveau der medizinischen Versorgung und die Weiterentwicklung des Klinikums fortzuführen. Die letzten Jahre als Stellvertreter von Herrn PD Dr. Zucker haben mir einen ausgezeichneten Einblick in die vielfältigen Herausforderungen dieser Position gegeben. Ich danke ihm für seine exzellente Arbeit und für das Vertrauen, das er mir immer entgegengebracht hat.“
Zusätzlich wird Prof. Dr. Afshin Rahmanian-Schwarz, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Zentrum für Handchirurgie, als Stellvertretender Ärztlicher Direktor tätig sein und damit das Führungsteam in Traunstein verstärken. Die Neustrukturierung stellt sicher, dass sowohl die konservativen internistischen als auch die operativen chirurgischen Disziplinen in der Leitung vertreten sind.
Jessica Koch, Klinikleiterin der Kliniken Südostbayern (KSOB) am Standort Traunstein, erklärt mit Blick auf den Wechsel an der Spitze des Ärztlichen Diensts: „Herr Prof. Dr. Böger bringt nicht nur herausragende Fachkompetenz mit, sondern auch viel Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums und der KSOB. Gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Rahmanian-Schwarz wird er dafür sorgen, dass das Klinikum Traunstein weiterhin exzellente medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bietet.“ Der KSOB-Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher betont: „Ich danke Herrn PD Dr. Zucker für sein langjähriges Engagement und die exzellente Führung in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass das Klinikum Traunstein unter der ärztlichen Leitung von Herrn Prof. Dr. Böger weiterhin erfolgreich in die Zukunft geht.“
Abschließend resümiert PD Dr. Zucker: „Es war mir eine Freude, in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mitgliedern der Klinikleitung und dem Führungsteam der KSOB die fachliche Ausrichtung und Ausweitung des Leistungsspektrums für unsere Patienten am Klinikum Traunstein mitzugestalten. Ich danke dem Führungsteam und dem Chefarztkollegium für die Unterstützung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit bei der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.“
12.01.2026 - Klinikum Traunstein
Ein kleines Wunder namens Emma
Eines der kleinsten Frühchen der Kinderklinik Traunstein von 2025 ist wohlauf

Wenn man die Kinderintensivstation des Klinikums Traunstein betritt, spürt man manchmal jene besonderen Momente, die einen den Atem anhalten lassen. Einer dieser Augenblicke war der Besuch der kleinen Emma – jenem winzigen Frühchen, das 2025 als eines der kleinsten Babys in die Geschichte der Station eingeht. Gerade einmal 400 Gramm leicht und 27 Zentimeter klein, geboren in der 25. Schwangerschaftswoche, verbrachte sie zehn Wochen auf der Intensivstation und anschließend weitere zwei Wochen auf der Kinderstation. Heute, neun Monate später, sitzt dort ein fröhliches Baby mit fünf Kilo, rosigen Bäckchen und wachen Augen – ein kleines Wunder, das die Herzen im Sturm erobert. mehr...
„Es ist für mich immer schön herzukommen…“
Als Emmas Familie die Intensivstation betritt, liegt spürbar Rührung in der Luft. Für das Team ist es ein Wiedersehen voller Freude. Für die Eltern ein Ort, an dem sie ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen können. Die Mutter lächelt, als sie sagt: „Es ist für mich immer schön herzukommen und Sie alle wiederzusehen. Da erinnere ich mich, wie gut ich hier betreut wurde. Immer wart ihr für uns da. Ich möchte, dass ihr wisst, wie gut ihr seid – und wie gut es Emma dank Euch geht.“ Ein großes Lob findet die Mutter ebenso für die Gynäkologie, wo sie sich jederzeit bestens betreut fühlte.
Auch Emmas Vater findet bewegende Worte. Beruflich ist er oft als Techniker in großen Münchner Kliniken unterwegs – und gerade deshalb spürt er den Unterschied: „Es gibt keine Worte, die unseren Dank ausdrücken können. Dieses Krankenhaus ist familiär und voller menschlicher Wärme. Wir haben uns hier so geborgen gefühlt.“
Besonders wertvoll für die Familie war, dass das Team die Eltern bei jedem Schritt eingebunden, mitgenommen und informiert hat. Ebenso bedeutend war der Austausch mit anderen Familien, zu denen sie bis heute Kontakt halten.
Prof. Gerhard Wolf, der Chefarzt der Kinderklinik Traunstein, freut sich über dieses Lob: „Diese Anerkennung spiegelt genau das wider, wofür wir als gesamtes Team stehen: die Verbindung von medizinischer Exzellenz und menschlicher Zuwendung.“
Als Ines Pato, stellvertretende Leiterin der Kinderintensivstation, die Emma wochenlang in der Kinderintensivstation begleitet hat, anfängt zu sprechen, beginnt Emmas Gesicht zu leuchten. Sie erkennt die Stimme – jene Stimme, die für sie damals so vertraut war. Ines Pato lächelt gerührt: „In so einem Moment wird es mir richtig bewusst, warum ich meinen Beruf gewählt habe.“
Und als die kleine Emma während des Besuchs anfängt, auf ihren kleinen Fingerchen herumzukauen, schmunzelt das Team, denn jeder weiß sofort, was das bedeutet: Die ersten Zähnchen kündigen sich an. Der Leitende Oberarzt Dr. Ulrich Römer bemerkt es mit Freude: „Es ist doch schön, dass wir jetzt über so normale Babythemen sprechen. Das zeigt, die Frühchenzeit ist vorbei und jetzt geht es ganz normal weiter.“
Ein Kreis, der sich schließt
Emma kommt weiterhin regelmäßig zur Kontrolle zu Dr. Römer und erhält Förderung im Sozialpädiatrischen Zentrum am Klinikum Traunstein. Alles bleibt für das Kind vertraut, denn jeder hier kennt die Familie, kennt Emma, kennt ihre Geschichte.
Als besonders bewegend bleibt ein Moment in Erinnerung: Vor Jahren hatte die Familie Marijic sich an einer Spendenaktion für ein spezielles Frühchen-Ultraschallgerät des Klinikums beteiligt. Damals ahnten sie nicht, dass sie dieses Gerät einmal selbst brauchen würden. Heute erfüllt es sie mit großer Dankbarkeit zu hören, wie viele Spenden bereits für die neue Kinderintensivstation eingegangen sind.
Auch die Mutter wollte weiterhin anderen Frühchen helfen: Mit großer Überzeugung spendete Emmas Mutter damals Muttermilch – ein Zeichen der Dankbarkeit und des Mitgefühls. Und sie wollte Anderen auch Mut machen: Als Emma bereits auf der Normalstation war, gingen Mutter und Tochter oft über die Geburtsstation spazieren. Dort zeigte sie Müttern in ähnlichen Situationen ihr kleines Wunder: ein Lichtblick in schweren Zeiten.
Emma ist heute ein fröhliches, fideles Baby – lebendig, neugierig und von liebevoller Geborgenheit umgeben. Ganz besonders glücklich ist sie mit ihren beiden älteren Geschwistern, die sich rührend um sie kümmern und ihr gern kleine Lieder vorsingen.
02.01.2026 - Kliniken Südostbayern
An Silvester und Neujahr das Licht der Welt erblickt
Unsere neuen Erdenbürgerinnen
Zum Jahreswechsel erblickten wieder Silvester- und Neujahrs-Babys an den Kliniken Südostbayern (KSOB) das Licht der Welt. Die jungen Erdenbürgerinnen wurden sowohl im Klinikum Traunstein als auch in der Kreisklinik Bad Reichenhall willkommen geheißen. mehr...
In der Kreisklinik Bad Reichenhall erblickte die kleine Alyssia Ciobanu Koltsova, am 31.12.2025 um 07:34 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3605 Gramm das Licht der Welt. Sie war zugleich die 500. Geburt in der Kreisklinik Bad Reichenhall.
Bild 1: Die kleine Alyssia mit stolzen Eltern und Oma sowie dem Team der Geburtshilfe der Kreisklinik Bad Reichenhall.
Die kleine Amara Sakic ist das Neujahrsbaby in Bad Reichenhall. Sie kam am 01.01.2026 um 13:13 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3750 Gramm zur Welt.
Bild 2: Die kleine Amara mit den stolzen Eltern.
Im Klinikum heißt das Neujahrsbaby Liv Schätz. Sie kam am 01.01.2026 um 05:17 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3880 Gramm zur Welt.
Bild 3: Die kleine Liv mit den stolzen Eltern.
Die Geburtshilfen in Bad Reichenhall und Traunstein begrüßen die neuen Erdenbürger und gratulieren den stolzen Eltern.
29.12.2025 - Klinikum Traunstein
Ein Schlaganfall verzeiht keine Zeitverzögerung
Schlaganfalleinheit am Klinikum Traunstein erneut erfolgreich geprüft
Time is brain, also Zeit ist Gehirn – so lautet die Grundregel bei Schlaganfällen. Will heißen, je schneller die Versorgung in der Klinik nach einem Schlaganfall beginnt, desto besser sind die Chancen auf gute Genesung. Ein wichtiger Faktor dafür ist die tägliche Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit einer leistungsfähigen und geprüften „Stroke Unit“ – so heißt die Schlaganfalleinheit einer Klinik in der Fachsprache. Und zwar wohnortnah und schnell erreichbar. mehr...
Der Medizinische Dienst Bayern hat die Stroke Unit am Klinikum Traunstein Anfang Dezember in einer Strukturprüfung erneut begutachtet und daraufhin die Einhaltung sämtlicher Merkmale wieder positiv bescheinigt. Dabei wurde diese auf die Schlaganfallbehandlung spezialisierte Einheit unter der Leitung von Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie, einer strengen Prüfung unterzogen.
24 Stunden täglich fachärztliche Expertise vor Ort
Prof. Dr. Etgen erläutert die personelle Grund-Struktur, die für den Betrieb einer Stroke Unit notwendig ist: „Zunächst sind täglich 24 Stunden ein Facharzt/ärztin oder Assistenzarzt/ärztin der Neurologie vor Ort, die sich ausschließlich um die Patientinnen und Patienten der Stroke Unit kümmern. Auch die Neuroradiologen am Klinikum unter der Leitung von Dr. Andreas Mangold sind 24 Stunden täglich verfügbar. Muss notfallmäßig ein neurochirurgischer Eingriff erfolgen, sind auch stets Fachärzte für Neurochirurgie unter Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger in Rufbereitschaft.“
Das breite medizinische Angebot des Klinikums Traunstein ermöglicht auch eine weitergehende umfassende Behandlung der Patientinnen und Patienten, denn mit der Inneren Medizin, der Gefäßchirurgie sowie der Palliativmedizin können sämtliche Aspekte abgedeckt werden, die ursächlich für einen Schlaganfall sein können oder Auswirkung eines solchen sind.
Alle Behandlungs-Optionen verfügbar
Auch die gerätetechnische Ausstattung ist anspruchsvoll, wie Prof. Dr. Etgen ausführt: „Für eine sofortige Untersuchung stehen an der Traunsteiner Stroke Unit sowohl ein modernes CT mit CT-Angiographie und CT-Perfusion, eine Kernspintomographie als auch eine intraarterielle Substraktionsangiographie zur Verfügung. Die intravenöse Thrombolyse wird bei uns meist sofort nach dem CT gestartet. Bei Verschlüssen großer Blutgefäße erfolgt anschließend häufig die interventionelle Thrombektomie durch unsere Neuroradiologen. Natürlich werden auch an allen sechs verfügbaren Bettplätzen die Vitalwerte, wie Blutdruck, Herzfrequenz, 3-Kanal-EKG, Atmung und Sauerstoffsättigung erfasst, um die Patientinnen und Patienten zu jeder Zeit in bester Überwachung zu haben.“
Doch nicht nur die Untersuchung und sofortige Akutbehandlung, sondern auch Physiotherapie sowie Ergo- und Logotherapie stehen für die Patientinnen und Patienten bereit – und zwar nicht nur während der Woche, sondern auch an Wochenenden und Feiertagen. Dafür sorgen 19 Kolleginnen und Kollegen dieser therapeutischen Fachbereiche.
Bad Reichenhall ist mit eingebunden
Das Klinikum Traunstein verfügt zwischen München und Salzburg neben Rosenheim über die einzige „Überregionale Stroke Unit“, in der das komplette Spektrum der Schlaganfall-Behandlung rund um die Uhr vorgehalten wird. Davon profitieren auch die Bewohner angrenzender Landkreise, und hier besonders die Patientinnen und Patienten aus dem Berchtesgadener Land: Die telemedizinisch-vernetzte Stroke Unit der Kreisklinik Bad Reichenhall kooperiert sehr eng mit der im Klinikum Traunstein. Und mit dem Leitenden Arzt Dr. Markus Schwahn steht in der Kreisklinik Bad Reichenhall ein erfahrener Neurologe bereit.
Die erfolgreich bestandene Prüfung des Medizinischen Dienstes zeigt, dass sich die Menschen in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land bei Notfällen auf eine leistungsfähige Versorgung verlassen können.
Seit Anfang 2007 besteht in der Neurologischen Klinik des Klinikums Traunstein eine Schlaganfall-Einheit („Stroke Unit“) mit sechs Monitorbetten und entsprechend nachgeordneten Betten, die im Rahmen der Aufnahme des Klinikums Traunstein in das „Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung – TEMPiS" in der Region Süd-Ost-Bayern entstand. Das TEMPiS-Netzwerk wurde 2001 zur Verbesserung der Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Region gegründet.
22.12.2025 - Klinikum Traunstein
Böllern mit bösen Folgen
Erfahrene Handchirurgen warnen vor Verletzungen und geben wichtige Ratschläge, wenn was passiert
Alle Jahre wieder endet der Silvesterjubel für viele Menschen in der Notaufnahme: zerfetzte Finger, verbrannte Hände, verletzte Gesichter. Zwei erfahrene Mediziner – Prof. Dr. Afshin Rahmanian-Schwarz, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Zentrum für Handchirurgie an den Kliniken Südostbayern, und der Oberarzt Dr. Thomas Jan Riha, spezialisiert auf Handchirurgie, erklären im Interview, warum Feuerwerk so gefährlich ist, welche Fehler sich jedes Jahr wiederholen und was im Ernstfall wirklich zählt. Ein eindringlicher Appell an die Vernunft, damit der Jahreswechsel nicht im Krankenhaus beginnt. mehr...
Herr Prof. Dr. Rahmanian-Schwarz, Herr Dr. Riha, warum ist Silvester für Sie in der Klinik kein Fest, sondern ein Problem?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Weil der Jahreswechsel zuverlässig ein paar Dinge mit sich bringt: Glückwünsche, Feuerwerk – und Verletzte. Für viele Menschen gehört das Zünden von Böllern und Raketen zum Vergnügen. Aber jedes Jahr endet dieser Spaß für viele Menschen bei uns in der Notaufnahme, denn viele Menschen unterschützen die Gefahren.
Dr. Riha: Und wir sprechen nicht von Bagatellen. Häufig sind mehrere Finger betroffen, manchmal die ganze Hand. Eine Explosion wirkt eben nicht wie eine Kerzenflamme. Sie reißt Gewebe auseinander. Das verstehen viele erst, wenn sie uns gegenüber sitzen.
Warum unterschätzen Menschen die Risiken so sehr?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Weil sie sich nicht vorstellen können, was der Verlust eines Fingers bedeutet. Menschen führen Hunderte Handgriffe am Tag aus: knöpfen, schreiben, greifen, schneiden, heben. Fällt ein Finger aus, werden Routinen zur Herausforderung. Fällt eine ganze Hand aus, wird vieles unmöglich. Ich glaube, dieses Ausmaß ist den meisten nicht klar.
Was macht den Umgang mit Feuerwerkskörpern so gefährlich?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Unsachgemäßer Umgang ist das Hauptproblem. Dabei ist die Gebrauchsanweisung kein Schmuckwerk. Das sind Sicherheitsregeln, die immer wieder ignoriert werden: Feuerwerk sollte nur im Fachhandel gekauft werden und mit CE-Zeichen und BAM-Nummer versehen sein. Auch von selbst gebastelten oder manipulierten Feuerwerkskörpern sollte man unbedingt die Finger lassen.
Wichtig ist, Feuerwerk niemals am Körper zu tragen, sondern verschlossen und sicher zu lagern. Außerdem nichts zünden, was man in der Hand halten muss. Alkohol und Böller vertragen sich auch nicht gut, weil man unvorsichtig wird, wenn man etwas getrunken hat.
Sollte eine Rakete oder ein Böller nicht gezündet haben, darf er auf keinen Fall nochmals erneut angezündet, sondern muss eingesammelt und entsorgt werden, denn damit schützen Sie vor allem Kinder – und für die sollten Knaller sowieso tabu sein.
Dr. Riha: Hinzu kommt die fatale Fehleinschätzung: „Wird schon gutgehen.“ Aber ein minimaler Fehlgriff, ein Funkenflug – und die Sache wird im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Beim Lagern der Böller in den Jackentaschen beispielsweise reicht ein Funke, ein Schlag, selbst schon Reibung. Und wenn es dort explodiert, haben wir es nicht mit Verbrennung allein zu tun, sondern mit einem Explosionstrauma.
Was sollte man tun, wenn doch etwas Schlimmes geschieht?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Dann gilt: Sofort die 112 wählen und mit dem Rettungswagen direkt in die Notaufnahme am Klinikum Traunstein. Wir sind hier spezialisiert auf Handverletzungen, und bei Explosionstraumen zählt jede Minute. Es geht um Diagnose, operative Versorgung, und um die weitere Nachbehandlung. Wer denkt, eine schwere Verletzung könne man „erst einmal beobachten“, irrt sich gewaltig.
Dr. Riha: Bei Feuerwerksverletzungen kommt das Tückische hinzu: Es ist nicht nur eine Verbrennung, sondern eine Kombination aus Hitze, Explosion, Druckwelle. Das zerstört nicht nur Haut, sondern auch tieferliegendes Gewebe. Bis hin zum Abtrennen von Gliedmaßen.
Können Sie das medizinisch etwas einordnen?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Verbrennung ist nicht gleich Verbrennung. Ein Sonnenbrand ist meist eine oberflächliche Verbrennung ersten Grades: schmerzhaft, aber mit guter Heilung. Bei Grad 2b dagegen muss Gewebe oft ersetzt werden, weil die Schicht, aus der neue Zellen entstehen, zerstört ist. Grad 3 ist tief, großflächig, lebensgefährlich und nur mit hochspezialisierter Behandlung zu beherrschen.
Dr. Riha: Je größer die verbrannte Fläche und je schlechter der Allgemeinzustand des Patienten, desto schlechter die Prognose. Schock, Infektionen, Organversagen: All das droht. Deshalb ist die schnelle Versorgung so entscheidend.
Wann kommt plastische Chirurgie ins Spiel?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Bei schweren Brandverletzungen fast immer. Wenn die Haut sich nicht mehr regenerieren kann, brauchen wir Hauttransplantationen oder künstliche Haut. Und selbst nach der Abheilung brauchen viele Betroffene weitere Eingriffe, um Narben zu korrigieren oder Funktionen zu verbessern.
Dr. Riha: Gerade im Gesicht zählt jeder Millimeter. Da geht es neben Funktion auch um Ästhetik und Lebensqualität. Viele Patienten müssen sich über Monate durch Operationen und Therapien kämpfen, bis sie wieder in den Alltag zurück können.
Was sollten Ersthelfer tun, wenn es zu einem Unfall kommt?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Erstens: Löschen, falls Kleidung oder Körperteile brennen – am besten die Flammen mit einer Decke ersticken. Zweitens: Sofort den Notruf 112 absetzen. Drittens: Kühlen, aber richtig: zehn Minuten, kaltes Wasser, nicht eiskalt. Viertens: Kreislauf stabilisieren, denn Verbrennungen können Schock auslösen. Fünftens: Nichts Festgebranntes abreißen. Das gehört in professionelle Hände.
Dr. Riha: Ein häufiger Fehler ist, dass man den Verletzten in den eigenen Wagen packt und losfährt – ohne Notruf 112. Doch wir hier im Klinikum Traunstein müssen wissen, dass ein Notfall unterwegs ist. Außerdem können professionelle Sanitäter die Gefahren einfach besser einschätzen.
Viele glauben: Für Spezialbehandlung muss man weit fahren. Stimmt das?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Nein. Wir sind hier im Klinikum Traunstein bestens ausgestattet. Unsere Abteilung ist hoch spezialisiert: Rekonstruktive Chirurgie, ästhetische Chirurgie und Behandlung von Handverletzungen. Wir können alles abdecken, was nach einem Feuerwerksunfall notwendig ist. Und das ist wichtig: Denn die beste Versorgung nützt nur, wenn sie schnell erfolgt.
Wenn Sie einen Appell an Silvesterfeiernde richten wollen?
Prof. Rahmanian-Schwarz: Denken Sie vor dem Zünden daran, was Sie riskieren. Ein Knall ist schnell verpufft, aber der Verlust eines Fingers bleibt ein Leben lang.
Dr. Riha: Verantwortung heißt nicht nur, sich selbst zu schützen, sondern auch Kinder und Jugendliche. Blindgänger gehören entsorgt, nicht nochmal angezündet. Dann kommt man mit zwei gesunden Händen ins Neue Jahr und kann auch mit den Mitfeiernden anstoßen.
22.12.2025 - Kreisklinik Trostberg
Kollegiale Dreifach-Leitung für Innere Medizin
Ein eingespieltes Team übernimmt die Verantwortung

Die Kreisklinik Trostberg richtet den Fachbereich Innere Medizin strategisch neu aus und führt künftig ein kollegiales Leitungsmodell ein. Die Verantwortung für den Fachbereich liegt ab sofort in den Händen eines erfahrenen Teams aus drei leitenden Ärztinnen und Ärzten, das unterschiedliche Schwerpunkte der Inneren Medizin vereint und damit eine moderne, patientenorientierte Versorgung weiter ausbaut. mehr...
Das neue Leitungstrio setzt sich zusammen aus:
Dr. Marianne Gerusel-Bleck, als Leitende Ärztin verantwortlich für die Akutgeriatrie
Hubert Pilgram, Leiter der Zentralen Notaufnahme
Dr. Björn Lewerenz, zuständig für die Gastroenterologie, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Chefarztposition am Klinikum Traunstein übernimmt
Mit dem neuen Modell bündelt die Kreisklinik Trostberg umfassende Expertise aus drei zentralen Bereichen der Inneren Medizin. Die Verantwortlichen erwarten sich davon eine noch engere interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine höhere Versorgungsqualität und eine nachhaltige Weiterentwicklung der medizinischen Angebote.
„Wir freuen uns sehr über den Start des neuen kollegialen Leitungssystems. Dadurch können wir die Stärken der jeweiligen Fachbereiche noch besser miteinander verknüpfen und unseren Patientinnen und Patienten eine Versorgung auf höchstem internistischen Niveau bieten“, betont Klinikleiterin Petra Kalina.
Die gemeinsame Führung ermöglicht es zudem, medizinische Entscheidungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Ressourcen optimal zu nutzen und flexibel auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren. Die Kreisklinik Trostberg stärkt damit gezielt ihre Rolle als wichtiger Gesundheitsversorger im nördlichen Landkreis Traunstein und setzt ein Zeichen für moderne, teamorientierte Führungsstrukturen im Klinikbereich.
19.12.2025 - Klinikum Traunstein
Die goldenen ersten Minuten des Lebens
Klinikum Traunstein führt neues besonders schonendes Verfahren zur Versorgung von Neugeborenen ein
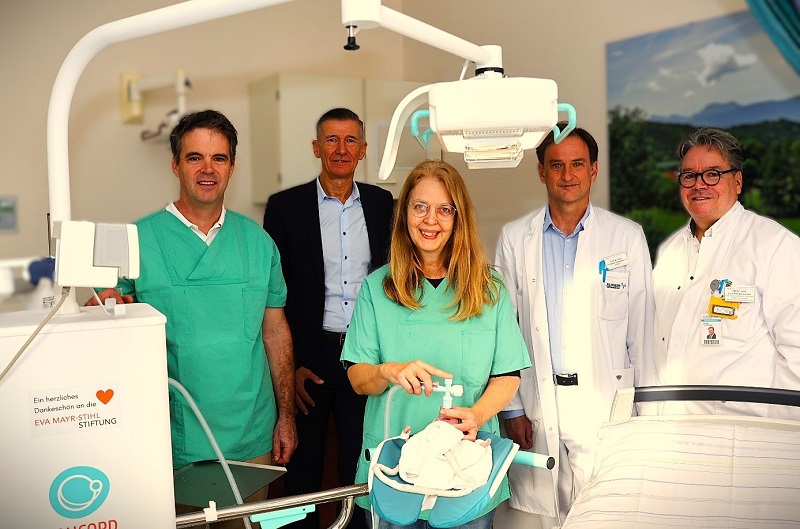
Das Klinikum Traunstein hat ein neues und besonders behutsames Verfahren für die ersten Minuten nach einer Geburt eingeführt. „Das Ziel ist, den Start ins Leben für Neugeborene, ganz besonders für Frühchen und Kinder mit erhöhtem Risiko noch sicherer und natürlicher zu gestalten,“ so Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Südostbayern. Insgesamt 89 Mitarbeitende aus der Geburtshilfe, der Kinderintensivstation und des Operationsbereichs wurden dafür umfassend in das sogenannte Concord Birth Flow Verfahren eingearbeitet. „Damit ist das interdisziplinäre Team gut darauf vorbereitet, die goldenen ersten Minuten des Lebens besonders sanft zu gestalten“, so Dr. Gretscher. mehr...
„Die Neonatologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und dabei sind die ersten Minuten nach der Geburt immer mehr in den Fokus gerückt. Sie gelten als eine äußerst empfindliche Phase,“ erklärt Prof. Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein. Sein Kollege Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, fügt hinzu, was in dieser Zeit genau passiert: „Vor der Geburt funktioniert der Kreislauf eines Kindes grundlegend anders als danach. Im Mutterleib sind die Lungen noch mit Flüssigkeit gefüllt und nicht an der Atmung beteiligt. Die Versorgung übernimmt vollständig die Plazenta, wodurch das Blut über spezielle Umgehungswege am Lungenkreislauf vorbeigeleitet wird. Mit den ersten Atemzügen nach der Geburt senkt sich der Widerstand in den Lungen, das Blut fließt nun dorthin und der Kreislauf stellt sich auf die eigenständige Sauerstoffaufnahme um. Dieser Übergang markiert den Wechsel von der plazentaren zur eigenen Atmung.“
Das neue Verfahren am Klinikum Traunstein unterstützt diese Umstellung besonders sanft. Das Kind bleibt zunächst noch über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden, während es die ersten eigenen Atemzüge macht. Dadurch wird der Übergang weniger abrupt, und das Neugeborene kann sich schrittweise an die neue Situation anpassen. „Wissenschaftliche Erkenntnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Übergang stabiler und stressärmer gelingt, wenn die Verbindung zur Plazenta nicht sofort getrennt wird, sondern noch etwas bestehen bleiben darf,“ so die Oberärztin der Neonatologie, Dr. Virginia Toth.
Dieses Vorgehen ist ganz besonders wichtig für Frühgeborene und Kinder mit erhöhtem Risiko. Jedoch können auch reife Neugeborene erheblich davon profitieren. Eingesetzt wird dafür ein spezieller Versorgungstisch, der Concord Birth Trolley. Dieser kann in der Höhe verstellt und zur Mutter hingeschwenkt werden, sodass das Kind in unmittelbarer Nähe bleibt. Eine passende Aussparung ermöglicht, dass die Nabelschnur dabei nicht unter Spannung gerät. Gleichzeitig sind alle Gerätschaften, die für die Erstversorgung von Risikogeburten gebraucht werden, in greifbarer Nähe montiert. Der Trolley kann sowohl im Geburtsraum als auch bei Kaiserschnitten genutzt werden Die Gerätschaften für das sanfte Verfahren konnten dank einer Förderung der Eva Mayr-Stihl Stiftung beschafft werden. Die Stiftung engagiert sich seit dem Jahr 2018 immer wieder mit großzügigen Unterstützungen für innovative Projekte am Klinikum Traunstein.
Mit der sorgsamen Schulung und der präzisen Festlegung und Abstimmung der Prozesse schafft das Klinikum Traunstein eine verlässliche Grundlage für eine moderne, äußerst sichere und gleichzeitig besonders sanfte Form der Geburtshilfe. Für Eltern bedeutet dies: Ihr Kind erhält in den ersten, besonders wichtigen Minuten des Lebens die bestmögliche Unterstützung, behutsam, sicher und nach dem neuesten Stand des Wissens. Eine Reihe von Neugeborenen durften schon davon profitieren und ganz in Ruhe das Licht der Welt erblicken.
19.12.2025 - Kreisklinik Trostberg
Abschied eines überzeugten Pragmatikers
Prof. Dr. Thomas Glück, Chefarzt der Inneren Medizin an der Kreisklinik Trostberg, geht in den Ruhestand

Nach fast zwanzig Jahren an der Spitze der Inneren Abteilung und der Klinischen Infektiologie an der Kreisklinik Trostberg verabschiedet sich Prof. Dr. Thomas Glück, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Rheumatologie, Infektiologie / Zusatzbezeichnung Internistische Intensivmedizin, zum 1. Januar 2026 in den Ruhestand. Mit ruhiger Hand, klarem Kompass und einem stets offenen Ohr für sein Team hat er die Innere Medizin der Kreisklinik Trostberg geprägt. mehr...
Wenn Prof. Dr. Glück über seine Zeit als Chefarzt spricht, dann klingt das nicht nach Pathos, sondern nach Bodenhaftung. „Mir war wichtig, Freiräume zu ermöglichen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Vorstellungen und Ideen gemeinsam vorangebracht werden konnten“, sagt er. Keine Selbstinszenierung, kein großes Wort – sondern das Selbstverständnis eines Arztes, der Teamarbeit als grundlegende Haltung begreift.
Zwei Jahrzehnte Innere Medizin mit Weitblick
Als Prof. Dr. Glück am 1. März 2006 die Leitung der Inneren Medizin an der Kreisklinik Trostberg übernahm, war die Abteilung schon ein wichtiger Baustein im Rahmen der Kliniken Südostbayern (KSOB). Unter seiner Leitung formte er mit seinem Team aus Oberärztinnen und Oberärzten einen Fachbereich, der nahezu alle Schwerpunkte der Inneren Medizin abdeckte: Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie, Pneumologie, Onkologie, Notfallmedizin, klinische Akut- und Notfallmedizin, Rheumatologie und Infektiologie. „Wir konnten eine umfassende Versorgung der Bevölkerung des nördlichen Landkreises Traunstein sicherstellen – auch in den Spezialgebieten“, resümiert er nüchtern. Nüchtern, aber stolz. Denn die Breite und Tiefe, die seine Abteilung erreichte, war alles andere als selbstverständlich. Prof. Dr. Glück setzte seine Idee der „umfassenden Inneren Medizin“ um – und machte sie zum Erfolgsmodell.
Übergabe des Staffelstabs erfolgt mit System
Der Wechsel in der Leitung der Abteilung zum Jahresbeginn 2026 ist mehr als ein Personalwechsel – es ist ein Systemwechsel. „Die Abteilung wird künftig in einem Kollegialsystem geführt“, erklärt Dr. Stefan Paech, Medizinischer Direktor an den KSOB. „Langjährig erfahrene Medizinerinnen und Mediziner aus der Kreisklinik Trostberg übernehmen gemeinsam die Führung.“ Auch das eine Leistung von Prof. Dr. Glück!
„Das ist Kontinuität im eigenen Haus“, betont KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. „Und der Wechsel geht ganz im Stil von Prof. Dr. Glück vonstatten: Sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst ist kein Bruch, sondern ein Übergang mit Haltung.“ Für den scheidenden Chefarzt ist das keine Frage der Eitelkeit. „Ich habe mich immer als Teil eines Teams verstanden. Wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen, die praktisch alle ihre internistische Aus- und Weiterbildung in Trostberg absolviert haben, die Abteilung übernehmen, dann ist das der schönste Beweis dafür, dass etwas gewachsen ist“, sagt Prof. Dr. Glück – und lächelt dabei wie jemand, der weiß, dass seine Arbeit Früchte getragen hat.
Architekt der Infektiologie
Prof. Dr. Glück leitete ab Juni 2008 auch die Abteilung für Klinische Infektiologie – eine Stabsabteilung, die alle Bereiche des KSOB-Verbundes berührt. Damit schrieb er Krankenhausgeschichte: Eine eigenständige Infektiologie an einer nicht-universitären Klinikgruppe war damals wie auch heute eine Rarität. „Das war Pionierarbeit“, würdigt Dr. Paech diese Leistung. „Was heute ein wichtiger und selbstverständlicher Teil der KSOB ist, hat Prof. Dr. Glück aufgebaut – mit wissenschaftlicher Sorgfalt und tiefgreifender praktischer Erfahrung.“
Und eben diese Klinische Infektiologie stand in den letzten Jahren im Brennpunkt der Krisenmedizin: durch die COVID-19 Pandemie. Dr. Gretscher weiß noch: „Mit Prof. Dr. Glück hatten wir in dieser sehr herausfordernden Phase einen ausgewiesenen Fachmann im Bereich der Infektiologie in unserem Verbund. In der Zeit der größten Unsicherheit war er für uns alle ein Anker. Mit seiner Expertise, seinem professionellen Vorgehen und seinen stets prägnanten und klar verständlichen Informationen hat er wesentlich und federführend dazu beigetragen, dass wir als Verbund sicher und zielgerichtet durch die Pandemie steuern konnten. Seine Einschätzungen waren kristallklar, seine Vorhersagen treffsicher – und sein besonnener Rat für uns von unschätzbarem Wert.“
Prof. Dr. Glück erinnert sich ebenfalls gut: „Wir waren von Anfang an gefordert. Unsere ersten Patienten war eine Familie mit drei kleinen Kindern – eine der ersten COVID-Fälle in Deutschland, deren Betreuung glücklicherweise unkompliziert verlief.“ Mit kühlem Kopf und klaren Strukturen führte er Team und Patienten durch die Pandemie – unterstützt von Oberärztin Dr. Bianca Vogel und Oberarzt Dr. Jan Ramming, die wesentliche Strukturen für die Infektiologie an den KSOB mit vorangetrieben haben und die er beide ausdrücklich in den Vordergrund stellt: „Ohne sie und ohne eine perfekte Teamleistung wäre das nicht möglich gewesen.“ Unter seiner Leitung entstand auch ein Netzwerk, das Infektiologie, Klinikhygiene, Mikrobiologie und Gesundheitsamt eng verzahnte. Programme wie das Antibiotic Stewardship, also der verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika, hat das Team der Infektiologie etabliert und vorangebracht. Auch diese Arbeit wird nahtlos fortgesetzt werden, denn die Leitung der Abteilung für Klinische Infektiologie wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Bianca Vogel übergehen, während Dr. Paech als Medizinischer Direktor die strategische Verantwortung für diesen Bereich übernimmt.
Führung mit leiser Autorität
Wer Prof. Dr. Glück kennt, weiß: Er war und ist kein Mann der großen Bühne. Eher einer, der Türen öffnete. „Er hat geführt ohne viel Druck und Direktion, sondern durch persönliches Vorleben und Vorbild sein“, erklärt Dr. Gretscher. „Er hat Vertrauen geschenkt und dadurch Leistung möglich gemacht.“ Genau das, sagt Prof. Dr. Glück rückblickend, sei sein eigentliches Vermächtnis. „Errungenschaften und Leistungen in der Medizin sind nie das Werk eines Einzelnen“, betont er. „Sie entstehen, wenn Menschen miteinander arbeiten und ein gemeinsames Ziel haben.“
Mit dem Abschied von Prof. Dr. Thomas Glück geht eine Ära zu Ende – aber es geht kein Grundsatz verloren. Seine Idee von Medizin als Teamleistung, seine Gelassenheit in schwierigen Situationen und seine stille Autorität haben nachhaltige Spuren hinterlassen. „Ich gehe mit Dankbarkeit und weiß die Abteilung Innere Medizin in guten Händen“, sagt er zum Schluss. Und man glaubt ihm jedes Wort.
I
16.12.2025 - Klinikum Traunstein
„Du hast deine Niere noch“
Eine Patientengeschichte über eine Diagnose, die das ganze Leben infrage stellt.
Als Hans S. zum ersten Mal hört, dass er nur eine Niere besitzt, ist er bereits Mitte vierzig. „Ich habe das nie gemerkt“, sagt er rückblickend. „Der Befund fiel zufällig bei einem Routine-Ultraschall beim Hausarzt auf. Der Arzt damals hat plötzlich gefragt: ‚Wo ist denn Ihre andere Niere?‘ Ich wusste gar nicht, was er meint.“ Bis dahin hatte Hans S. ein vollkommen normales und sehr sportliches Leben geführt: Mountainbike-Rennen, Skibergsteigen, Aktivurlaube – ohne je Einschränkungen zu spüren. Was damals wie eine Randnotiz seines Gesundheitszustands scheint, sollte viele Jahre später eine dramatische Bedeutung bekommen. mehr...
Ein vermeintlicher Hexenschuss
Im Juni 2024 fährt Hans mit seiner Frau und dem siebenjährigen Sohn für eine Woche in ein Kinderhotel. Ein unbeschwerter Familienurlaub, geprägt von Bewegung und Leichtigkeit. Beim Trampolinspringen spürt er plötzlich einen stechenden Schmerz im Rücken. „Ich dachte: Das ist bloß ein Hexenschuss, nichts Dramatisches.“ Eine Schmerztablette und weiter geht’s. Doch zu Hause werden die Schmerzen nicht besser. Dann kommt ein pelziges Gefühl im linken Bein hinzu, als das Kribbeln anhält, geht Hans S. zum Hausarzt.
„Danach ging alles ganz schnell“, erinnert er sich. Ein MRT wird angeordnet, und noch bevor er nach dem Termin wieder zuhause ankommt, erhält er einen Anruf aus der Hausarztpraxis: „Sie müssen sofort nochmal zu uns in die Praxis kommen.“ Dort bringt ein erneuter Ultraschall ans Licht, was sein Leben von einem Moment auf den anderen verändern sollte: „Wir haben einen Tumor entdeckt.“
In diesem Augenblick, erzählt Hans S., sei alles andere nebensächlich geworden: „Die Beschwerden im Bein waren plötzlich komplett egal und die sind dann auch von allein verschwunden.“
Die Angst, die einzige Niere zu verlieren
Hans S. spricht offen darüber, wie hart ihn die Diagnose getroffen hat. „Ab da ist es dann ernst geworden“, sagt er. „Ich habe ein paar Nächte kaum geschlafen. Die Angst war riesig, dass ich diese eine Niere verlieren könnte.“ Nur eine Niere zu haben war zuvor kaum relevant gewesen – jetzt bestimmt dieser Umstand seine größten Sorgen.
Von der urologischen Praxis in Traunstein, in der Hans S. sowieso gerade einen Termin hat, wird noch für denselben Tag ein CT organisiert, als er dem Arzt die Diagnose mitteilt. Anfang August folgen die Voruntersuchungen im Klinikum Traunstein, schon am 14. August 2024 erfolgt die Operation durch Prof. Dr. Dirk Zaak, Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Traunstein und Leiter des Nieren-, Hoden- und Prostatakrebszentrums. Zwischen erster Diagnose und OP liegen nur sechs Wochen, aber sechs Wochen voller Unsicherheit, Warten, Hoffen und Bangen.
Hans’ Frau beschreibt diese Phase so: „Wir haben versucht, positiv zu bleiben. Aber die Angst war immer da.“
Direkt nach der Operation sitzt sie an seinem Bett. Und beim Aufwachen hört Hans S. ihre erlösenden ersten Worte: „Du hast deine Niere noch.“ Ein Satz, der ihn auch jetzt noch tief berührt. „Das war der wichtigste Moment. Da fiel die ganze Anspannung der vergangenen Wochen von mir ab.“
Prof. Dr. Zaak und Dr. Simon Müller, Oberarzt der Urologie und Koordinator des Uro-onkologischen Zentrums, beschreiben die sehr komplexe Operation: „Herr S. kam mit einer besonderen Ausgangslage – er besaß nur eine Niere und in der befand sich ein relativ großer (4 x 5 cm) Tumor. Die Schwierigkeit einer solchen Operation ist es, den Tumor komplett zu entfernen und gleichzeitig das Maximale an gesundem Nierengewebe zu erhalten. Gelingt dies nicht, bleibt entweder Tumorgewebe zurück oder aber der Patient wird aufgrund der Einzelniere möglicherweise dialysepflichtig. Erfreulicherweise hatte uns die Computertomographie vor der Operation gezeigt, dass eine Teilentfernung möglich war. Und es hat geklappt. Es gibt allerdings auch Fälle, wo wir bereits im Vorfeld wissen, dass dies aufgrund der Gegebenheiten einfach nicht umsetzbar ist.“
Die schwere Zeit im Krankenhaus
Hans S. bleibt sechs Wochen im Klinikum Traunstein und die Operation ist nicht das Ende der Herausforderungen: „Die Niere ist beleidigt, sagten die Ärzte zu mir.“ Prof. Dr. Zaak erklärt es fachlich korrekt: „Nach einer solch komplexen Tumoroperation kann es zu Funktionsstörungen kommen. Bei Herrn S. führte dies innerhalb der ersten zwei Wochen zu einer akuten Einschränkung der Nierenfunktion.“ Die Blutwerte sind schlecht, Hans S. lagert große Mengen Wasser ein. Hans erinnert sich genau: „Ich hatte so viel Wasser im Körper, ich habe mich kaum wiedererkannt.“ Die Nephrologen im Klinikum, die ebenfalls mit dem Fall von Hans S. vertraut sind, beruhigen ihn: „Die Nierenfunktion wird sich wieder bessern. Wir müssen da abwarten.“ Und tatsächlich: vier weitere Wochen dauert es, bis die Niere wieder vollständig arbeitet – dann aber „von einer Woche auf die andere“, wie Hans S. es beschreibt.
Komplizierend kommt noch hinzu, dass sich aus der inneren Naht in der Niere eine Undichtigkeit bildet, aus der Urin austritt. „So etwas kann bei derart komplizierten Operationen vorkommen. In solchen Fällen versuchen wir die Undichtigkeit mit speziellen Drainagen abzudichten, damit diese sich wieder von allein schließt. Wie auch bei Herrn S.“, so Dr. Müller.
Halt, Zuspruch, Unterstützung
Mit besonderer Dankbarkeit spricht Hans S. über einen weiteren wichtigen Ankerpunkt während der schweren Wochen im Krankenhaus: „Das gesamte Team der Station 2.1 im Klinikum war unglaublich, sie alle haben mir Mut gegeben, mich aufgebaut, sich um mich gekümmert. Ohne dieses Team wäre ich heute nicht da, wo ich bin.“ Dort lernt Hans S., geduldig zu sein, aber auch aktiv mitzuwirken. „Schon im Krankenhaus bin ich jeden Tag raus, habe mich bewegt. Man muss selbst was zur Heilung beitragen, muss positiv bleiben und an sich arbeiten.“
Eine erneute Operation wäre laut Prof. Dr. Zaak auch kaum möglich gewesen: „Die postoperative Phase war schon kompliziert, aber sein körperlicher Zustand und seine aktive Mitarbeit haben viel zur Genesung beigetragen. Erfreulicherweise konnten wir die Undichtigkeit im Bereich der Niere ohne einen erneuten großen Eingriff beheben. Ein solcher hätte das extrem hohe Risiko beinhaltet, die Niere komplett entfernen zu müssen. Und das hätte definitiv die Dialysepflicht für den Patienten bedeutet.“
Ein neuer Schrecken: Verdacht auf Knochenmarkserkrankung
Im Oktober 2025, etwas mehr als ein Jahr nach der OP, dann ein neuer Schock: Bei einer Routine-Blutkontrolle beim Hausarzt zeigt ein Wert Auffälligkeiten. Wieder eine Überweisung in die Klinik, diesmal jedoch in die Onkologie: Eine Knochenmarksbiopsie folgt im November. „Wieder dieses Warten“, sagt Hans S. „Wieder die Angst: Hoffentlich fehlt nix.“ Am 2. Dezember 2025 dann die erlösende Nachricht: Der Befund ist unauffällig. Keine Leukämie, keine pathologischen Veränderungen. „Da fällt dir ein Stein vom Herzen, das kann man gar nicht beschreiben.“
Ein anderer Blick aufs Leben
Heute, rund 16 Monate nach der Operation, hat Hans S. sich verändert – auf eine leise, aber tiefgreifende Weise. „Die beste Reha war zuhause, bei meiner Frau und meinem Sohn. Und man sieht das Leben scho a bissl anders“, sagt er im Dialekt. „Man wird nachdenklicher. Aber ich lebe mein Leben.“ Sport bleibt sein Ausgleich: Mountainbiken, Bewegung in der Natur, das Gefühl von Freiheit. „Da kann ich der Seele Luft geben.“ Doch definitiv an erster Stelle steht seine Familie.
Sein Sohn wird bald acht und ihn beschreibt Hans auch als seinen inneren Antrieb, wieder gesund zu werden: „Da hat man eine Aufgabe. Da kann man nicht einfach aufgeben. Das gibt Halt und Motivation.“ Auch seine Frau beschreibt diese Zeit als gemeinsame Wegstrecke: „Wir sind da zusammen durch. Und wir wissen jetzt noch mehr, was wirklich zählt.“
Wie es weitergeht
Hans S. ist nun in der erweiterten Überwachung. Prof. Dr. Zaak erläutert die Vorgehensweise: „Alle drei Monate wird die Niere kontrolliert, zusätzlich prüfen wir regelmäßig die Blutwerte und überwachen das Geschehen haargenau mit bildgebender Diagnostik. Die regelmäßige Nachsorge ist essenziell und wird auch künftig sehr engmaschig fortgeführt.“ Und er gibt einen beruhigenden Ausblick: „Aus heutiger Sicht zeigt die Niere stabile Werte und wir haben bislang keinen Anhalt dafür, dass die Krebserkrankung wieder ‘zurückgekommen‘ ist. Wir sind da sehr optimistisch.“
Hans S. weiß heute: Nur weil er sich beim Trampolinspringen vermeintlich verletzt hat, wurde der Tumor entdeckt. „Ohne die Schmerzen wäre ich nie zum Arzt gegangen“, sagt er. „Dann wäre alles vielleicht zu spät gewesen.“ Deshalb ist es ihm wichtig, auch weiterhin regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Und er blickt nach vorne: „Ich mache das, was mir gut tut. Und ich freue mich, dass ich gebraucht werde. Das macht mein Leben lebenswert.“
15.12.2025 - Fachklinik Berchtesgaden
Festliche Klänge und kleine Engel
Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden bringt Wärme in die Klinikflure
Die Weihnachtszeit gilt als Phase der Besinnung, der Freude und des gemeinsamen Feierns. Für Menschen, die diese Tage im Krankenhaus verbringen, ist sie jedoch oft geprägt von Sorgen, Einsamkeit und dem Gefühl, ein Stück Normalität zu vermissen. Umso bedeutungsvoller ist die jährliche Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden, die den Patientinnen und Patienten seit über zwanzig Jahren ein wenig Wärme und Hoffnung schenkt. mehr...
Schon Wochen zuvor beginnen die Freunde der Fachklinik e.V. und die Teams um Chefärztin Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger mit den Vorbereitungen. Mit funkelnden Lichtern, geschmückten Weihnachtsbäumen und festlichen Kränzen verwandeln sie die Stationen in einen Ort, der an die vertraute Weihnachtsatmosphäre erinnert. Für die Patientinnen und Patienten ist dies ein sichtbares Zeichen: Sie sind in dieser besonderen Zeit nicht allein und werden nicht vergessen.
Am vergangenen Mittwoch war es wieder so weit: Die Mitglieder des Fördervereins unter Vorsitz von Dr. Ursula Reichelt machten sich gemeinsam mit dem Chor der Musikschule unter Leitung von Christa Hemetsberger, drei kleinen Engeln, den Bürgermeistern und stellvertretenden Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, Geistlichen, KSOB-Vorstand Philipp Hämmerle, Pflegedirektor Eugen Siegle sowie Chefärztin Dr. Zenker-Wendlinger und dem Ärzteteam der Fachklinik Berchtesgaden auf den Weg durch die Klinikflure. Mit viel Empathie, einem offenen Ohr und herzlichen Worten besuchten sie die Patientinnen und Patienten in deren Zimmern und Aufenthaltsräumen.
Ein besonderer Höhepunkt für viele Patientinnen und Patienten waren die drei Engel, die eine liebevolle Karte und ein Stück „Berchtesgadener War“ als Geschenk überreichten – ein Moment, der zeigt, wie wertvoll kleine Gesten sein können. Begleitet wurde die Visite von traditionellen Weihnachtsliedern, gesungen vom Chor, deren Klänge Erinnerungen an vergangene Feste wachriefen und eine beruhigende, festliche Atmosphäre verbreiteten.
So bleibt die Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden ein seit mehr als zwei Jahrzehnte fest verankertes Symbol für Wärme und Mitmenschlichkeit. Sie bringt Licht in die Flure, Musik in die Herzen und ein Gefühl der Verbundenheit zu jenen, die es in dieser Zeit am meisten brauchen.
06.12.2025 Klinikum Traunstein
Jedes Gramm zählt für kleine Wunder
Eine Geschichte über die Geburt zweier Frühchen am Klinikum Traunstein
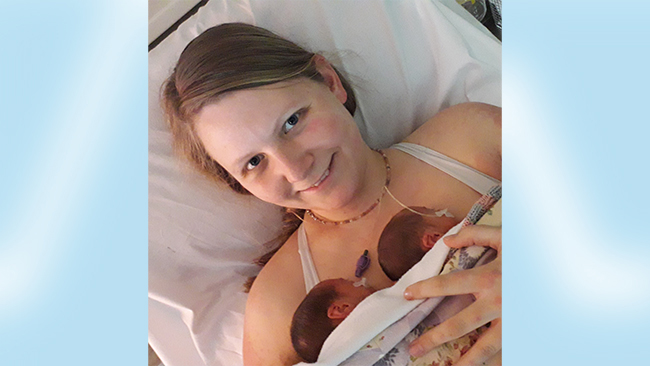
Draußen fällt Schnee in der Nacht des 18. Januar 2021 Es geht ein starker Wind, der den frischen Schnee verweht und die Straßen glatt und rutschig macht. Drinnen schlafen die schwangere Veronika Stampfl und ihr Mann Johannes friedlich. Sohn Georg, damals zwei Jahre alt, liegt mit im elterlichen Bett. Dann, aus dem Nichts, der Blasensprung. „Ich hab’ sofort gewusst, jetzt ist alles anders,“ erinnert sie sich. Die ausgebildete Hebamme weiß genau, was das bedeutet: Sie ist mit ihren Zwillingen in der 29. Schwangerschaftswoche. Es ist zu früh für die Geburt. Viel zu früh. mehr...
Von der Zuwendung zu Mutter und Kindern in der Neonatologie
„Es gab keinerlei Hinweise auf einen Blasensprung. Mein nächster Gedanke war: Wie soll ich das alles schaffen? Ich wusste: Ich muss in die Klinik und dort vielleicht für einige Wochen bleiben. Und ich kann meinen Sohn nicht sehen – kein Besuch wegen COVID-19.“ Die damals 29-Jährige steht leise auf und geht ins Wohnzimmer, um Georg nicht aufzuwecken. „Er hätte das alles nicht verstanden und wäre nur ängstlich geworden. Mein Mann hat derweil alles organisiert, hat den Sanka angerufen und den Opa mobilisiert, damit der sich um den Georg kümmert. Dann kam der Sanka im Schneesturm, die Besatzung kümmert sich rührend um sie. Angekommen in der Frauenklinik am Klinikum Traunstein, wird sie sofort untersucht. Ihr Mann Johannes fährt wieder nach Hause, nachdem klar ist, dass die Entbindung nicht sofort sein wird. Es gibt ja auch noch den kleinen Georg.
Zwischen Angst und Vertrauen
Die Oberärztin der Gynäkologie, Angelika Bertges, kümmert sich um Veronika, ebenso wie die Hebammen. „Da bin ich gedanklich dann von der leidenschaftlichen Hebamme aus Berufung zur werdenden Mutter geworden, die Angst hat um ihre ungeborenen Kinder und Angst vor dem, was kommt. Da hilft ihr die Zuwendung: „Die Hebammen und Ärztinnen haben sich um Körper und Seele zugleich gekümmert. Sie haben mich getragen. Ich war nicht nur Patientin – ich war Mensch.“ Veronika bekommt im Laufe des nächsten Tages Wehenhemmer und Medikamente für die Lungenreifung. Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, erklärt: „Für uns ist wichtig, die Kinder so lange wie möglich im Bauch der Mutter zu halten. Da zählt jeder Tag. Jeder einzelne.“ Veronikas Gedanken drehen sich um Laborwerte und Herztöne, um Hoffen und Warten: „Ich wollte, dass die Kinder so lange wie möglich drinnen bleiben. Aber ich wusste: Dann sehe ich meinen Sohn Georg so lange nicht. Das war das Schlimmste.“
Mit ihr im Zimmer liegt eine andere werdende Zwillingsmama. Sie ist schon drei Wochen im Klinikum, ist schwanger mit zwei Buben. In den Gesprächen finden sie heraus, dass sie sich dieselben Jungennamen ausgesucht haben, wenn es den Jungen werden sollten (Veronika hatte sich bisher das Geschlecht ihrer Kinder nicht sagen lassen): „Mit dieser Frau bin ich bis heute befreundet.“ Später weiß Veronika dann: Es werden zwei Mädchen: Helene und Marlena.
Vier Tage nach ihrer Ankunft in der Klinik ist Schluss mit Warten: Trotz aller Medikamente müssen die Kinder jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Veronika erinnert sich: „Ich hab‘ geweint, weil ich wusste: Sie kommen jetzt und irgendwie war ich nicht bereit.“ Prof. Dr. Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein, erklärt: „In diesem Moment ist die enge Zusammenarbeit zwischen Geburtshilfe und Neugeborenen-Intensivmedizin entscheidend. Unser Team ist bei jeder Frühgeburt im Kreißsaal, um die Kinder sofort optimal zu versorgen. Durch die räumliche Nähe können wir rund um die Uhr sofort reagieren, ohne Transportwege und ohne Zeitverlust.“ Dr. Virginia Toth, Oberärztin der Kinder- und Jugendmedizin, begleitet Veronika daher eng und bespricht alles im Detail mit ihr, um ihr Sicherheit zu geben: „Wenn es der Mutter gut geht, profitieren auch die Kinder.“ Dr. Toth wird zur wichtigen Bezugsperson für Veronika: „Ich hatte vom ersten Wort an Vertrauen in sie, denn in diesen vier Tagen hatte ich viel Angst und ich wollte wissen, was mit mir und meinen Babys passiert.“
Zwei winzige Wunder
Am 22. Januar, am Anfang der 30. Schwangerschaftswoche, kommen Helene mit 990 Gramm in Normallage und Marlena mit 1.180 Gramm in Beckenendlage zur Welt. Danach ein inniger Moment: „Helene war schon auf dem Weg in die Kinderintensivstation. Marlena kam gerade aus dem OP mit mir. Sie haben es möglich gemacht, dass auf dem Gang das Bett und der Inkubator zusammengeschoben wurde und ich hineinlangen konnte. Das war für mich sehr wertvoll, dass das möglich gemacht wurde. Ich habe damit einen sehr, sehr wichtigen Moment erlebt und nochmal einen Teil der Geburt gespürt. Ich hab auch versucht, so früh wie möglich nach dem Kaiserschnitt zu den Kindern zu kommen, auch wenn das nicht ganz einfach für mich war. Betonen möchte ich, dass sich alle auch um mich sehr gut gekümmert haben und der psychologische Dienst jeden Tag bei mir war.“ Sie selbst geht auf eigenen Wunsch bereits zwei Tage nach der Entbindung nach Hause und kommt danach jeden Tag von zuhause in die Klinik zu ihren Töchtern.
Prof. Dr. Wolf erklärt, warum die Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein in solchen Fällen so wichtig ist: „Als einziges Perinatalzentrum Level I für die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf gewährleisten wir die höchste Versorgungstufe für Risikoschwangerschaften und Frühgeborene in der Region. Die Neonatologie Traunstein ist geprüft vom Medizinischen Dienst Bayern und erfüllt alle Vorgaben der Qualitätsrichtlinie für Früh- und Reifgeborene. In unserer Level 1-Neonatologie verfügen wir über eine Infrastruktur, welche in der Region einzigartig ist: Kinderärzte mit der Qualifikation Neonatologie, spezialisierte Kinderkrankenpflege, Kinderkardiologie und Kinderchirurgie, Kinderanästhesie sowie eine spezialisierte Bildgebung mit Ultraschall und MRT sind rund um die Uhr verfügbar.“
Ines Pato, die stellvertretende Stationsleiterin der Kinder-Intensivstation, ergänzt: „Außerdem streben wir eine entwicklungsfördernde und familienzentrierte Pflege an. Wichtig ist hier das so genannte „Känguruhen“, bei dem die Kinder direkt auf der Brust liegen. Damit Eltern und Kinder genug Zeit haben, legen wir großen Wert auf das Einhalten der Ruhezeiten für die Kinder, eine gekoppelte Versorgung, das Minimieren der medizinischen Maßnahmen, der Geräusche und unangenehmer Reize. Es gibt sozialmedizinische und psychologische Angebote und regelmäßige Physiotherapie. Worauf ich mich auch persönlich sehr freue, ist, dass wir in unserem Neubau bald auch die Möglichkeit eines 24h-Rooming-in Angebots für die Eltern haben.“
Veronika Stampfl kann das Alles aus eigener Erfahrung bestätigen: „Ein Highlight und für mich unvergesslich, waren die „Känguruhen-Zeiten“: Ich war vorher und nachher nie so sehr im Moment im meinem Leben – Zeit und Raum sind weg – als dann, wenn meine Kinder auf meiner Brust lagen, das Gefühl hat sich quasi in mir eingebrannt. Darauf haben auch die Mitarbeiterinnen Rücksicht genommen: ‚Ach, ihr känguruht gerade, da wollen wir nicht stören‘.“ Auch an die allerersten Tage und einen Schlüsselmoment kann sich Veronika erinnern: „Die ersten 6 Tage war jede meiner Töchter in ihrem eigenen Inkubator, dann wurden sie zusammen in einen gelegt. Das war wirklich vorbildlich von der Klinik. Die beiden haben direkt die Nähe der Schwester gespürt. Ab wann ich zuversichtlich geworden bin, war, als Helene im Inkubator eine Kuschelente, die an ihre Füße gelegt worden war, zur Seite getreten hat. Da wusste ich sofort, wenn sie das schafft, dann schaffen wir alles Weitere auch.“ Den beiden Kindern geht es gut und sie machen große Fortschritte. Schon Ende der eigentlich 35. Schwangerschaftswoche dürfen die Eltern die beiden mit nach Hause nehmen: „Außer einem Leistenbruch bei Helene war alles in Ordnung mit beiden. Sie hatten da schon 1900 Gramm. Ein Wunder, wenn man weiß, welche Gefahren Frühgeborenen oft drohen.“
Erste Spenderin für Muttermilch
Veronika hat viel Muttermilch: „Muttermilch war das Wertvollste, was ich geben konnte. Ich kam nach 14 Tagen auf zwei Liter täglich, meine Kinder brauchten gar nicht alles.“ Das Team der Kinderintensivstation kommt mit einer Anfrage auf sie zu: ob sie sich vorstellen könnte, ihre Milch für eine Muttermilchbank zu spenden. Veronika ist hellauf begeistert: „Eine tolle Idee, ich hab‘ sofort zugesagt, da kam die Hebamme in mir durch.“ Und so wird sie die erste Spenderin der Muttermilchbank des Klinikums.
Zwei Wirbelwinde mit Willen
Heute, fast fünf Jahre später: Helene und Marlena sind temperamentvoll, laut, fröhlich und gehen ihren Weg. Frühchen – das ist nur noch Erinnerung: „Frühchen sind eine Aufgabe, aber irgendwann sind sie einfach Kinder. Es passiert alles etwas später, krabbeln, laufen, sprechen. Sie haben alles aufgeholt. Sie sind gesund, sie lachen, sie streiten. Man darf sie nicht ewig in Watte packen. Aber wir wissen auch, dass wir uns glücklich schätzen dürfen. Bei anderen Kindern bleibt die Frühgeburt nicht folgenlos, das darf man nie vergessen.“ Doch selbst die beiden bleiben sensibel: „Sie brauchen Nähe. Wenn eine bei der Oma ist, ruft die andere an, ob’s ihr gut geht. Aber sie fetzen sich auch. Ganz normale Schwestern.“
Die Lehren einer Hebamme
Veronika Stampfl leitet selbst eine Praxis mit vier Kolleginnen in Kirchweidach. Als vierfache Mutter weiß sie sehr genau, was Mütter in Krisenzeiten brauchen und wie leicht man sich selbst vergisst: „Kinder profitieren am meisten von einer Mama, der es gut geht. Aber die Gesellschaft macht Schuldgefühle: Hast du zu lange gearbeitet, zu viel Stress gehabt? Die Vorwürfe und das ‚Mom-Shaming‘ sitzen tief.“ Sie sagt, viele Frauen brechen Monate später ein: „Nach ein paar Monaten kommen die Tränen. Dann, wenn alles vorbei scheint. Es ist gut, sich dann psychologische Betreuung zu holen, man kann den Einbruch damit gut bewältigen. Es ist ok, wenn man seine Gefühle anschaut und sich darum kümmert. Daher mein Ratschlag: Nicht wegdrücken und einfach weiterfunktionieren!“
01.12.2025 - Kreisklinik Trostberg
Hightech für die Medizin
KSOB nutzen Apollo OP-Roboter für Kniegelenkersatz am Standort Trostberg
Die Kliniken Südostbayern (KSOB) setzen künftig einen hochmodernen Apollo OP-Roboter für den Kniegelenkersatz ein. Das System wurde in den vergangenen Monaten an der Kreisklinik Trostberg erfolgreich getestet und wird dort nun dauerhaft in den klinischen Betrieb integriert. Damit setzen die KSOB einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Robotik-gestützter Präzisionsmedizin in der Region. mehr...
Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der KSOB, betont: „Der Einsatz des Apollo OP-Roboters hat eine große Bedeutung für die regionale Gesundheitsversorgung. Robotik und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für eine zukunftsgerichtete Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Mit dem neuen System können wir orthopädische Eingriffe noch präziser, sicherer und schonender durchführen – und das direkt hier in unserer Heimatregion.“
Präzision auf höchstem Niveau: Das Apollo-System
Das Apollo-System gilt als eines der innovativsten robotergestützten Systeme für den Kniegelenkersatz weltweit. Mit seinem einzigartigen, dynamisch arbeitenden BalanceBot-System ermöglicht es eine digitale und patientenindividuelle Operationsplanung. Schon vor dem eigentlichen Eingriff kann die Operation vollständig simuliert werden. Dabei werden unter anderem die Anatomie des Patienten und der Neigungswinkel der Prothese exakt berechnet. Optische Marker zeigen die präzise Position des neuen Gelenks, während ein intelligenter Algorithmus den optimalen Operationsplan erstellt.
Während der Operation unterstützt der Roboter den Operateur wie ein Navigationssystem: Sägen und Fräsen erfolgen millimetergenau – Abweichungen vom festgelegten Operationsbereich werden automatisch gestoppt. Dadurch wird Knochensubstanz geschont, die natürliche Gelenkmechanik besser erhalten und das Risiko von Komplikationen deutlich reduziert.
Die Vorteile für die Patientinnen und Patienten sind erheblich:
Höhere Präzision und Sicherheit bei der Implantation
Schonung von Bändern und Weichteilen
Verkürzte Genesungszeit durch minimal-invasive Technik
Weniger Schmerzen und Komplikationen nach dem Eingriff
Natürlichere Beweglichkeit und längere Haltbarkeit der Prothese
Medizinische Expertise und starke Partnerschaften
An der Kreisklinik Trostberg ist das System Teil des Endoprothetikzentrums mit hohem Operationsvolumen. Hier arbeitet man darüber hinaus sehr eng mit erfahrenen orthopädischen Belegärzten der KOMMEDICO – Orthopädie & Unfallchirurgie, Orthopädie Unfallchirurgie Chiemgau – Berchtesgadener Land (OUCC) sowie des Endoprothetikzentrums Ars Endo zusammen.
Das belegärztliche Expertenteam besteht unter anderem aus: PD Dr. Heinrich M.L. Mühlhofer, Dr. Matthias Blaschke, Dr. Christoph Thussbas, Dr. Peter Markl.
Dr. Joachim Deuble, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Trostberg, hebt hervor: „Die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern war und ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Gemeinsam konnten wir das Apollo-System umfassend testen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Wir sind überzeugt, dass der Roboter unsere Arbeit auf ein neues Niveau hebt und unseren Patientinnen und Patienten eine noch sicherere und präzisere Behandlung ermöglicht.“
Digitales Lernen und Zukunft der Orthopädie
Ein weiterer Fortschritt des Apollo-Systems liegt in der datengestützten Weiterentwicklung chirurgischer Verfahren. Alle Operationsdaten fließen anonymisiert in eine integrierte Lernplattform, über die Chirurginnen und Chirurgen weltweit ihre Erfahrungen austauschen können. So wird das Wissen kontinuierlich erweitert – ein wichtiger Schritt in Richtung einer lernenden, digital vernetzten Medizin.
Gemeinsam in die Zukunft investieren
Mit der Anschaffung des Apollo OP-Roboters setzen die Kliniken Südostbayern ein starkes Signal für Innovation, Präzision und regionale Spitzenmedizin.
26.11.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Klarheit statt Warten
Kurze Wege, rasche Diagnostik und sichere Entscheidungen in der Gastroenterologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall – neuer Sonografie-Experte von Uniklinik Augsburg

Die Gastroenterologische Diagnostik an der Kreisklinik Bad Reichenhall bietet Hausärzten und Patienten schnell verlässliche Abklärung – prästationär wie stationär. Der neue Sonografie-Experte Dr. Timm Kleffel vom Sonografiezentrum trägt dazu bei. mehr...
Wer medizinische Hilfe sucht, braucht eines vor allem: Klarheit – und das schnell. Und die liefert die Gastroenterologische Abteilung an der Kreisklinik Bad Reichenhall unter der Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Andrej Wagner – zeitnah, kompetent und mit einer Diagnostik, die sich hinter keinem Maximalversorger verstecken muss. Jenseits der 24/7-Notaufnahme bietet die Klinik die Möglichkeit, dringliche Indikationen wie Cholestase, Anämie oder Tumorverdacht ebenso zügig zu klären wie belastende Symptome (Schmerzen, Refluxsymptome, Übelkeit, Diarrhö, etc.). Priv.-Doz. Dr. Wagner erläutert: „Das Versprechen gilt sowohl für Patienten als auch für die überweisenden Ärztinnen und Ärzte: Wir stehen für kurze Wege, rasche Diagnostik und sichere Entscheidungen. Für die Kontaktaufnahme bietet sich das bewährte Ticketsystem unseres Bettenmanagements an, das nun durch die neu geschaffene direkte telefonische Kontaktmöglichkeit mit Oberärzten und mir im Rahmen der Anmeldung ergänzt wird. Die Telefonnummer dazu ist: 08651 / 772 301.“
Das gesamte Spektrum ist abgedeckt
Die Abteilung Gastroenterologie und Diabetologie deckt das gesamte Spektrum der Gastroenterologie ab: von akuten und chronischen Darmerkrankungen über gastrointestinale Blutungen bis zur Früherkennung und Behandlung von Karzinomen. Moderne Verfahren wie Chromoendoskopie, die Entfernung komplexer Polypen, Mukosektomie oder Endoskopische Submukosadissektion gehören zum breiten Spektrum. Erkrankungen der Gallengänge, der Bauchspeicheldrüse sowie akute und chronische Leberleiden finden hier Experten zur Behandlung.
Herzstück dieser Leistungen ist die Funktionsabteilung mit Endoskopie und Sonographie. Moderne Untersuchungsräume, ausgerüstet für sämtliche etablierte endoskopische und sonographische Verfahren bilden ihr Fundament. Für Notfälle steht eine 24-Stunden-Rufbereitschaft durch Fachärzte und Gastroenterologen parat. Wer nachts ein akutes Problem hat, kann also sicher sein: Hier wird gehandelt.
Neuer Sonografie-Experte vom Uniklinikum Augsburg
Parallel führt die leistungsstarke Sonographie-Abteilung mit modernsten Geräten incl. Kontrastmittel-Sonoraphie und Elastographie ca. 6000 Untersuchungen im Jahr durch. Sie liefert hochauflösende Diagnostik für Bauch, Leber, Becken, Lunge, Gefäße und Hals, das Ärzteteam führt Punktionen, Drainagen oder Thermoablationen durch.
Seit Oktober 2025 wird die Abteilung durch Oberarzt Dr. Timm Kleffel verstärkt, einem dezidierten Sonographie-Spezialisten, Ausbilder und Kursleiter der DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin), der vom Uniklinikum Augsburg nach Bad Reichenhall gekommen ist, um das Sonografiezentrum weiter auszubauen. Seine Schwerpunkte sind neben der Diagnostik der Bauchorgane, der Lunge und der Gefäße die Abklärung von Leisten- und anderen Brüchen in Zusammenarbeit mit unserem Hernienzentrum, die Sonographie auffälliger Lymphknoten incl. Stanzbiopsie, Punktionen und Drainagen von Flüssigkeitsansammlungen, die Weichteilsonographie und nicht zuletzt die Kontrastmittelsonographie.
Kurz: Wer schnelle, fundierte gastroenterologische Abklärung braucht, findet in Bad Reichenhall einen guten Partner.
25.11.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Damit aus einem Bruch kein Notfall wird
KSOB-Vortragsreihe „Gesundheit AKTIV“ zum Thema 4. Dezember 2025

Weichteilbrüche zählen zu den häufigsten Erkrankungen der Allgemeinchirurgie und treten oft lange Zeit ohne deutliche Beschwerden auf. Moderne Leitlinien empfehlen inzwischen eine frühzeitige operative Versorgung. Welche Risiken ein Abwarten mit sich bringen kann und welche zeitgemäßen Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen, erläutert Stefan Buchholz, Oberarzt an der Kreisklinik Bad Reichenhall und Leiter des neuen Hernienzentrums Berchtesgadener Land. mehr...
Weichteilbrüche entstehen dort, wo die Bauchwand oder andere Gewebeschichten geschwächt sind. Besonders häufig treten sie in der Leiste, am Nabel, an der Bauchwand oder an früheren Operationsnarben auf. Viele Betroffene bemerken zunächst nur eine kleine Vorwölbung oder ein Ziehen unter Belastung, manche spüren über Jahre hinweg gar nichts. „Genau das trägt dazu bei, dass Brüche häufig unterschätzt werden“, sagt Dr. Buchholz. Problematisch wird es vor allem dann, wenn sich Gewebe in der Bruchlücke einklemmt, etwa Fettanteile oder sogar eine Darmschlinge. Tritt dieser Zustand ein, kann er sich innerhalb kurzer Zeit zu einem chirurgischen Notfall entwickeln. „Ist der Darm betroffen und die Durchblutung gestört, bleibt nur ein enges Zeitfenster für die Operation, um einen dauerhaften Schaden zu verhindern“, so der Oberarzt.
Um mögliche Risiken frühzeitig einschätzen zu können, bietet die Kreisklinik Bad Reichenhall eine spezialisierte Herniensprechstunde an. Dort werden Patientinnen und Patienten zunächst ausführlich befragt und untersucht. Anschließend erfolgt eine Ultraschalluntersuchung, bei komplexeren Befunden wie größeren Narbenhernien oft auch eine Computertomographie. Auf dieser Grundlage wird individuell entschieden, ob eine Operation notwendig ist und welches Verfahren am besten geeignet erscheint. „Wichtig ist, dass wir die Situation für jede einzelne Person bewerten. Das Risiko einer Einklemmung hängt nicht nur von der Größe des Bruchs ab, sondern vom gesamten Befund“, erklärt der Oberarzt.
Schonend operieren, schnell erholen
Leistenbrüche sowie kleinere Nabel- und Bauchwandhernien können heute häufig ambulant versorgt werden. Patienten kommen am Vormittag zur Operation, der Eingriff erfolgt in der Regel in Vollnarkose und nach einigen Stunden im Aufwachbereich können sie die Klinik wieder verlassen. Spezielle Verbandswechsel sind meist nicht erforderlich, die verwendeten Fäden lösen sich selbst auf und nach zwei Tagen ist in der Regel wieder Duschen möglich.
Bei minimalinvasiven Leistenoperationen beträgt die empfohlene Schonzeit in der Regel etwa zwei Wochen. „Schweres Heben, intensiver Sport oder körperlich fordernde Tätigkeiten sollten in dieser Zeit vermieden werden“, sagt Dr. Buchholz. Deutlich aufwendiger ist die Behandlung größerer Narbenhernien. In diesen Fällen wird oft die gesamte Bauchwand rekonstruiert, es werden Netze eingelegt. Der Eingriff erfolgt immer stationär, häufig kommen Drainagen und ein Schmerzkatheter zum Einsatz. Die anschließende Phase der körperlichen Schonung kann vier bis sechs Wochen dauern.
Neben den klassischen Brüchen der Bauchwand behandelt die Kreisklinik Bad Reichenhall auch Zwerchfellhernien, die häufig mit chronischem Sodbrennen, Entzündungen der Speiseröhre, Atemproblemen oder auch Herzrhythmusstörungen einhergehen. Diese Eingriffe sind zwar weniger häufig, können für die Betroffenen aber eine große Entlastung bedeuten. In Zusammenarbeit mit der gastroenterologischen Abteilung werden entsprechende Voruntersuchungen durchgeführt und geprüft, ob eine Operation sinnvoll ist. Die Versorgung erfolgt minimalinvasiv und kann den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre dauerhaft unterbinden, so dass Patienten keine Medikamente mehr gegen Sodbrennen einnehmen müssen.
Zertifizierte Qualität
Die Kreisklinik Bad Reichenhall führt jährlich rund 400 Hernienoperationen durch und wurde zum 1. Januar 2025 von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein und Viszeralchirurgie als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie zertifiziert. Für diese Auszeichnung müssen unter anderem feste Mindestmengen, definierte Qualitätskriterien und niedrige Komplikationsraten nachgewiesen werden. Zudem werden alle Eingriffe in die Qualitätssicherungsstudie Hernia Med eingebracht, deren Nachbefragungen ein, fünf und zehn Jahre nach der Operation erfolgen. Patientinnen und Patienten erhalten außerdem ein Merkblatt mit Verhaltenshinweisen und eine direkte dienstliche Telefonnummer, über die sie bei Fragen jederzeit Rücksprache halten können. Zentrumsleiter ist Stefan Buchholz, gemeinsam mit Chefarzt Dr. Langwieler stehen zwei zertifizierte Hernienchirurgen zur Verfügung.
24.11.2025 - Klinikum Traunstein
Babyglück im Doppelpack im Klinikum Traunstein
Geteiltes Glück ist doppeltes Glück: Die beiden Schwestern Elisabeth Huber (links im Bild) und Katharina Gumpinger (rechts) bekommen fast zeitgleich ihre Babys: Den Anfang macht Marlena, die Tochter der älteren Schwester Elisabeth, sie kommt am 21.11. um 14.53 Uhr mit 3340 Gramm und 51 cm zur Welt. Nur gut 15 Stunden später erblickt Korbinian Johannes, der Sohn der jüngeren Schwester Katharina, am 22.11. um 6.27 Uhr das Licht der Welt. Er ist mit 3940 Gramm und 54 cm etwas schwerer und etwas größer als seine Cousine. mehr...
Wie schon die beiden älteren Geschwisterkinder der Neugeborenen werden sie wohl gemeinsam aufwachsen – und vielleicht auch gemeinsam ihre Geburtstage feiern. Auf jeden Fall sind die beiden schon jetzt schick in Strick: Partnerlook von Anfang an.
22.11.2025 - Klinikum Traunstein
Großes Interesse an Gesundheitsaktionen der Kliniken Südostbayern
Weltpankreaskrebstag: Patientin berichtet von eigener Erfahrung
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten anlässlich des Weltpankreaskrebstags am gestrigen Donnerstag die Gelegenheit, sich im Eingangsbereich des Klinikums Traunstein umfassend über Risiken, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zu informieren. Die Kliniken Südostbayern (KSOB) hatten mit der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Interventionelle Endoskopie, der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Diabetologie und der Ernährungsberatung ein vielseitiges Programm organisiert. mehr...
Als weithin sichtbares Zeichen der Solidarität und Aufklärungsarbeit wurde die Fassade des Klinikums Traunstein am Abend in kräftigem Lila – der internationalen Aktionsfarbe des Weltpankreaskrebstags – illuminiert.
Bereits ab 9 Uhr standen Expertinnen und Experten der beteiligten Fachbereiche für Gespräche bereit. Die Funktion der Bauchspeicheldrüse wurde anschaulich erklärt und Interessierte konnten individuell Fragen zu Erkrankungen des Organs, den diagnostischen Möglichkeiten und Therapieoptionen stellen. Der Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP) als größte Pankreas-Selbsthilfeorganisation war mit vielen Infomaterialien vertreten.
Ein besonderer Moment für viele Besucher war das Gespräch mit Frau Blaschke, Patientin der KSOB. Bei ihr hatte zunächst der Verdacht auf eine bösartige Erkrankung der Bauchspeicheldrüse bestanden - ein Befund, der für Betroffene und Angehörige häufig eine enorme Belastung bedeutet. Nach erfolgter Pankreas-Operation im Klinikum Traunstein fand sich schließlich eine gutartige, chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung als ursächlich für die Beschwerden der Patientin. Offen berichtete Frau Blaschke über ihre Erfahrungen, Ängste und den Verlauf ihrer Erkrankung; ein Beitrag, den viele Besucherinnen und Besucher als sehr wertvoll empfanden.
Ein zentraler Bestandteil der Informationsaktion war das Aufzeigen der häufig unspezifischen Symptome, die auf ein Pankreaskarzinom hinweisen können, darunter ungeklärter Gewichtsverlust, Gelbsucht, neu auftretender Diabetes, Veränderungen im Stuhlgang oder Verdauungsprobleme. Da diese Krebsart im Frühstadium kaum eindeutige Anzeichen verursacht und häufig erst spät entdeckt wird, zählt sie nach wie vor zu den gefährlichsten Tumorarten.
Deutliche Fallzahlsteigerung im Pankreaskrebszentrum seit 2024
Seit der Implementierung eines überregionalen Viszeralzentrums in Südostbayern im Juni 2024 mit Zentralisierung der chirurgischen viszeralonkologischen Fälle am Klinikum Traunstein unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Jurowich und Dr. André Prock konnten sowohl die Anzahl der Behandlungsfälle als auch die Operationszahlen deutlich gesteigert werden. Mit derzeit rund 45 Bauchspeicheldrüsen-Resektionen pro Jahr hat sich die Zahl der Eingriffe mehr als verdoppelt. Mit dieser Entwicklung wurde der Zentrumsgedanke innerhalb des von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Pankreaskrebszentrums konsequent gestärkt und weiterentwickelt. Inzwischen werden ausgewählte Fälle minimal-invasiv mit dem DaVinci-Operationssystem operiert – ein weiterer Schritt hin zu modernen, schonenden und zugleich hochpräzisen chirurgischen Verfahren.
21.11.2025 - Kliniken Südostbayern
Die Kliniken Südostbayern wirtschaften nachweislich verantwortungsvoll

Die Kliniken Südostbayern (KSOB) sind nun offiziell Mitglied im Netzwerk „Verantwortungsvoll Wirtschaften“ des Landkreises Berchtesgadener Land. Am 18. November wurde beim Netzwerktreffen die entsprechende Urkunde des Netzwerks überreicht – eine sichtbare Anerkennung des Engagements der KSOB in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. mehr...
Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der KSOB, und Philipp Hämmerle, Vorstand, sind stolz darauf, die Urkunde in Händen zu halten: „Wir bedanken uns beim Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice für die Auszeichnung. Als Teil der Biosphärenregion Berchtesgadener Land, einer von der UNESCO ausgezeichneten Modellregion für nachhaltige Entwicklung, tragen wir eine besondere Verantwortung. Diese nehmen wir bewusst an: Wir wollen einen aktiven Beitrag zur ökologischen, sozialen und ökonomischen Zukunftsfähigkeit unserer Region leisten.“
Die Ausrichtung des verantwortungsvollen Wirtschaftens orientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Sie bilden für die Mitglieder des Netzwerks, also auch für die KSOB, einen wichtigen Kompass – mit dem gemeinsamen Ziel, eine menschenwürdige, gesunde und lebenswerte Zukunft für alle zu ermöglichen.
Eines ist Dr. Uwe Gretscher und Philipp Hämmerle besonders wichtig: „Unser besonderer Dank richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen in den KSOB, die Nachhaltigkeit tagtäglich und ganz praxisorientiert in ihrer Arbeit leben. Sie gestalten die Gesundheitsversorgung in unserer Heimat verantwortungsvoll, nachhaltig und zukunftsorientiert.“
20.11.2025 - Kliniken Südostbayern
Intensive Vernetzung für optimale Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten
Qualitätszirkel der niedergelassenen Kinderärzte

Rund 50 Teilnehmer kamen zum Qualitätszirkel der niedergelassenen Kinderärzte im Bildungszentrum Traunstein zusammen. Unter der Leitung des niedergelassenen Kinderarztes Dr. Tobias Winter bot die Veranstaltung niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land eine wichtige Plattform für den fachlichen Austausch mit den Ärzten der Kinderklinik Traunstein, der Kinderchirurgie sowie der Kinderanästhesie. mehr...
Prof. Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinderklinik Traunstein, begrüßte die Teilnehmer und betonte die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. „Der regelmäßige Austausch zwischen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und der Klinik ist essentiell für die bestmögliche Versorgung unserer kleinen Patienten", so Prof. Wolf.
Im Mittelpunkt der Fortbildung standen praxisrelevante Vorträge: Dr. Andreas Hofbauer und Dr. Marc John Jorysz von der Kinderchirurgie Traunstein informierten über kinderchirurgische Krankheitsbilder und deren Behandlung. Dr. Winfried Roth von der Anästhesie und Kinderanästhesie referierte über wichtige Aspekte bei Kindernarkosen und die Maßnahmen zur Patientensicherheit. Besonderes Augenmerk lag auf der optimalen Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Praxen und Klinik – von der Überweisung bis zur Nachsorge.
Bei einer gemeinsamen Brotzeit klang die Veranstaltung aus und bot Gelegenheit für persönliche Gespräche und kollegialen Austausch. Der Qualitätszirkel unterstreicht die gelebte Vernetzung der pädiatrischen Versorgung in der Region und trägt maßgeblich zur Qualitätssicherung bei.
19.11.2025 - Klinikum Traunstein
Frühen Darm- und Magenkrebs minimal-invasiv behandeln
Ärztinnen und Ärzte aus Mittel- und Süddeutschland lernen am Klinikum Traunstein die Technik der endoskopischen Submukosadissektion (ESD)

Die Submukosadissektion (ESD) ist ein endoskopisches Verfahren zur Abtragung von Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts, die nicht in tiefere Wandschichten eingewachsen sind. Dieses Verfahren ermöglicht Heilung unter Erhalt des betroffenen Organs. Es ist in geübter Hand schonend und mit einem wesentlich kürzeren Krankenhausaufenthalt und geringerer Komplikationsrate verbunden im Vergleich zu einem chirurgischen Eingriff. mehr...
Die Durchführung des endoskopischen Verfahrens erfordert jedoch eine hohe Expertise des Untersuchers und seines Teams und wird nur in wenigen, darauf spezialisierten Zentren in Deutschland angeboten.
Ende Oktober führten standortübergreifend Teams aus Traunstein und Bad Reichenhall den 1. Traunsteiner ESD-Kurs durch. Zehn Teilnehmer aus Kliniken in Mittel- und Süddeutschland nahmen an dem Kurs teil. Am ersten Tag wurden theoretische Grundlagen und Techniken vermittelt. Ein Highlight stellt dabei die Live-Demonstration am Modell auf einer Großleinwand dar. Vollkommen eigenständig, unter enger Anleitung der Tutoren Dr. Björn Lewerenz, Chefarzt der Gastroenterologie am Klinikum Traunstein, Priv.-Doz. Dr. Andrej Wagner, Chefarzt der Gastroenterologie und Diabetologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall und Dr. Daniel Fitting, Oberarzt der Gastroenterologie am Klinikum Traunstein, konnten die Teilnehmer dann am Schweinemodell ganze Prozeduren durchführen.
Die sicher einzigartige 2:1 Betreuung von Tutor und Teilnehmer ermöglichte umfangreiche Zeit beim selbstständigen Arbeiten am Modell. Als besonderes Kurskonzept wurde die Möglichkeit angeboten, eine eigene Endoskopie-Assistenz für die Kursteilnahme mitzubringen, um als Team gemeinsam ESD-Kompetenz zu entwickeln. Nicole Seehuber, Barbara Hartje, Stefan Kraller und Frank Blechschmid aus dem Traunsteiner Pflegeteam standen mit ihrer Erfahrung sowohl den Ärzten als auch den Assistenzkräften tatkräftig zur Seite.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur ersten Durchführung des qualitativ hochwertigen Kurses waren entsprechend positiv: Von „rundum perfekter Kurs“ über „sehr gut organisiert“ und „weiter so, bitte 2:1 Betreuung am Modell beibehalten“ bis hin zu „viele Tipps und Tricks erhalten“.
17.11.2025 - Klinikum Traunstein
Bauchspeicheldrüsenkrebs – hochgefährlich und schwer zu erkennen
Große Aktion für Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich des Klinikums Traunstein am 20. November

Anlässlich des Weltpankreaskrebstags am 20. November möchten die Bereiche Gastroenterologie, Hepatologie sowie Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Traunstein mit Aktionen für Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich auf Risiken, Gefahren und mögliche Symptome von Bauchspeicheldrüsenkrebs hinweisen. Als besonderes Zeichen für diese Aktionen wird die Fassade des Klinikums Traunstein am 20.11.2025 ab 17 Uhr lila beleuchtet sein. mehr...
Von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr können sich Interessierte an einem Stand mit Fragen an Ärztinnen und Ärzte wenden; anhand eines Modells der Bauchspeicheldrüse wird die Funktion des Organs erklärt. Dr. André Prock, Leitender Arzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Dr. Björn Lewerenz, Chefarzt der Gastroenterologie, werden zusammen mit den Oberärztinnen und Oberärzten dieser beiden Abteilungen für Gespräche bereitstehen, ebenso wie Vertreter der Diabetologie und der Ernährungsmedizin.
Wie sich Pankreaskrebs äußert und wie gefährlich er ist, können die Besucherinnen und Besucher auch im Gespräch mit einer Betroffenen erfahren, die zu diesen Zeiten ebenfalls am Infostand anwesend sein wird.
Die „World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC)“ empfiehlt generell eine stärkere Sensibilisierung für Bauchspeicheldrüsenkrebs und nennt dazu die folgenden Symptome, die bei den Betroffenen auftreten können:
- Ungeklärter Gewichtsverlust
- Gelbe Haut oder Augen
- Veränderungen im Stuhlgang
- Neu auftretender Diabetes
- Verdauungsprobleme
- Appetitlosigkeit
- Stimmungsschwankungen
Diese oft vagen Symptome können auf Bauchspeicheldrüsenkrebs hinweisen, denn diese Krebsart verursacht im Frühstadium oft keine klaren Anzeichen. Daher wird sie leider häufig erst sehr spät erkannt. Allerdings bildet sie früh Metastasen und kommt selbst nach einer Therapie häufig zurück. Das führt dazu, dass Tumoren der Bauchspeicheldrüse – obwohl deutlich seltener als Darmkrebserkrankungen – äußerst schwierig zu behandeln sind. Das Risiko, daran zu erkranken, steigt zwar im höheren Alter, ist allerdings auch schon ab etwa 45 Jahren gegeben. Auch das macht Bauchspeicheldrüsenkrebs so gefährlich.
Am Klinikum Traunstein findet sich das durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierte Pankreaskrebszentrum, das wiederum Teil des Onkologischen Zentrums der Kliniken Südostbayern ist. Durch die hohe Anzahl an Patienten mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, auch gutartiger Natur, die im Zentrum in Traunstein behandelt werden, herrscht auf diesem Gebiet eine ausgesprochene Expertise.
14.11.2025 - Kliniken Südostbayern
Koronare Herzkrankheit bei Frauen – andere Symptome, genauso gefährlich

Unter das Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ stellt die Deutsche Herzstiftung die diesjährigen Herzwochen im November und informiert über die koronare Herzkrankheit, kurz genannt KHK. Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die Grunderkrankung und Vorstufe des Herzinfarkts. Und: der Herzinfarkt ist längst keine reine „Männerkrankheit“ mehr. mehr...
Die KHK ist zugleich die häufigste Herzerkrankung in Deutschland mit rund 540.000 Krankenhausaufnahmen und die führende Todesursache mit rund 120.000 Todesfällen pro Jahr, davon 44.000 Herzinfarkt-Sterbefälle. Bei den Frauen waren es 2023 über 51.000 Sterbefälle, darunter mehr als 18.000 durch Herzinfarkt.
Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Südostbayern, erläutert: „Generell beobachten wir, dass aufgrund des hormonellen Schutzes Herzkrankheiten bei Frauen meist etwa zehn Jahre später auftreten als bei Männern. Aber wenn die Frauen ihre geschlechterspezifischen Symptome für die koronare Herzkrankheit kennen, hilft dies, rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.“
Vor den Wechseljahren profitieren Frauen von einem schützenden Effekt der weiblichen Geschlechtshormone (Östrogene). Sie regulieren nicht nur den Zyklus und die Schwangerschaft, sondern sind auch an unterschiedlichen Prozessen des Stoffwechsels beteiligt. Sie beeinflussen Entzündungsreaktionen und die Blutgerinnung und sie wirken erweiternd auf die Blutgefäße. Auf diese Weise können Östrogene vor der Bildung von arteriosklerotischen Ablagerungen in den Gefäßen schützen und vor einer koronaren Herzkrankheit bewahren. Nach den Wechseljahren lässt der Hormonschutz jedoch nach: Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt dann bei Frauen rascher an als bei Männern.
So erkennen Frauen die Warnsignale rechtzeitig
Bei einem Herzinfarkt entscheidet jede Minute über Leben oder Tod. Doch gerade Frauen nehmen ihre Symptome häufig nicht ernst. Und: Bei Frauen können sich Beschwerden und Risiken deutlich von denen der Männer unterscheiden. Gerade bei älteren Frauen treffen die allgemein bekannten Herzinfarktsymptome weniger zu, weiß Priv.-Doz. Dr. Niklas Boeder, Leitender Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein: „Der typische starke Brustschmerz, der auch in verschiedene Körperregionen ausstrahlen kann, macht sich bei Frauen beispielsweise oft weniger heftig bemerkbar als bei Männern. Frauen berichten eher von einem Druck- oder Engegefühl in der Brust.“
Weitere Symptome für einen Herzinfarkt bei Frauen können sein:
- Kurzatmigkeit / Atemnot
- Schweißausbrüche
- Rückenschmerzen
- Übelkeit
- Erbrechen
- Schmerzen im Oberbauch
- Ziehen in den Armen
- Unerklärliche Müdigkeit
- Depressionen
Die Abgrenzung zwischen Wechseljahrs-Beschwerden und den oben beschriebenen Symptomen ist nicht immer leicht. Als Richtlinie kann jedoch dienen, dass man sich sofort Hilfe über die Telefonnummer 112 holen sollte, wenn Beschwerden in einem bisher nicht gekannten Ausmaß auftreten.
Auch jüngere Frauen sollten die Gefahr einer Herzkrankheit nicht beiseiteschieben, sondern handeln, denn weitere Risikofaktoren für eine KHK, die Frauen kennen sollten, sind Komplikationen bei einer Schwangerschaft (wie Diabetes, Präeklampsie und Eklampsie sowie Fehl-, Früh- oder Totgeburten) und eine Verschiebung der Menarche (erste Menstruation) oder der Menopause (letzte Menstruation).
Wie senken Frauen ihr Herz-Risiko in der Menopause?
In der Menopause kommt es zu einer Umstellung des Körpers: die schützende Wirkung der Hormone Östrogen und Progesteron auf das Herz-Kreislauf-System sinkt. Außerdem kommt ein weiterer Faktor hinzu: Gleichzeitig steigt der Spiegel des Hormons Testosteron, was unter anderem dazu führt, dass Frauen verstärkt in der Bauchregion Fett einlagern. Die Gefahr dabei: die Gefäße verengen sich, was wiederum eine fatale Wirkung auf die Herzgesundheit hat. Prof. Dr. Lehrke rät: „In dieser Lebensphase ist es für Frauen besonders wichtig, auf ihr Herz zu achten. Dabei hilft der Besuch in der hausärztlichen Praxis: die Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern zeigt, ob die Gefäße zur arteriellen Gefäßsteifigkeit oder Plaquebildung neigen, was wiederum Rückschlüsse auf die Elastizität der Herzkranzgefäße erlaubt.“
Zum Check gehen und gesund leben
Die Vorsorge in der hausärztlichen Praxis hilft allen: Am besten gehen Frauen (vielleicht gleich zusammen mit ihren Partnern) ab 35 Jahren – bei familiärer Vorbelastung auch früher –, um regelmäßig Blutdruck, Blutzucker, Blutfette (Cholesterin) und Körpergewicht kontrollieren zu lassen.
Ein gesunder Lebensstil zum Erhalt der Gefäßgesundheit ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Herzgesundheit. Frauen (wie Männer) sollten auf gesunde Ernährung achten sowie nicht rauchen und auf Alkohol möglichst verzichten. Besonders wichtig ist regelmäßige Bewegung sowie Ausdauer- und moderates Krafttraining für den Muskelerhalt. Frauen in den Wechseljahren und danach sollten allerdings ihr Trainingspensum deutlich steigern, je nachdem wie häufig körperlich aktiv sie vorher waren.
Der gesunde Lebensstil ist nicht einfach zu erreichen, daher gilt, es langsam und überlegt anzugehen. Prof. Dr. Lehrke empfiehlt: „Überlegen Sie, was Sie zuerst angehen möchten und versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu ändern. Wenn Sie beispielsweise rauchen und übergewichtig sind und Sie das Rauchen aufgeben wollen, hören Sie zuerst mit dem Rauchen auf und machen Sie nicht zugleich noch eine Diät. Wenn Sie zu viel sitzen, beginnen Sie langsam, sich mehr zu bewegen, aber versuchen Sie nicht gleich, einen Halbmarathon zu laufen.“ Ein gesunder Lebensstil und Aufmerksamkeit gegenüber unüblichen Symptomen helfen Frauen, ihr Herz gesund zu erhalten.
13.11.2025 - Kliniken Südostbayern
Pflege-Azubis einen Tag auf den Intensivstationen des Klinikums Traunstein
Theorie trifft auf Praxis – 15 Auszubildende erleben den Highcare-Bereich aus nächster Nähe

Wer den Beruf der Pflege ergreift, merkt schnell: Zwischen Lehrbuch und Patientenbett liegen Welten. Diese Kluft durften nun 15 Schülerinnen und Schüler der Klasse 23a der Berufsfachschule für Pflegeberufe Traunstein überbrücken – beim Besuch der Intensivstationen des Klinikums Traunstein. In Begleitung ihrer Lehrkraft Tanja Hinrichs erlebten sie einen Tag, der nicht nur informativ, sondern bei einigen vielleicht sogar prägend war. mehr...
Einblick in die Welt der Intensivpflege
Zur Begrüßung hießen Bereichsleiterin Lisa Pichler und Angelika Walcher, Stationsleiterin der OP-Intensivstation, die angehenden Pflegefachkräfte willkommen. Anschließend übernahmen Nadja Weih (Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege und Praxisanleiterin der Medizinischen Intensivstation) und Florian Heindl (Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Praxisanleiter Operative Intensivstation Nord) die Betreuung der Gruppe. Sie führten die Auszubildenden durch die drei Intensivstationen, erklärten den Schichtablauf, die Arbeitsweise im Team und die Vielfalt der Krankheitsbilder.
Besonderes Augenmerk lag auf der Verbindung von Theorie und Praxis: Passend zum Unterrichtsthema „Schädel-Hirn-Trauma“ konnten die Schülerinnen und Schüler einen entsprechenden Patientenfall kennenlernen. Eine erfahrene Intensivpflegekraft schilderte die Versorgung – selbstverständlich unter strenger Wahrung des Datenschutzes. So wurde aus abstrakter Theorie anschauliche Realität.
Medizinische Technik zum Anfassen
Wie Technik und Teamarbeit Hand in Hand gehen, zeigte Dr. Markus Barth, Oberarzt der Medizinischen Intensivstation. Er zeigte den Azubis die, neben den Fahrzeugen der Rettungsdienste für die Notfallrettung, weiteren zentralen Säulen der Notfallmedizin am Klinikum Traunstein: Zum einen ist dies der Rettungshubschrauber Christoph 14, der seinen Stützpunkt auf dem Dach des Klinikums Traunstein hat. Robert Portenkirchner ist der Leiter der medizinisch-technischen Rettungshubschrauber-Besatzungen (HEMS TC = Helicopter Emergency Medical Service - Technical Crew). Die ausgebildeten Notfallsanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes bilden dabei zusammen mit dem Piloten (von der Bundespolizei) die „Flight Crew“ (fliegerische Besatzung). Den Notarzt oder die Notärztin an Bord stellt dabei die Notarztgemeinschaft, eine Gruppe notfallmedizinisch ausgebildeter Ärztinnen und Ärzten am Klinikum Traunstein. Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler das in der Zentralen Notaufnahme abfahrbereite ECMO-Fahrzeug (ECMO = Extrakorporale Membranoxygenierung) besichtigen, das bei Notfällen mit einer im Auto installierten Herz-Lungen-Maschine Leben rettet. Damit bekamen die jungen Besucherinnen und Besucher einen Eindruck davon, wie mobil und vernetzt die Notfallmedizin heute ist.
Auch selbst durften die Auszubildenden aktiv werden: Unter Anleitung der Praxisanleiter übten sie die Reanimation mit CPRmeter und Lucas-System, moderne Hilfsmittel zur Wiederbelebung. Ebenso konnten sie eine NIV-Beatmung ausprobieren – eine Erfahrung, die nicht nur technisches Geschick, sondern auch Verantwortungsbewusstsein verlangt.
Begeisterung und Motivation
Am Ende des Tages war die Resonanz eindeutig: Ein gelungener Besuch, der Theorie und Praxis eindrucksvoll verband. „Eine tolle Erfahrung“, lautete der Tenor der Auszubildenden. Der umfängliche Einblick in den Alltag der Intensivstationen und der Notfallmedizin hinterließ bleibenden Eindruck – und vielleicht auch die Motivation, eines Tages selbst Teil der dortigen Teams zu werden.
12.11.2025 - Klinikum Traunstein
Wenn jede Minute zählt – für alle Fälle vorbereitet
Die Pädiatrische Intensivstation am Klinikum Traunstein besteht als einziges Haus zwischen Salzburg und München erneut die Strukturprüfung des Medizinischen Dienstes

Für Eltern ist es der Albtraum schlechthin: Das eigene Kind schwer krank oder verletzt. In solchen Momenten zählt jede Minute – und vor allem das Vertrauen, dass das Kind in den bestmöglichen Händen ist. Die gute Nachricht: Die Pädiatrische Intensivstation am Klinikum Traunstein hat erneut die strenge Strukturprüfung nach § 275a SGB V bestanden. Als einzigem Haus zwischen Salzburg und München bestätigt der Medizinische Dienst damit: Hier stimmt nicht nur die Technik, hier stimmt die komplette Versorgung. mehr...
Geprüfte Sicherheit – wohnortnah
Was bedeutet das für Familien in der Region? Es bedeutet, dass sie im Notfall nicht weit fahren müssen, um beste medizinische Versorgung zu bekommen. Die Strukturprüfung des Medizinischen Dienstes ist kein Papiertiger, sondern eine knallharte Überprüfung: Ist die Ausstattung auf dem neuesten Stand? Sind genügend qualifizierte Ärzte und Pflegekräfte da? Funktionieren die Abläufe auch um drei Uhr nachts? „Diese Prüfung ist sehr anspruchsvoll", erklärt Prof. Dr. Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin. „Dass wir sie erneut bestanden haben, zeigt: Eltern können sich auf uns verlassen. Tag und Nacht."
Rund um die Uhr für die Kinder da
Die Station ist immer voll besetzt. Kinder-Intensivpflege und Kinderintensivmediziner sind ständig verfügbar. Die Ausstattung entspricht modernsten Standards: Beatmungsgeräte, Überwachungsmonitore, 24-Stunden-Bildgebung. Das Labor liefert Ergebnisse in kürzester Zeit. „Wir wollen, dass Eltern wissen: Ihr Kind bekommt hier genau die Versorgung, die es braucht. Ohne Verzögerung, und auf dem allerneuesten medizinischen Stand", sagt Prof. Dr. Wolf.
Besonders beruhigend: Auf der Station arbeiten verschiedene Fachrichtungen Hand in Hand. Kinderchirurgie, Kinderkardiologie, Neuropädiatrie – alles unter einem Dach. Die enge Zusammenarbeit mit der Geburtsmedizin am gleichen Standort bedeutet für Neugeborene kürzeste Wege und optimale Versorgung vom ersten Atemzug an.
Erfahrung, auf die man sich verlassen kann
Das Klinikum Traunstein gehört zu den zehn größten Traumazentren Deutschlands. Hier werden regelmäßig auch schwerste Verletzungen behandelt – mit der Routine und Erfahrung aus tausenden Fällen. Und der Landeplatz des Rettungshubschraubers Christoph 14 auf dem Dach ermöglicht schnellste Transporte, wenn es um Minuten geht.
Viele wissen gar nicht, dass diese hochspezialisierte Versorgung direkt in der Region verfügbar ist. „Manche denken automatisch an größere Städte wie München oder Salzburg", sagt Prof. Dr. Wolf. „Aber die Qualität, die wir hier bieten, steht Zentren in Großstädten in nichts nach. Das hat auch der Medizinische Dienst jetzt schwarz auf weiß bestätigt."
Vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen
Ob Unfälle, schwere Infektionen, Vergiftungen, Herzprobleme oder die Versorgung nach großen Operationen – das Team der Pädiatrischen Intensivstation ist auf alle Notfälle vorbereitet. Vom kleinsten Frühgeborenen bis zum Jugendlichen. Und das nicht nur zwischen neun und fünf, sondern wirklich rund um die Uhr mit voller Besetzung.
„Hinter jedem Fall steht ein Kind und eine Familie in einer Ausnahmesituation", sagt Prof. Dr. Wolf. „Unsere Aufgabe ist es nicht nur, medizinisch das Beste zu geben, sondern auch Vertrauen zu schaffen. Diese Strukturprüfung zeigt, dass wir diesem Anspruch gerecht werden."
Ein Versprechen an die Region
Das Bestehen der Prüfung ist mehr als eine formale Bestätigung. Sie ist ein Versprechen an alle Familien in der Region: Wenn das Schlimmste passiert, ist das Klinikum Traunstein bereit. Mit geprüfter Qualität, erfahrenen Teams und modernster Ausstattung.
„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung", sagt Prof. Dr. Wolf. „Aber noch stolzer sind wir auf die, die dahinterstehen: die Teams, die jeden Tag große Verantwortung übernehmen. Für die kleinsten und verletzlichsten Patienten. Mit Können, Erfahrung und Menschlichkeit."
04.11.2025 - Kliniken Südostbayern
Koronare Herzkrankheit – Risikofaktoren, Symptome und Gefahren
Unterschiedliche Symptome bei Männern und Frauen

Unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ informiert die Deutsche Herzstiftung während der diesjährigen Herzwochen (https://herzstiftung.de/herzwochen) über die koronare Herzkrankheit, kurz genannt KHK. Sie ist Grunderkrankung und Vorstufe des Herzinfarkts und zugleich die häufigste Herzerkrankung in Deutschland mit rund 540.000 Krankenhausaufnahmen. Und sie ist die führende Todesursache mit rund 120.000 Todesfällen pro Jahr, davon 44.000 Herzinfarkt-Sterbefälle (Deutscher Herzbericht – Update 2025). Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Südostbayern, und Priv.-Doz. Dr. Niklas Boeder, Leitender Oberarzt am Klinikum Traunstein, ist wichtig, die unterschiedlichen Symptome bei Männern und Frauen hervorzuheben: „In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den generellen Alarmsignalen und den Behandlungsmöglichkeiten für alle Menschen sowie mit den Symptomen, die hauptsächlich auf Männer zutreffen.“ Ein weiterer Artikel widmet sich ganz bewusst ausschließlich den Frauen und deren Gefährdung für Herzinfarkt – denn bei ihnen sind die Symptome oft anders, aber die Herzinfarkt-Zahlen steigen auch für sie. mehr...
Wie äußert sich die koronare Herzkrankheit?
Atemnot, Brustenge oder Brustschmerzen unter körperlicher Anstrengung, das sind – vor allem bei Männern – die Alarmzeichen: Machen sich diese typischen Symptome bemerkbar, ist meist schon über viele Jahre unbemerkt eine Schädigung der Herzkranzgefäße vorangegangen. Denn damit das Herz seine lebenswichtige Arbeit rund um die Uhr leisten kann, muss es ausreichend mit nähr- und sauerstoffreichem Blut versorgt werden, was über die Koronararterien (Herzkranzgefäße) geschieht. Kommt es dort an den Innenwänden zu Ablagerungen – sogenannten Plaques – können diese Gefäße zunehmend verengen („verkalken“). Plaques bestehen hauptsächlich aus Fett, Cholesterin, entzündlichen Zellen, Bindegewebe und Kalzium („Kalk“). Dieser Prozess einer zunehmenden Verdickung der Gefäßwand mit Einengung des Gefäßinnenraums wird dann als koronare Herzkrankheit bezeichnet. Die Einengung macht sich jedoch erst bemerkbar, wenn die Arterienverengung eine kritische Schwelle von 70-80 % erreicht hat und es damit zur Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nährstoffen kommt.
Sie sollten in Ihren Arzt aufsuchen, wenn:
„Wer über zwei Wochen hinweg Probleme beim Treppenhochsteigen hat und sich schwach fühlt, sollte deshalb unbedingt seine hausärztliche Praxis aufsuchen. Ebenso sollte man zum Arzt bei nicht erklärbarer Luftnot – ob mit oder ohne Druck in der Brust. Auch Beschwerden wie eine schnelle Ermüdbarkeit sollten nicht einfach auf Alter oder Stress geschoben, sondern ernst genommen und zeitnah medizinisch geklärt werden“, rät Prof. Dr. Michael Lehrke. „Bei Brustschmerzen sollten die Patienten auch sagen, ob die Schmerzen durch körperliche oder psychische Belastung ausgelöst werden und ob die Schmerzen in Ruhe nachlassen.“
Um zu klären, ob tatsächlich eine KHK die Ursache der Angina-pectoris-Beschwerden bei Belastung ist, wird in der haus- oder fachärztlichen Praxis zunächst ein Ruhe-EKG (Aufzeichnen der elektrischen Aktivität des Herzens im Liegen), eine körperliche Untersuchung und eventuell eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Für weitere diagnostische Schritte, wie eine Herzkatheter-Untersuchung oder eine Computertomographie des Herzens, stehen, nach der Überweisung des Patienten durch die Praxis, am Klinikum Traunstein und in der Kreisklinik Bad Reichenhall umfassende Untersuchungsmöglichkeiten bereit. Halten die Beschwerden jeweils aber über 20 Minuten an oder treten auch in Ruhe auf, sollte im Notfall der Rettungsdienst über die Telefonnummer 112 alarmiert werden.
Behandlungsmöglichkeiten der koronaren Herzkrankheit (KHK)
Priv.-Doz. Dr. Niklas Boeder erklärt die weiteren Schritte: „Gelingt es nicht, die Beschwerden medikamentös zu kontrollieren, oder zeigt sich während der Diagnostik eine schwerwiegende KHK mit deutlichen Gefäßablagerungen und
-einengungen oder gar Gefäßverschlüssen, haben die Ärztinnen und Ärzte zwei Möglichkeiten, um die Durchblutung in den betroffenen Herzgefäßen wieder zu verbessern. So können die meisten Verengungen der Herzkranzgefäße mit Hilfe der Perkutanen Intervention (PCI) – einem Katheter-Eingriff mittels Ballon und Stent (Gefäßstütze) – zuverlässig behandelt werden. In rund zehn Prozent der Fälle ist jedoch eine Bypass-Operation notwendig, bei der eine Umgehung (engl. bypass) um den verengten Gefäßbereich gelegt wird.
Für die Behandlung eines akuten Herzinfarkts ist die PCI-Technik bei fast allen Patientinnen und Patienten die bevorzugte Methode. Sind jedoch mehrere Gefäße betroffen oder sind die Einengungen zum Beispiel an einer für einen Stent ungünstigen Stelle, sprechen sich europäische Leitlinien für die Bypass-OP aus. Über die bestmögliche Behandlungsstrategie für den individuellen KHK-Patienten entscheidet in den KSOB in der Regel ein interdisziplinäres Herz-Team. „In bestimmten Fällen reicht die Kathetertechnik nicht aus, um eine KHK adäquat zu behandeln. Das ist beispielsweise bei Patienten mit komplexer koronarer Mehrgefäßerkrankung der Fall, oder wenn chronisch verschlossene Gefäße vorliegen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Niklas Boeder, Leitender Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein.
Vorbeugen ist besser als operieren
Die Big Five, also die 5 größten Risikofaktoren für die koronare Herzkrankheit, sind die wichtigsten Anknüpfungspunkte, um einen Herzinfarkt zu vermeiden:
• Blutdruck messen, Bluthochdruck behandeln
• Rauchen beenden
• LDL-Cholesterin bestimmen und erhöhte Werte behandeln
• Übergewicht vermeiden, Körpergewicht kontrollieren
• Blutzucker messen, Diabetes behandeln
Eine wichtige Basismaßnahme für alle Menschen, um ihre individuellen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren frühzeitig zu erfassen, ist der regelmäßigen Gesundheits-Check-up bei der Hausärztin oder dem Hausarzt. Dieser kann ab 18 Jahren einmalig und ab 35 Jahren dann alle drei Jahre erfolgen. Bezahlt wird der Check-up von der gesetzlichen Krankenkasse, er kann durchgeführt werden in allgemeinmedizinischen und internistischen Praxen. Das EKG unter Belastung sowie die Ultraschalluntersuchung des Herzens können das EKG in Ruhe ergänzen. Darüber hinaus erlauben es etwa Ultraschalluntersuchungen der Halsschlagadern oder der Becken- und Beingefäße, frühzeitig Gefäßverkalkungen zu erkennen, die die Betroffenen noch nicht bemerken. Außerdem ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben und Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren und auf ausreichenden Schlaf zu achten. Denn gesunde Gefäße und ein gesundes Herz können den Herzinfarkt vermeiden.
30.10.2025 - Kliniken Südostbayern
Schlaganfallnetzwerk Südost-Bayern als das bundesweit Erste zertifiziert
Traunstein und Bad Reichenhall sind offizielle Partnerkliniken
Nun ist es amtlich: das Schlaganfallnetzwerk Südost-Bayern „TEMPiS“ ist – als erstes Netzwerk bundesweit – durch die Deutsche Schlaganfallgesellschaft und die Deutsche Schlaganfall-Hilfe zertifiziert worden. Die Steuerzentrale des telemedizinischen Netzwerks sitzt dabei in den Räumen der Klinik Harlaching in München. mehr...
Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Traunstein ist stolz und freut sich: „Die Zertifizierung ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Netzwerks – und damit auch für die optimale und wohnortnahe Schlaganfallversorgung der Bevölkerung der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein.“ Das Klinikum Traunstein mit seiner „Überregionalen Stroke Unit“ – der einzigen zwischen München und Salzburg – und die Kreisklinik Bad Reichenhall mit der „Regionalen Stroke Unit“ sind als Partnerkliniken des Netzwerks gelistet.
Die telemedizinische, vernetzte Stroke Unit der Kreisklinik Bad Reichenhall kooperiert dabei sehr eng mit der im Klinikum Traunstein. Mit dem Leitenden Arzt Dr. Markus Schwahn steht in der Kreisklinik Bad Reichenhall ein erfahrener Neurologe bereit.
In der Traunsteiner „Überregionalen Stroke Unit“, also der spezialisierten Schlaganfall-Abteilung, wird das komplette Spektrum der Therapien rund um die Uhr vorgehalten. Erst im August 2025 war die Abteilung selbst zum wiederholten Male durch die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe & Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft zertifiziert worden: Eine Auszeichnung, die hohe Anforderungen an Struktur- und Prozessqualität stellt und im Klinikum Traunstein seit vielen Jahren durchgehend bereitgestellt wird.
Die Überregionale Stroke Unit im Klinikum Traunstein verfügt über 6 Betten mit Schnittstellen zu allen relevanten Bereichen. Sie ist außerdem als Thrombektomiezentrum in das „Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung – TEMPiS" der Region Süd-Ost-Bayern eingegliedert. Die Schlaganfall-Einheit ist zusätzlich als „ESO Stroke Centre“ auch nach europäischen Standards zertifiziert.
30.10.2025 - Klinikum Traunstein
Sichere und umfassende Versorgung in höchster Not
Überregionales Traumazentrum mit sehr guten Ergebnissen

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie DGU® hat das Überregionale Traumazentrum am Klinikum Traunstein unter der Leitung von Prof. Dr. Kolja Gelse, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie der Kliniken Südostbayern, bewertet und die Zahlen und Fakten des Jahres 2024 zusammengestellt.
Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der KSOB, und Jessica Koch, Klinikleiterin des Klinikums Traunstein, sind stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „All die Zahlen und das sehr gute Ergebnis des Berichts dokumentieren die perfekte Teamleistung der Ärztinnen und Ärzte und der Pflegekräfte im OP, in der Zentralen Notaufnahme und auf den Intensivstationen.“ mehr...
In diesem Register sind neben überregionalen Traumazentren auch lokale und regionale Zentren in Europa gelistet. Überregionale Traumazentren, wie das am Klinikum Traunstein, gibt es in ganz Deutschland nur ca. 120, verteilt auf ganz Bayern sind dies 25.
Verkehrs-, Berg- und Fahrradunfälle dominieren
Im Jahr 2024 waren für das Überregionale Traumazentrum am Klinikum Traunstein 217 Fälle von schwerstverletzten Patienten dokumentiert, was nahezu doppelt so hohe Fallzahlen bedeutet, wie beim Mittel aller bundesdeutschen Überregionalen Traumazentren. Priv.-Doz. Dr. Tom-Philipp Zucker, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie und Ärztlicher Direktor des Klinikums Traunstein, erläutert: „Das Klinikum Traunstein gehört zu den zehn größten Versorgern von Schwerst- und Mehrfachverletzten (Polytraumata) in Deutschland.“ Prof. Dr. Kolja Gelse ergänzt: „Bei den Verletzungsmustern stechen besonders Verletzungen der Wirbelsäule und Becken mit ca. 40 % und Schädel-Hirn-Traumata mit einem Anteil von ca. 35 % heraus.“
Gründe für die hohen Fallzahlen sind sowohl der Standort des Rettungshubschraubers Christoph 14 am Klinikum Traunstein, mit dem Schwerstverletzte auch aus größeren Entfernungen schnellstmöglich zur Versorgung gebracht werden, als auch die hohe touristische Attraktion des Einzugsgebiets des Klinikums. Das zeigten die hauptsächlichen Unfallursachen: Verkehrsunfälle (PKW, Motorrad und Fahrrad), sowie Stürze auch aus großer Höhe (höher als 3 m), wie sie bei Berg- und Arbeitsunfällen häufig vorkommen.
Auffällig dabei: die Patientinnen und Patienten wurden in den letzten Jahren im Schnitt immer älter, in 2024 lag der Alters-Mittelwert bei 55,4 Jahren – 35 % waren sogar 70 Jahre und älter, der Anteil der Männer lag bei 71 %. Mehr als 50 % aller Menschen wurden mit dem Hubschrauber in die Klinik eingeliefert.
Schnelle Versorgung
Prof. Dr. Gelse erklärt die Grundsätze der Notfallversorgung schwerer Verletzungen: „Bei Menschen mit schweren und schwersten Verletzungen stehen lebenserhaltende Maßnahmen durch Notfalleingriffe an erster Stelle. Darunter versteht man eine operative Hirndruckentlastung, eine Stabilisation der Wirbelsäule mit ggf. Druckentlastung des Rückenmarks, das Stoppen von inneren Blutungen im Brustkorb oder der Bauchhöhle, eine Wiederherstellung der Durchblutung lebenswichtiger Organe oder Rekonstruktion großer verletzter Gefäße, die Behandlung von Verbrennungen sowie die Stabilisierung des Beckens oder der Extremitäten. Für alle diese Maßnahmen stehen bei uns im Klinikum Traunstein rund um die Uhr die Expertinnen und Experten der jeweiligen Abteilungen zur Verfügung.“
Die Dauer bis zu einer Not-OP, zum Beispiel bei penetrierenden Traumata, also offenen Wunden oder Brüchen, konnte im Klinikum Traunstein dabei durch verbesserte Prozesse in den letzten drei Jahren um 33 % reduziert werden. Die Zeitspanne von der Aufnahme im Schockraum bis zur Blut-Transfusion konnte ebenfalls in den letzten drei Jahren um fast 50 % verkürzt werden. In der Klinik wurden 65 % der Patientinnen und Patienten sofort operiert. Bei 86 % davon erfolgte eine anschließende Behandlung auf der Intensivstation.
Liegedauer auf der Intensivstation
Der Bericht zeigte, dass im Klinikum Traunstein die Menschen vergleichsweise kürzer auf der Intensivstation (ICU = Intensive Care Unit) behandelt werden mussten, als es aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen zu erwarten gewesen wäre. Die Patientinnen und Patienten konnten also früher mit weiterführenden rehabilitierenden Maßnahmen beginnen. Der Median der Liegedauer aller Patienten auf den Intensivstationen am Klinikum liegt bei 5 Tagen, was deutlich kürzer ist als es die Verletzungsschwere hätte erwarten lassen. Der Bericht nennt als Grund dafür die optimale Versorgung der Menschen auf der Intensivstation.
Die Überlebensrate schwerverletzter Personen
Mehr Menschen haben überlebt, als aufgrund ihrer Verletzung erwartbar gewesen wäre und die eigentlich eine schlechte Überlebensprognose hatten, denn alle hatten bei ihrem Eintreffen schwere oder schwerste Verletzungen. Als Grund nennt der Bericht der DGU® explizit die besonders gute interdisziplinäre Versorgung von Traumapatienten am Überregionalen Traumazentrum des Klinikums Traunstein. Priv.-Doz. Dr. Zucker erläutert: „Die Überlebensrate unserer Patientinnen und Patienten liegt überdurchschnittlich hoch, d. h. über dem Erwartungswert, gemessen am Trauma-Schweregrad und anderen Faktoren.“
Rundum gut versorgt
Wurden die Patienten entlassen, so waren laut Bericht 93,3 % der Patientinnen und Patienten des Klinikums Traunstein gut erholt und konnten in eine Reha-Klinik verlegt (34,2 %) oder direkt nach Hause entlassen werden (53,7 %).
Quelle: Alle Daten stammen aus dem offiziellen Register der Sektion NIS (Notfall- & Intensivmedizin und Schwerverletztenversorgung) der DGU & AUC (2025), Jahresbericht 2025 TraumaRegister DGU®.
Überregionales Traumazentrum und Wirbelsäulenspezialzentrum
Neben Sport- und Freizeitunfällen liegt ein Hauptschwerpunkt der Unfall- und Orthopädischen Chirurgie am Klinikum Traunstein auf der Behandlung von Patientinnen und Patienten, die während ihrer Arbeit oder auf ihrem Arbeitsweg Unfälle hatten. Nur besonders geeignete Kliniken, die die Kriterien des sogenannten Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV) der Berufsgenossenschaften erfüllen, dürfen Arbeitsunfälle aller Schweregrade behandeln. Das Klinikum Traunstein ist dabei ein Schwerpunktkrankenhaus in der bayerischen Berufsgenossenschafts-Liste und ist als Überregionales Traumazentrum zertifiziert.
Seit März 2025 hat die Unfall- und Orthopädische Chirurgie, Chefarzt Prof. Dr. Kolja Gelse, zusammen mit der Abteilung für Neurochirurgie, Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger, erneut die Rezertifizierung als „Wirbelsäulenspezialzentrum“ der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft erfolgreich abgeschlossen. Dieser Qualitätsnachweis bestätigt die 24/7-Verfügbarkeit spezialisierter Expertise auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie, hochmoderne Ausstattung und klar definierte Prozesse. Die Patienten profitieren hierbei auch von der Interdisziplinarität, d. h. der Verfügbarkeit von Neurochirurgen, Anästhesisten, Radiologen, Intensivmedizinern und speziell geschultem Pflegepersonal rund um die Uhr.
29.10.2025 - Kliniken Südostbayern / InnKlinikum
Ausbau der Bettenkapazitäten für die Pneumologie am Klinikum Traunstein
Startschuss für das Lungenkrebszentrum Südostbayern

Gemeinsame Pressemitteilung
Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) erweitern ihr medizinisches Leistungsspektrum am Standort Traunstein: Seit dieser Woche verfügt das Klinikum über eine eigene Fachabteilung für Pneumologie. Damit wird nicht nur eine wichtige Versorgungslücke geschlossen – die pneumologische Abteilung bildet zugleich die Basis für den Aufbau des Lungenkrebszentrums Südostbayern, das gemeinsam mit dem InnKlinikum Altötting und Mühldorf betrieben wird. mehr...
„Mit der Etablierung der Pneumologie am Klinikum Traunstein schaffen wir für die Menschen in der Region einen direkten Zugang zu modernster Diagnostik und Therapie auf universitärem Niveau – und das wohnortnah“, erklärt Jessica Koch, Klinikleiterin der KSOB in Traunstein. „Patientinnen und Patienten profitieren von kurzen Wegen, hochspezialisierter Expertise und einer nahtlos abgestimmten Behandlung.“
Hochspezialisierte Kompetenz – vernetzt für die Region
Bislang war die Pneumologie vorrangig an der Kreisklinik Bad Reichenhall beheimatet, geleitet von Prof. Dr. Tobias J. Lange. Mit nun auch zehn pneumologischen Betten in Traunstein wird die Versorgung erheblich ausgebaut. Möglich macht dies die enge Zusammenarbeit der KSOB mit dem InnKlinikum sowie die Integration in ein starkes Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten.
Die neue Abteilung für „Onkologische und interventionelle Pneumologie“ in Traunstein hat ihren Schwerpunkt in den Bereichen Diagnostik und Behandlung von Lungenkrebs sowie in der Durchführung von bronchoskopischen Eingriffen (Lungenspiegelung). Die Abteilung steht unter der Leitung von Priv. Doz. Dr. Arno Mohr, der als Chefarzt auch die Pneumologische Abteilung des Innklinikum Mühldorf verantwortet.
Die neue Fachabteilung arbeitet eng mit der Thoraxchirurgie um Chefarzt Dr. Steffen Decker (KSOB) und den Leitenden Oberarzt Dr. Lutz Woldrich (KSOB / InnKlinikum), den übrigen Fachabteilungen am Standort Traunstein, sowie der Pneumologischen Abteilung an der Kreisklinik Bad Reichenhall zusammen. Die interdisziplinäre Vernetzung entstand auf Initiative von Dr. Wolfgang Richter, Medizinvorstand des InnKlinikum. „Diese weitere Kooperation der Klinikunternehmen stellt sicher, dass Patientinnen und Patienten mit Lungenerkrankungen in Südostbayern eine wohnortnahe, leitliniengerechte und passgenaue Behandlung erhalten.”
Lungenkrebszentrum Südostbayern – Spitzenmedizin vor Ort
Mit der neuen Abteilung startet zugleich der Aufbau des Lungenkrebszentrums Südostbayern. Fachlich ist es angebunden an das zertifizierte Onkologische Zentrum der KSOB sowie an die pneumologische Abteilung des Innklinikums Mühldorf. Ziel ist es, Betroffene mit Lungenkrebs von der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Nachsorge ganzheitlich und interdisziplinär zu begleiten.
Die Leitung dieses standortübergreifenden Zentrums liegt bei Herrn Priv. Doz. Dr. Arno Mohr, Chefarzt Pneumologie, InnKlinikum Mühldorf, und Chefarzt Pneumologie, Klinikum Traunstein.
Unterstützt wird er dabei von einem erfahrenen Expertenteam:
- Dr. Steffen Decker, Chefarzt Thoraxchirurgie, KSOB
- Dr. Lutz Woldrich, Leitender Oberarzt Thoraxchirurgie, KSOB / Sektionsleiter Thoraxchirurgie, InnKlinikum Mühldorf
- Prof. Dr. Tobias J. Lange, Chefarzt Pneumologie, KSOB
- Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt Kardiologie, KSOB,, und Dr. Alexander Galland, Oberarzt und Facharzt für Pneumologie, KSOB
- Dr. Thomas Kubin, Chefarzt Hämatologie, Okologie und Palliativmedizin, KSOB
- Dr. Johannes Spes, Chefarzt Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Innklinikum Altötting
- Dr. Wolfgang Richter, Medizinvorstand des InnKlinikum Altötting und Mühldorf, Chefarzt Allgemein-, Viszeral-, Endokrine Chirurgie und Thoraxchirurgie
Modernste Diagnostik, individuelle Therapie
Das Zentrum setzt auf modernste Verfahren der Bildgebung (Low-Dose-CT, PET-CT, MRT), Bronchoskopie mit endobronchialem Ultraschall (EBUS), umfassende Lungenfunktionsdiagnostik sowie molekularpathologische Analysen. Alle Befunde werden in einer regelmäßig tagenden interdisziplinären Tumorkonferenz gemeinsam bewertet.
Therapien reichen von minimalinvasiven Operationen über Immun- und Chemotherapie, zielgerichtete Medikamente bis hin zur Strahlentherapie – individuell abgestimmt auf Tumorbiologie, Krankheitsstadium und persönliche Situation. Ergänzende Angebote wie Atemtherapie, Psychoonkologie und Sozialberatung sichern eine Rundumversorgung.
Exzellente Versorgung – regional verankert
Mit den Klinikstandorten in Traunstein und Bad Reichenhall sowie der Kooperation mit dem InnKlinikum Mühldorf entsteht ein starkes regionales Versorgungsnetz. Patientinnen und Patienten profitieren von kurzen Wegen, klaren Abläufen und einem zentralen Ansprechpartner – Zuweiser von einer strukturierten Zusammenarbeit.
„Das neue Lungenkrebszentrum Südostbayern vereint höchste fachliche Kompetenz mit regionaler Nähe. Damit bringen wir Spitzenmedizin zu den Menschen – genau dorthin, wo sie gebraucht wird“, betont KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher.
28.10.2025 - Kliniken Südostbayern
Faktencheck: die häufigsten Mythen über Brustkrebs
zum Brustkrebsmonat

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau, etwa jede neunte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Die meisten haben schon von dieser Erkrankung gehört, viele kennen sogar jemanden, der bereits daran erkrankt war oder ist. Dennoch kursieren viele Mythen in der Bevölkerung, teilweise auch unter dem Personal des Gesundheitswesens, die zu Verunsicherungen führen und manchmal auch wichtige diagnostische oder Behandlungsschritte verhindern. Zum Abschluss des Brustkrebsmonats Oktober wollen wir diese Mythen aufzeigen und beleuchten. mehr...
Woher kommen diese Mythen?
Oberärztin Dr. Juliane Singhartinger, Zentrumskoordinatorin des Brustzentrums am Klinikum Traunstein, erläutert: „Zum einen beruhen sie auf früheren Krankheitstheorien, die inzwischen durch moderne Forschungsmethoden widerlegt wurden, aber damals so viel Aufmerksamkeit erfuhren, dass sie sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Ihre Widerlegung fand jedoch weniger Beachtung. Zum anderen sind es simple „fake news“ (Falschinformationen), die im Internet kursieren. Hier ist nicht immer klar, ob und welche Lobby hiervon profitiert. Besonders provokant formulierte, groß geschriebene, bunte Artikel beinhalten oft erfundene Inhalte, wohingegen die sachlicher formulierten Artikel oft professioneller recherchiert sind. Dies ist natürlich keine generelle Regel.“
Im Brustzentrum Traunstein unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern, werden jährlich mehrere Hundert Brustkrebs-Patientinnen beraten und behandelt. Seit fast 20 Jahren wird das als Brustzentrum jedes Jahr rezertifiziert und gehört damit zu den am längsten bestehenden Brustzentren in Deutschland.
Neben Medizinstudium, Facharztausbildung, zahlreichen Spezialfort-/weiterbildungen, der nahezu täglichen Recherche der aktuellen Literatur- und Studienlage, ist es auch die praktische Erfahrung, die die Expertinnen und Experten des Brustzentrums zu kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für die Patientinnen und Patienten und alle Interessierten zum Thema Brustkrebs macht.
Welche Mythen kursieren?
1) „Brustkrebs können nur Frauen kriegen.“
Falsch. Jede 100. Brustkrebserkrankung betrifft einen Mann. Im Jahr 2022 erkrankten 690 Männer in Deutschland an Brustkrebs. Auch Männer haben Brustdrüsengewebe, welches aber nach der Pubertät meist nicht weiterwächst. Die meisten Tastbefunde in der männlichen Brust sind gutartiger Natur, selten kann aber auch Brustkrebs dahinterstecken. Dies ist nach aktueller Kenntnis nicht immer genetisch bedingt, sondern kann auch spontan entstehen.
2) „Brustkrebs wird immer vererbt.“
Falsch. Etwa 10% der Brustkrebserkrankungen sind erblich bedingt. Hierbei werden sogenannte Hochrisiko-Gene von den Eltern (Vater oder Mutter) mit einem Risiko von jeweils 50% an die Kinder weitergegeben. Damit ist aber noch immer nicht die Erkrankung direkt vererbt worden, wohl aber das Risiko hieran zu erkranken. Mehr als 10 dieser Gene sind bereits bekannt und können bei entsprechender familiärer Häufung von Erkrankungsfällen auch getestet werden. Je nach Genveränderung variiert das Risiko zwischen ca. 20 und 70% im Leben an Brustkrebs zu erkranken. Es gibt Möglichkeiten zur Früherkennung und zur Risikoreduktion.
3) „Mammografien verursachen Brustkrebs und wurden deswegen im Ausland bereits verboten.“
Falsch. Brustkrebs lässt sich häufig nicht durch eine Tastuntersuchung feststellen. Die Früherkennung, bestehend aus Mammografie, ggf. in Kombination mit Brustultraschall, kann auch sehr kleine, nicht tastbare Befunde erkennen. Eine Diagnosestellung in einem frühen Erkrankungsstadium führt häufiger zur Heilung und kann meist schonender behandelt werden. Teilweise kann diese Diagnostik aber auch zur unnötigen Beunruhigung oder Überdiagnostik führen. Innerhalb von 10 Jahren werden von 10.000 Frauen ca. 70 Frauen unnötig beunruhigt und erhalten z. B. eine weitere Bildgebung oder eine Biopsie, um letztendlich eine Frau vor dem möglichen Versterben am Brustkrebs zu bewahren.
Die Strahlenbelastung durch eine Mammografie ist heute deutlich geringer als früher und liegt bei etwa einem Zehntel der jährlichen durchschnittlichen natürlichen Strahlenbelastung. Meldungen aus 2024, dass z. B. in der Schweiz das Mammografie-Screening verboten worden wäre, sind schlichtweg Falschmeldungen, was auf seriösen Internetseiten nachzulesen ist.
In Deutschland wurde das Mammografie- Screening aufgrund des positiven Risiko-Nutzen-Verhältnisses erst kürzlich erweitert und ist nun für alle Patientinnen zwischen 50 und 75 Jahren vorgesehen.
4) „Bügel-BHs, Tattoos oder Piercings können Brustkrebs auslösen.“
Falsch. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass Bügel-BHs oder Tattoos durch das Abdrücken und Verstopfen der Lymphwege den Abtransport von schädlichen Substanzen aus der Brust verhindern und damit Brustkrebs auslösen können. Zwar können in der Tattoo-Farbe krebserregende Stoffe sein und man findet durchaus Ablagerungen der Tattoofarbe in Lymphknoten, jedoch konnte ein direkter Zusammenhang mit Brustkrebs bisher nicht nachgewiesen werden. Dies gilt auch für Piercings. Zur Rolle der Bügel-BHs wurden bereits große Beobachtungsstudien mit mehreren Tausend Frauen durchgeführt, die zeigten, dass Brustkrebs bei den Bügel-BH-Trägerinnen nicht häufiger auftritt.
5) „Die Biopsie weckt den Tumor auf, weil Luft rankommt. Dadurch wird er erst aktiv.“
Falsch. Obwohl sich die Ärzte und Ärztinnen manchmal bereits nach Durchführung einer klinischen und bildgebenden Untersuchung schon sehr sicher sind, dass es sich um eine Brustkrebserkrankung handelt, sollte dies immer erst durch eine Biopsie gesichert werden. Dies dauert ca. 10 Minuten, die Patientin erhält eine örtliche Betäubung und kann gleich danach nach Hause gehen. Dies ist nicht nur wichtig, um die Diagnose zu bestätigen, sondern man kann hieraus bereits ableiten, welche Therapien in welcher Reihenfolge erforderlich sind, um die Erkrankung möglichst zu heilen. Häufig ist es nicht sinnvoll gleich „zum Messer zu greifen“ und zu operieren. Bei vielen Patientinnen würde man sich ohne vorherige Biopsie (wenn man z. B. gleich operiert, dies wird manchmal gewünscht) die Chance auf die bestmögliche Therapie vertun. Die Aktivität des Tumors kann aus dem entnommenen Gewebe beurteilt werden und bestand bereits zum Zeitpunkt der Entnahme. Sollte sich erfreulicherweise ein gutartiger Befund herausstellen, bleibt dies auch nach Biopsie so. Das ist bekannt, weil auch die gutartigen Befunde noch mindestens zwei Jahre nachbeobachtet werden. Der Brustkrebs ist immer als eine Systemerkankung zu verstehen, die manchmal nach vielen Jahren wiederkehrt, obwohl sie früh erkannt und behandelt wurde. Dies liegt nach aktueller Kenntnis an bereits lange vor der Diagnose über das Blut gestreuten Tumorzellen, die oft viele Jahre in einem „Schlummerzustand“ im Körper verbleiben können. Diese komplexe Art der Ausbreitung hängt mit den Tumoreigenschaften, aber nicht mit der Stanzbiopsie zusammen.
6) „Die Brust abzunehmen ist immer die sicherste Option.“
Falsch. Schon seit vielen Jahren wissen wir, dass die brusterhaltende Operation mit nachfolgender Strahlentherapie eine mindestens genauso sichere Behandlungsoption ist wie die Abnahme der Brust. Die Körperbildveränderung ist aber deutlich weniger gravierend. Inzwischen zeigen die Daten sogar einen immer größeren Überlebensvorteil für Patientinnen, die sich für die brusterhaltende Operation und Strahlentherapie entscheiden. Dieser besteht für alle Tumorstadien (in denen eine brusterhaltende Operation möglich ist) und auch unabhängig davon, ob nach der Brustabnahme noch eine Bestrahlung erfolgte. Sollte eine brusterhaltende Operation nicht sinnvoll möglich sein, z. B. bei vielen Tumorherden in einer Brust, großem oder entzündlichen Tumor) kann eine Rekonstruktion der Brust mit Silikonimplantaten oder Eigengewebe (z.B. vom Bauch oder Oberschenkel) erfolgen.
7) „Man kann Brustkrebs doch auch mit homöopathischen oder pflanzlichen Mitteln heilen.“
Falsch. Obwohl immer wieder einschlägige persönliche Fallberichte oder Bücher auf dem Markt erscheinen, die das Gegenteil behaupten, kann eine Heilung bei nachgewiesener Brustkrebserkrankung mit den o.g. Therapien allein nicht erreicht werden. Teilweise kommt es sogar zu gefährlichen Therapieverzögerungen, weil Patientinnen „es erstmal so versuchen wollen“. Wenn die nun deutlich verzögerte „schulmedizinische“ Therapie dann nicht die erhoffte Heilung bringt, fühlen sich die Patientinnen manchmal sogar bestätigt.
Dennoch strebt man immer ein ganzheitliches Behandlungskonzept an, das auch z. B. pflanzliche Therapien oder die Traditionelle Chinesische Medizin mit einbezieht. Vor allem zur Reduktion von Nebenwirkungen finden hier z. B. Akupunktur oder Yoga Anwendung. Es existiert bereits eine eigene Leitlinie zur Komplementärmedizin bei onkologischen Patientinnen und Patienten. Wichtig ist hierbei aber auch immer die Abstimmung mit dem behandelnden Onkologen, da sich diese Therapien unter Umständen auch negativ auswirken können. So kann z. B. eine Hochdosis-Vitamin-C-Therapie sogar die Wirksamkeit einer Chemotherapie herabsetzen. Für sportliche Aktivität konnte hingegen sogar eine signifikante, also erhebliche, Senkung des Rezidivrisikos (Risiko des Wiederauftretens von Brustkrebs) nachgewiesen werden.
8) „Brustkrebs kommt immer irgendwann wieder und letztendlich stirbt man doch dran.“
Falsch. Die Heilungsraten beim Brustkrebs sind generell hoch, aber individuell vom Erkrankungsstadium bei Diagnose und der Tumorbiologie abhängig. Bei nicht metastasierten Tumoren liegen sie bei ca. 80 % für die nächsten 10 Jahre. Bei einem Teil der Patientinnen (ca. 20 %) kommt es irgendwann im Leben zum Wiederauftreten der Brustkrebserkrankung, in höheren Stadien passiert dieses noch öfter. Auch hier kann größtenteils wieder eine dauerhafte Heilung erreicht werden. Diese inzwischen beeindruckend hohen Heilungsraten sind vor allem durch die frühe Erkennung wie auch durch die modernen individualisierten Therapiemöglichkeiten bedingt. Somit sollten diese der Patientin auch angeboten und diese durch die Patientin auch wahrgenommen werden. Ohne Therapie bleibt Brustkrebs eine zumeist tödlich verlaufende Erkrankung.
Inzwischen kann selbst bei metastasierter Erkrankung häufig über viele Jahre eine stabile Krankheits- und Lebenssituation erreicht werden.
Dr. Singhartinger fasst zusammen: „Dies ist nur eine exemplarische Darstellung von Fragen und Aussagen, die uns im Klinikalltag begegnen. Letztendlich lässt sich, wie häufig in der Medizin und im Umgang mit Menschen, kaum eine Aussage verallgemeinern. Es gilt, immer jede Patientin/jeder Patient sowie deren/dessen Erkrankung und Bedürfnisse individuell wahrzunehmen und auch Fragen und Ängsten gegenüber offen zu sein. Das schafft Vertrauen. Nur so kann man gemeinsam den individuell optimalen Weg gehen – mit einer guten Prognose in Aussicht.“
24.10.2025 - Kliniken Südostbayern
Kinder im Umgang mit Typ-1-Diabetes stärken
12. Diabetesdetektivcamp

Vom 14. bis 16. Oktober 2025 fand das 12. Diabetesdetektivcamp der Kinderklinik der Kliniken Südostbayern (KSOB) statt. Zwölf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, alle mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus Typ 1, verbrachten drei intensive und lehrreiche Tage auf dem Dreikanthof am Chiemsee. mehr...
Unter dem Motto „Nik und Niki – Wir werden Diabetes-Detektive“ erlebten die Kinder ein altersgerechtes Schulungskonzept, das weit über theoretisches Lernen hinausgeht. Im Mittelpunkt standen spielerische Intensivworkshops, Teamaktivitäten und praktische Alltagssituationen, in denen die Kinder ihren Diabetes aktiv managen und voneinander lernen konnten.
Spielerisch lernen – Selbstständigkeit fördern
Ziel des Camps ist es, Kinder zu stärken, die zu Beginn ihrer Erkrankung noch zu jung für strukturierte Schulungen waren. Mit dem Programm werden sie darauf vorbereitet, Alltagssituationen auch ohne ihre Eltern sicher zu bewältigen – etwa Übernachtungen bei Freunden, Wandertage oder Klassenfahrten.
Dazu gehören wichtige Fähigkeiten wie:
- Blutzucker messen in Alltagssituationen
- Kohlenhydrate einschätzen und Insulin berechnen
- Hypoglykämietraining – richtig reagieren im Notfall
- Reflexion und Austausch über das Leben mit Diabetes
- Lernen durch Erleben – mit Spaß und Gemeinschaft
Gemeinschaftliche Aktivitäten wie Kochen mit regionalen Zutaten, Picknick am See und Lagerfeuer mit Diabetes-Detektiv-Party sowie eine Kinderolympiade und ein „Wer wird (Millionär) Diachampion“-Spiel machten das Wochenende zu einem besonderen Erlebnis. Auf dem Dreikanthof gibt es eine große, zur Turnhalle ausgebaute Tenne und eine Trampolinanlage, die gezielt genutzt wurden, um den Einfluss von Bewegung auf den Blutzucker praktisch zu erleben – mit professioneller Anleitung, aber in lockerer, spielerischer Atmosphäre.
„Drei Tage in Gemeinschaft mit Gleichbetroffenen haben oft mehr Einfluss auf die Krankheitsakzeptanz als 30 Einzelstunden Therapie.“
– Betreuungsteam der KSOB –
Medizinische Sicherheit – pädagogisch begleitet
Rund um die Uhr wurden die Kinder medizinisch betreut durch eine Diabetesberaterin, eine Kinderdiabetologin, sowie junge Coaches, die selbst mit Diabetes leben, unterstützt durch ehrenamtlich engagiertes Fachpersonal. Auch nächtliche Blutzuckerkontrollen wurden gemeinsam durchgeführt – immer mit dem Ziel, Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu fördern.
„Wir erleben in jedem Camp, wie die Kinder Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen – und wie sie dabei über sich hinauswachsen,“ sagt Dr. Marina Sindichakis, Oberärztin und Leiterin der Kinderdiabetologie am Klinikum Traunstein. „Wenn ein Kind am dritten Tag ganz selbstverständlich seine Insulinpumpe bedient oder anderen hilft, ein erstes Mal ihren Insulinkatheter ohne die Eltern zu wechseln, dann ist das ein echter Entwicklungssprung – medizinisch und emotional. Diese Patientenschulungen sind in der S3 Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin auch ausdrücklich empfohlen und umso wichtiger sind altersgerechte Schulungskonzepte.“ Sie ergänzt: „Deutschlandweit betrachtet ist die Zahl dieser Schulungen für die Kinder jedoch besorgniserregend zurückgegangen. Umso wertvoller ist es, dass wir im Klinikum Traunstein als eine der wenigen Kinderdiabetologien in Deutschland diese Diabetescamps etablieren und weiterausbauen konnten. Das war und ist nur durch das besondere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich, die alle mit Herzblut dabei sind.“
Stärkung von Akzeptanz und Gemeinschaft
Besonders wertvoll war für viele Kinder der Erfahrungsaustausch mit Gleichaltrigen. Das Beobachten, wie andere mit ihrer Erkrankung umgehen, stärkt nachweislich die Krankheitsakzeptanz und das Selbstbewusstsein. Die Kinder erlebten: „Ich bin nicht allein – andere erleben das Gleiche wie ich.“
„Die Kinder mit Diabetes haben jeden Tag mit Themen wie Insulin und Blutzucker zu tun. Das ist eine große Aufgabe, die zu bewältigen ist – ein ganzes Leben lang. Neue Technologien wie Insulinpumpen und Blutzuckersensoren haben hier immense Fortschritte gebracht, aber die Technologie muss auch verantwortungsvoll bedient werden. Die gemeinsamen Diabetesschulungen sind wichtig, auch weil die Kinder lernen, dass sie nicht allein mit ihrem Diabetes sind“ betont Prof. Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Traunstein.
Die Kinderklinik Traunstein ist eines der führenden Zentren für Kinder mit Diabetes Typ 1 in Südostbayern und engagiert sich seit vielen Jahren in innovativen Schulungs- und Betreuungskonzepten für junge Patientinnen und Patienten und deren Familien. Die Kinderklinik Traunstein bietet diese Patientenschulungen als eine der wenigen deutschen Kinderdiabetologien an. Oberärztin Dr. Marina Sindichakis, die Leiterin der Kinderdiabetologie, ist auch an einer internationalen Publikation über Folgeschulungen für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus Typ 1 beteiligt, die gemeinsam mit der Uni Witten-Herdecke sowie den Kliniken Charite, Mergentheim, Leipzig erstellt wird. Außerdem nimmt sie teil am Innovationsfonds-Antrag GaDiaKi („Ganzheitliche interdisziplinäre medizinische Diabetes-Gruppenschulungen für Kinder und Jugendliche mit Typ 1-Diabetes in einem kindgerechten lebenswelt-orientierten Setting“).
15.10.2025 - Kliniken Südostbayern
Früher erkennen, gezielter behandeln
Brustkrebs muss heutzutage kein Todesurteil mehr sein

Die rosa Schleife, international genannt „Pink Ribbon“ ist das Symbol für Brustkrebs. Sie soll im Brustkrebsmonat Oktober daran erinnern, dass Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland ist. Jedes Jahr trifft es rund 70.000 Patientinnen. Doch je früher die Diagnose, desto größer die Chancen auf Heilung.
Zum Brustkrebsmonat 2025 möchte Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern, allen Frauen die Vorsorge ans Herz legen: „Früherkennung rettet Leben, denn Brustkrebs ist heute kein Todesurteil mehr, dem man wehrlos ausgeliefert ist. Wir haben hervorragende Möglichkeiten der Vorsorge, Früherkennung und Therapie. Aber sie müssen genutzt werden.“ mehr...
Vorsorge: Verantwortung in eigener Hand
Der erste Schritt beginnt im Alltag. Frauen, so betont Prof. Dr. Schindlbeck, sollten ihre Brust regelmäßig selbst abtasten: „Niemand kennt den eigenen Körper so gut wie man selbst. Veränderungen fallen oft zuerst der Frau selbst auf.“ Ab dem 30. Lebensjahr übernehmen Krankenkassen jährliche Vorsorgeuntersuchungen in der frauenärztlichen Praxis: „Die erste Anlaufstation sollte auf jeden Fall immer die eigene Frauenärztin oder der eigene Frauenarzt sein, denn dort ist die Geschichte der Patientin bekannt und es können die geeigneten Schritte eingeleitet werden.“ Ab 50 bis 75 Jahren können Frauen auch am bundesweiten Mammographie-Screening teilnehmen. „Die Mammographie ist definitiv die sensitivste und wichtigste Vorsorge-Maßnahme.“ ergänzt er.
Zertifiziertes Brustkrebszentrum am Klinikum Traunstein
Wenn Frauen eine Brustkrebsdiagnose erhalten haben, können sie im zertifizierten Brustkrebszentrum der Frauenklinik im Klinikum Traunstein Gewissheit finden. Hier wird moderne Diagnostik mit schonender Therapie verbunden.
Dazu zählen unter anderem:
- Brustsprechstunde mit spezialisiertem Ultraschall
- Stanzbiopsien unter örtlicher Betäubung
- Ggf. Mammographie und Kernspintomographie durch die Radiologie
- Operative Therapie unter Anwendung immer schonenderer Verfahren
- Besprechung und Planung der Therapie einschließlich genetischer Untersuchungen
Der Ablauf ist streng nach den neuesten wissenschaftlichen Standards organisiert – und interdisziplinär abgestimmt. „Wir arbeiten dabei unter dem Dach unseres zertifizierten Onkologischen Zentrums am Klinikum Traunstein Hand in Hand mit anderen Fachbereichen – Gynäkologie, Radiologie, Pathologie, Onkologie und plastische Chirurgie. Jede Frau profitiert von unserem gesamten Fachwissen, denn für jede Patientin wird in der wöchentlichen interdisziplinären Tumorkonferenz die optimale Behandlungsstrategie festgelegt.“, erklärt Prof. Dr. Schindlbeck.
Therapie: Möglichst schonend, höchst wirksam
Die Zeiten radikaler Brustamputationen sind weitgehend vorbei. Heute werden bei über 70 Prozent der Patientinnen brusterhaltende Operationen (BET) durchgeführt. „Unser Ziel ist Heilung, ohne die Brust abzunehmen. Dank neuer Techniken können wir die Brustform oft bewahren oder rekonstruieren“, so Prof. Dr. Schindlbeck. Das Spektrum reicht von minimalinvasiven Eingriffen bis zu komplexen plastisch-rekonstruktiven Verfahren in Zusammenarbeit mit der Plastischen Chirurgie im Hause – einschließlich Eigengewebs- oder Implantat-Rekonstruktionen. Auch Narbenkorrekturen und Korrekturen bei Schlupfwarzen gehören dazu.
Ein Zentrum, das begleitet
Aber medizinische Exzellenz allein reicht nicht. Brustkrebs bedeutet auch Angst, Unsicherheit, Einschnitte ins Leben. Deshalb legt das Klinikum Traunstein Wert auf persönliche Begleitung: Psychoonkologen, spezialisierte Pflegekräfte und Sozialdienste stehen an der Seite der Patientinnen. „Es geht nicht nur darum, den Krebs zu bekämpfen. Es geht darum, den Menschen zu sehen“, sagt Prof. Dr. Schindlbeck „Wir wollen unseren Patientinnen Hoffnung geben – und die Zuversicht, dass sie nicht allein sind.“ Aber er mahnt auch eindringlich: „Jede Frau hat die Chance, durch Vorsorge ihr Risiko zu senken. Nutzen Sie sie. Ein paar Minuten Aufmerksamkeit können Ihr Leben retten.“
25.09.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Im Ernstfall bestens versorgt
Unfallchirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall erneut als „Lokales Traumazentrum“ zertifiziert

Der Fachbereich Unfallchirurgie / orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall ist erfolgreich re-zertifiziert worden als „Lokales Traumazentrum“ im Traumanetzwerk der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Das ist keine bloße Urkunde für die Wand, sondern ein Vertrauensnachweis: Wer nach einem schweren Unfall im Landkreis schnelle Hilfe braucht, darf sich hier auf zertifizierte medizinische Standards verlassen. mehr...
Dazu gehört, dass rund um die Uhr ein spezialisiertes Notfall-Team bereitsteht – von der Erstversorgung über Not-OPs bis zur stabilisierenden Intensivmedizin. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Allgemeinchirurgie und der Inneren Medizin wird das Behandlungsspektrum im Bereich der Notfallbehandlung vervollständigt. Dafür sind festgelegte Abläufe notwendig, regelmäßige Fortbildungen und geprüfte Ausstattung. „Das Zertifikat zeigt: Wir können Schwerverletzten in unserer Region jederzeit auf höchstem Niveau helfen“, sagt Dr. Florian Zoffl, Leitender Arzt der Unfallchirurgie. „Und das gibt Sicherheit – für Patienten und Angehörige.“
Enge Zusammenarbeit zwischen den Standorten
In enger Zusammenarbeit mit der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein als zertifiziertem Überregionalem Traumazentrum werden die Patientinnen und Patienten, auch mit schweren Mehrfachverletzungen, wohnortnah optimal versorgt, erklärt Dr. Zoffl: „Die gute Kooperation mit Prof. Dr. Gelse und seinem Team von der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein ist auch deswegen so wertvoll, weil die Unfallchirurgie hier in Bad Reichenhall sehr eng mit dem Klinikum Traunstein als zugelassene SAV-Klinik für die Behandlung von Arbeitsunfällen mit schwersten Verletzungen zusammenarbeitet. Besonders im Bereich meines Schwerpunktes, der Wirbelsäulenchirurgie, kann ich auf eine optimale Kooperation mit dem Wirbelsäulenzentrum von Prof. Dr. Gelse zurückgreifen.“
Für die Menschen im Landkreis bedeutet das: maximale Versorgungssicherheit, ohne nach München oder Salzburg verlegt werden zu müssen. Für die Ärzte heißt es: Wissen bündeln und Kräfte vernetzen, denn im Ernstfall zählt für die Patienten jede Minute – und in Bad Reichenhall gilt jetzt erneut amtlich: Hilfe kommt sofort, auf höchstem Niveau.
24.09.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Moderne Brustkrebstherapien: individuell statt radikal
Vortrag aus der Gesundheit AKTIV-Reihe

Früher bedeutete Brustkrebs oft die Entfernung der ganzen Brust und belastende Standardtherapien. Heute stehen Patientinnen schonendere und individuellere Möglichkeiten offen: von brusterhaltenden Operationen über gezielte Bestrahlung bis hin zu modernen Medikamenten. Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenkliniken Klinikum Traunstein und Bad Reichenhall, erklärt wie diese Fortschritte die Lebensqualität verbessern und warum die Heilungschancen so gut sind wie nie zuvor. mehr...
Wenn Sie an die heutigen Brustkrebstherapien denken, was hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren am meisten verändert?
Die Behandlung ist insgesamt viel schonender geworden. Früher wurden oft die gesamte Brust und viele Lymphknoten entfernt, mit deutlichen Folgen. Heute stehen uns präzisere Diagnosen, neue Operationsmethoden und moderne Medikamente zur Verfügung. Wichtig ist auch, dass wir Entscheidungen nicht mehr allein treffen, sondern gemeinsam mit den Patientinnen.
Wie oft können Sie heute brusterhaltend operieren – und welche Optionen der Wiederherstellung gibt es, wenn die Brust dennoch entfernt werden muss?
In etwa 80 Prozent der Fälle ist eine brusterhaltende Operation möglich. Durch spezielle Techniken lässt sich die Brust so umformen, dass trotz Tumorentfernung ein harmonisches Ergebnis entsteht. Bei Bedarf gleichen wir die Gegenseite an. Manchmal ist es jedoch sinnvoll, die gesamte Brust zu entfernen, etwa wenn der Tumor sehr groß ist oder bei ausgedehnten Vorstufen. Auch dann gibt es gute Möglichkeiten der Wiederherstellung: Häufig können wir Haut oder sogar die Brustwarze erhalten und die Brust im selben Eingriff mit Implantat oder Eigengewebe aufbauen. Das wird individuell entschieden, die Kosten übernimmt die Krankenkasse.
Warum wird heute seltener die Achsel komplett operiert und was bringt das für die Patientinnen?
Der moderne Standard ist die Wächterlymphknoten-Biopsie: Wir entfernen gezielt die ersten ein bis zwei Lymphknoten, die den Abfluss aus der Brust übernehmen. Das ist viel schonender als früher die komplette Entfernung vieler Knoten und senkt das Risiko für Lymphödem, Taubheitsgefühle und Schmerzen.
Was bedeutet es für die Patientinnen, dass Bestrahlungen kürzer und gezielter geworden sind?
Früher mussten Frauen viele Wochen lang täglich zur Bestrahlung kommen. Heute können wir die Dauer deutlich verkürzen, manchmal auf nur drei bis vier Wochen, in Einzelfällen sogar auf wenige Sitzungen. Zudem bestrahlen wir gezielter: Oft reicht es, nur den Bereich um den ehemaligen Tumor herum zu behandeln. Deswegen erstellen wir vor jeder Therapie mit einer Computertomografie einen exakten Plan. Das schont gesundes Gewebe wie Herz oder Lunge und mindert Nebenwirkungen.
Wie entscheiden Sie heute, ob eine Patientin eine Chemotherapie braucht?
Ziel ist immer, das Risiko einer Streuung abzuschätzen. Wichtige Faktoren sind Alter, Tumorgröße, Lymphknotenbefall und die biologischen Eigenschaften des Tumors. Zusätzlich helfen manchmal genetische Tests am Tumorgewebe: Sie zeigen, ob eine Frau ein hohes oder niedriges Rückfallrisiko hat. Viele können dadurch sicher auf eine Chemotherapie verzichten.
Und wenn eine Chemotherapie notwendig ist, wie sieht sie heute aus?
Heute ist die Chemotherapie individueller und schonender. Manche Präparate wirken wie „Trojanische Pferde“: Sie transportieren den Wirkstoff gezielt in die Krebszelle. Dazu kommen Immuntherapien, die das Abwehrsystem stärken, und Medikamente, die das Wachstum bestimmter Tumorzellen bremsen. Wir können auch viele Nebenwirkungen deutlich besser kontrollieren, zum Beispiel Übelkeit oder allergische Reaktionen. Der Haarausfall bleibt allerdings Thema: Er entsteht, weil Chemotherapie auch gesunde Zellen angreift, die sich schnell teilen, wie Haarwurzeln. Rund 80 Prozent der Patientinnen sind betroffen. Mit Perückenversorgung oder Kühlkappen können wir hier zumindest etwas Entlastung schaffen.
Was geben Sie betroffenen Frauen neben der eigentlichen Therapie mit auf den Weg?
Bei den Kliniken Südostbayern legen wir Wert auf Begleitung, die über die reine Behandlung hinausgeht. Wir arbeiten mit Psycho-Onkologinnen, Sozialdiensten und Ernährungsberaterinnen zusammen und kooperieren eng mit Selbsthilfegruppen wie dem Verein „Gemeinsam gegen den Krebs“. Diese Angebote helfen, auch die psychischen und sozialen Belastungen besser zu bewältigen.
Welche Rolle spielt die Vorsorge?
Je früher ein Brustkrebs erkannt wird, desto schonender und erfolgreicher ist die Behandlung. Leider nimmt nur etwa die Hälfte der Frauen die Mammografie wahr, obwohl sie die zuverlässigste Methode ist, Brustkrebs frühzeitig zu entdecken. Das trägt entscheidend dazu bei, dass die 10-Jahres-Überlebensrate heute bei rund 85 Prozent liegt, vor 20 bis 30 Jahren waren es noch deutlich weniger. Brustkrebs ist also in den meisten Fällen kein Todesurteil mehr.
23.09.2025 - Kliniken Südostbayern
Erfolgreicher Abschluss der ATA-/OTA-Klasse
Erster staatlicher Abschlussjahrgang der Berufsfachschule für Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistenz
An der Berufsfachschule für Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistenz (ATA/OTA) der Kliniken Südostbayern (KSOB) hat der Jahrgang 2022-2025 Ende der vergangenen Woche seinen erfolgreichen Abschluss gefeiert. Es handelt sich um den ersten staatlich anerkannten ATA/OTA-Jahrgang seit Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen im Jahr 2022. mehr...
Erster staatlich anerkannter Jahrgang seit 2022
Die ATA/OTA-Schule der KSOB wurde zum 01. Oktober 2022 staatlich genehmigt. Mit dem Abschluss dieses Jahrgangs zeigt sich die erfolgreiche Umsetzung der neuen Ausbildungsrichtlinien und der Aufbau einer hochqualitativen Ausbildung im südostbayerischen Raum.
26 Absolventinnen – hohe Ausbildungsqualität
Der Abschlussjahrgang 2022–2025 besteht aus insgesamt 26 Absolventinnen, darunter 19 Operationstechnische Assistentinnen (OTA) und 7 Anästhesietechnische Assistentinnen (ATA). Mehrere Absolventinnen wurden für ihre herausragenden Leistungen zusätzlich mit 8 Staatspreisen (Nicole Wenger; Isabella Huber; Pia Kokott; Simone Loessl; Lilly Pankratz; Judith Schlacht; Liana Schneider; Evelyn Eder) ausgezeichnet.
Von den 13 Absolventinnen, die ihre Ausbildung an einer der zu den KSOB gehörenden Kliniken absolviert haben, bleiben 11 weiterhin im Klinikverbund tätig. Dieses Ergebnis unterstreicht die Attraktivität der Kliniken Südostbayern als Arbeitgeber und Ausbildungsstätte.
Starkes Netzwerk an Kooperationskliniken
Die Ausbildung an der Berufsfachschule für ATA/OTA der KSOB ist geprägt von einer engen Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerkliniken. Zum Kooperationsnetzwerk gehören:
- Kliniken Südostbayern (Klinikum Traunstein, Kreisklinik Bad Reichenhall, Fachklinik Berchtesgaden, Kreisklinik Trostberg)
- Klinikum Passau
- InnKlinikum Mühldorf am Inn / Altötting
- Schön Klinik Vogtareuth
- Rottal-Inn-Kliniken Eggenfelden
- Landkreiskliniken Passau - Krankenhaus Rotthalmünster
Über die Grenzen des Klinikverbundes hinaus besteht eine sehr gute und kollegiale Zusammenarbeit. Schüler*innen anderer Kliniken hospitieren regelmäßig an den KSOB-Standorten und profitieren so von einem regen Praxisaustausch.
Engagierte Dozenten und Praxisanleiter
Da die Ausbildung sowohl chirurgisch als auch anästhesiologisch stark geprägt ist, legt die Berufsfachschule für ATA/OTA großen Wert auf die enge Einbindung von Fachärzten und Praxisanleitern. Chirurgen, Anästhesisten und andere Dozenten unterrichten mit großem Engagement und tragen entscheidend zur hohen Qualität des Unterrichts bei. So werden die Auszubildenden optimal auf ihre zukünftigen Berufe vorbereitet.
Würdigung durch die Unternehmensleitung
KSOB-Vorstand Philipp Hämmerle würdigte im Rahmen der Abschlussfeier die besonderen Leistungen der Absolventinnen und betonte die Bedeutung der Berufsfachschule für die Gesundheitsversorgung in der Region. „Mit diesem ersten staatlich anerkannten Abschlussjahrgang setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der medizinischen Versorgung im südostbayerischen Raum. Wir freuen uns, dass so viele Absolventinnen dem Klinikverbund treu bleiben und ihr Wissen und Können in unseren Häusern einbringen werden“, so Hämmerle.
Steffen Köhler, Geschäftsbereichsleiter Personal und Bildung begrüßte alle anwesenden Gäste sowie die Vertreter der Kooperationskliniken und betonte die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Kliniken. Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie der KSOB, und Dunja Wondra, Pflegedienstleitung an der Kreisklinik Trostberg, würdigten die Leistungen der Absolventinnen.
Schulleitung Mariana Bilokapic wünschte den Absolventinnen für den weiteren Berufsweg alles Gute, Vertrauen in ihre umfassenden Fähigkeiten und weiterhin Einfühlungsvermögen, um die Patienten in ihren Arbeitsbereichen OP und Anästhesie auch künftig kompetent und menschlich zu versorgen.
23.09.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Großer Andrang beim Tag der offenen Tür in der Kreisklinik Bad Reichenhall
Besonderer Fokus: 20 Jahre Palliativstation
Ein buntes, informatives und familienfreundliches Programm lockte am Samstag mehr als 500 Gäste in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Unter dem Motto „Moderne Medizin hautnah für die ganze Familie“ präsentierten die Kliniken Südostbayern (KSOB) die vielfältigen Facetten der Kreisklinik. Führungen, Mitmachaktionen und zahlreiche Infostände gaben spannende Einblicke in den Klinikalltag und zeigten die umfassende medizinische Versorgung, die der Bevölkerung tagtäglich zur Verfügung steht. mehr...
20 Jahre Palliativstation – im Dienst der Menschlichkeit
Einen besonderen Stellenwert hatte dabei das 20-jährige Jubiläum der Palliativstation. Seit zwei Jahrzehnten begleitet das engagierte Team Patientinnen und Patienten mit weit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankungen. Ihr Leitgedanke „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben“ prägt die Arbeit bis heute.
Im Zentrum der Palliativmedizin stehen Schmerztherapie, Symptomkontrolle und spezialisierte Pflege, die das Wohlbefinden fördern und Lebensqualität erhalten. Dabei werden neben körperlichen Beschwerden auch psychische, soziale und spirituelle Bedürfnisse von Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen berücksichtigt. Die Einbindung von Hausärzten, Angehörigen und ehrenamtlichen Helfern gehört zum festen Begleitkonzept.
Medizin zum Anfassen – Programm für alle Generationen
Die Besucherinnen und Besucher des Tags der offenen Tür konnten weitere Einblicke in die Vielfalt der medizinischen Versorgung am Standort erleben. Das Programm bot neben Einblicken in modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden auch gleichzeitig Unterhaltung für die ganze Familie:
- Führungen durch Endoskopie, Herzkatheter, die Palliativstation und den Kreißsaal
- Mitmachstationen, z. B. Reanimationstraining
- Ausstellungen von Gefäßprothesen in der Gefäßchirurgie
- Informationsstände zu zahlreichen Gesundheitsthemen
- Kinderprogramm mit Hüpfburg, Clowns, Kinderschminken und Selfie-Box
- Präsentation von Einsatzfahrzeugen des BRK
Die Mischung aus Information, Erlebnis und Unterhaltung machte den Tag der offenen Tür zu einem gelungenen Fest für Jung und Alt. „Es war eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung, bei der wir das breite Leistungsangebot der Kreisklinik Bad Reichenhall auf vielfältige Weise sichtbar machen konnten“, betonte KSOB-Vorstand Philipp Hämmerle. „Mein Dank gilt allen Beteiligten – was hier tagtäglich geleistet wird, ist beachtlich: eine Rundumversorgung an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Ein wichtiges Beispiel ist die Palliativstation, die nun auf 20 Jahre wertvoller Arbeit zurückblicken kann.“
Starke medizinische Versorgung für die Region
Die Kreisklinik Bad Reichenhall ist ein zentraler Baustein der Gesundheitsversorgung im Berchtesgadener Land. Als Haus der Grund- und Regelversorgung mit hoher fachlicher Expertise ist sie eng vernetzt mit den anderen Standorten der KSOB – insbesondere mit der Fachklinik Berchtesgaden und dem Schwerpunktversorger in Traunstein. Erfolgreich zeigt sich dies etwa in der engen Zusammenarbeit zwischen der Unfallchirurgie in Bad Reichenhall und der Akutgeriatrie in Berchtesgaden, die eine optimale Versorgung älterer Patientinnen und Patienten ermöglicht.
Zu den medizinischen Fachbereichen der Kreisklinik Bad Reichenhall zählen unter anderem:
Pneumologie, Gastroenterologie und Diabetologie, Kardiologie, Urologie, Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe, Allgemein- und Viszeralchirurgie inkl. Hernienzentrum, Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie, Palliativmedizin, Neurologie mit Stroke Unit, Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie das Schlaflabor. Die Zentrale Notaufnahme ist 24/7 die erste Anlaufstelle für Notfälle im gesamten Landkreis.
22.09.2025 - Kliniken Südostbayern
Machen Sie Ihre Herzgesundheit zur Prio 1
Die „Big Five“ der Risikofaktoren sind gut zu beeinflussen

Wir planen Urlaube, kaufen das neueste Smartphone, investieren in unser Haus, oder kaufen uns ein neues Auto. Aber wie oft investieren wir bewusst in das, was uns am Leben hält – in unsere Herzgesundheit?
Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache – auch in Deutschland. Oft treffen ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall die Menschen mitten im Leben, plötzlich und unerwartet. Was viele nicht wissen: ... mehr...
Die Erkrankungen, die diesen Ereignissen zugrundeliegend, entstehen meist nicht plötzlich, sondern sie entwickeln sich über Jahre hinweg – oft unbemerkt. Erste Warnzeichen werden übersehen und die Risikofaktoren unterschätzt. Zu hohe Blutzuckerwerte gehen dabei oft Hand in Hand mit Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten und Übergewicht. Diese Stoffwechselstörungen werden unter dem Begriff „Metabolisches Syndrom“ zusammen gefasst.
Mit den sogenannten „Big Five“ sind die fünf beeinflussbaren Risikofaktoren gemeint, die unser Herz belasten und gefährden: Bluthochdruck, Rauchen, hohes Cholesterin, Diabetes und Übergewicht. Diese „Big Five“ lassen sich frühzeitig erkennen – und vor allem: gut beeinflussen. Wir sprechen mit Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Südostbayern, über diese fünf Risikofaktoren und wie man sie vermeiden kann.
Nr. 1 in der Reihe ist Bluthochdruck. Wie ist dessen Einfluss auf die Herzgesundheit?
Prof. Dr. Lehrke: Bluthochdruck ist weltweit der häufigste und relevanteste kardiovaskuläre Risikofaktor. Bluthochdruck schädigt unbemerkt die Gefäßwände und erhöht drastisch das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden. Medikamente gehören zur Basistherapie von Bluthochdruck. Die Einnahme von Blutdrucksenkern, also Antihypertensiva, wird (spätestens) ab Blutdruckwerten von 140/90 mmHg empfohlen, insbesondere, wenn mit einer Lebensstil-Optimierung der Blutdruck nicht ausreichend gesenkt werden kann. Ziel ist es, damit Blutdruckwerte zwischen 120-129/70-79 mmHg zu erreichen.“
Ein großer Faktor ist das Rauchen, richtig?
Prof. Dr. Lehrke: Rauchen verengt die Blutgefäße, beschleunigt die Gefäßverkalkung und erhöht den Blutdruck – das macht dann Herzinfarkte und andere schwere Folgeerkrankungen wie COPD und pAVK wahrscheinlicher und verkürzt die Lebenszeit. Auch wenn viele Raucherinnen und Raucher es häufig nicht wahrhaben wollen: Von allen Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen und Herzinfarkt hat Rauchen die größte Bedeutung.
Die gute Nachricht: Selbst hartnäckige Raucher, die eine jahrzehntelange Raucherkarriere hinter sich haben, profitieren vom Rauchstopp. So sinkt das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, bereits nach fünf Jahren um fast die Hälfte. Ein Nikotinverzicht ab dem Alter von 60 Jahren verlängert statistisch gesehen das Leben um drei Jahre. Ab einem Alter von 50 sind es sechs und ab 40 Jahren sogar etwa neun Lebensjahre. Und: Bereits drei Monate nach dem Aufhören kann sich die Lungenkapazität um bis zu 30 Prozent erhöhen.
Ein Umstieg auf E-Zigaretten ist dabei nicht sinnvoll, denn Nikotin wird ja ebenso inhaliert – hinzu kommt, dass die Liquids und das Aerosol einiger E-Zigaretten krebsauslösende Stoffe enthalten. Auch Pfeifen- oder Zigarrenraucher haben ein stark erhöhtes Risiko, sowohl für COPD als auch für Krebs der Mundschleimhäute, der oberen Luft- und Speiseröhre sowie des Rachens.
Der Dritte im Bunde ist hohes Cholesterin. Wie kann man diesen Risikofaktor beeinflussen?
Prof. Dr. Lehrke: Zu hohe Cholesterinwerte fördern Ablagerungen (Plaques) in den Arterien – das kann sie stark verengen. Das ist typisch bei einer koronaren Herzkrankheit (KHK), der häufigsten Ursache für einen Herzinfarkt oder plötzlichen Herztod. Reißen zum Beispiel die sogenannten atherosklerotischen Plaques, kann sich ein Blutgerinnsel bilden und ein Herzgefäß komplett verschließen.
Das schlechte Cholesterin, dass in so genannten LDL-Partikeln transportiert wird, lässt sich nur sehr begrenzt über eine Diät oder Lebensstilmodifikation senken (etwa 10%) und bedarf bei zu hohen Werten zumeist einer medikamentösen Therapie. Andere Lipide, wie zum Beispiel erhöhte Triglyceride, sprechen jedoch sehr gut auf eine Diät und Lebensstiländerungen an.
Drei Tipps, wie Sie Ihr Cholesterin und andere Blutfette positiv beeinflussen und ihre Gefäßgesundheit verbessern:
1. Stellen Sie Ihre Ernährung um – frisches Gemüse, Obst, Salate, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Fisch, Nüsse, Kräuter und gesunde pflanzliche Öle wie Olivenöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl.
2. Wenn eine Therapie mit Medikamenten notwendig ist, stellen Statine die Therapie der ersten Wahl dar. Sie gehören bei einem zu hohen LDL-Cholesterinspiegel zu den wichtigsten Cholesterinsenkern. Statine hemmen die körpereigene Bildung von Cholesterin. Leber und Zellen nehmen in Folge mehr LDL-Cholesterin aus dem Blut auf.
3. Hören Sie auf zu rauchen, verzichten Sie auf Alkohol und streben Sie eine Gewichtsreduktion durch regelmäßige Bewegung an. 30 bis 45 Minuten pro Tag Nordic Walking und Fahrrad fahren, aber auch Laufen, Schwimmen oder Tanzen sind gute Betätigungen. Wenn Sie bisher nicht sehr aktiv waren, beginnen Sie mit zügigen Spaziergängen.
Übergewicht und Adipositas stehen ebenfalls in der Reihe der „Big Five“. Was raten Sie Menschen, die abnehmen wollen?
Prof. Dr. Lehrke: Vor allem jüngere Erwachsene mit Adipositas im Alter zwischen 18 bis 29 Jahren haben ein erhöhtes Risiko, am metabolischen Syndrom zu erkranken; auch mäßiges Übergewicht mit einem BMI ab 25 kann bereits zu Stoffwechselstörungen führen. Mit steigendem BMI und zunehmenden Alter wird es immer wahrscheinlicher, ein metabolisches Syndrom zu entwickeln. Gewicht zu reduzieren ist daher die wirksamste Maßnahme, alle Komponenten des metabolischen Syndroms gleichzeitig zu verbessern.
Weniger Energie/Kalorien zu sich zu nehmen, als der Körper benötigt, ist für den Abnehmerfolg ein Schlüsselfaktor. Am besten ist es, sich an den Empfehlungen der Deutschen Adipositas-Gesellschaft zu orientieren. Hier heißt es, dass Abnehmwillige – um nicht zu schnell, sondern gesund abzunehmen – eine tägliche Energiereduktion um etwa 500 kcal/Tag – in Einzelfällen auch höher – anstreben sollten.
Die eigentliche Schwierigkeit ist aber, das niedrigere Gewicht zu halten, denn das nach einer erfolgreichen Diät strebt der Körper eine Rückkehr zum Ausgangsgewicht an, sodass eine anhaltend geringere Kalorienzufuhr anzustreben ist. Dies gelingt am besten mit der Formel „nicht weniger, sondern anders essen“. Und auch hier ist wieder moderater Sport, also Schwimmen, Radfahren, Gerätetraining oder Nordic Walking eine gute Ergänzung.
Diabetes ist ja ebenfalls ein Risikofaktor. Was raten Sie den Menschen, die an Diabetes erkrankt sind?
Prof. Dr. Lehrke: Diabetes mellitus, umgangssprachlich bekannt als Zuckerkrankheit, ist eine Stoffwechselstörung. Es gibt verschiedene Diabetes-Typen. Am häufigsten Diabetes mellitus Typ 2, der zusammen mit dem Metabolischen Syndrom auftritt. Davon zu unterscheiden ist der Typ-1-Diabetes, der zumeist im Kindes- und Jugendalter als Folge einer Autoimmunerkrankung auftritt, bei der die Insulin produzierenden Zellen zerstört werden. Beim Typ-2-Diabetes hingegen, früher als Altersdiabetes bezeichnet, geht die Empfindlichkeit der Zellen für das vom Körper gebildete Insulin verloren, sodass trotz vermehrter Insulinausschüttung der Blutzucker ansteigt.
Zu viel Zucker im Blut, wie es bei Diabetes typisch ist, schädigt dann auf mehreren Wegen langfristig Blutgefäße und Nerven. Dies fängt zumeist schon im Vorstadium eines Diabetes an und sollte daher frühzeitig erkannt und behandelt werden. Ein geringerer Verzehr von süßen Speisen und Getränken ist eine wichtige Maßnahme, um den Blutzucker zu senken. Zu den bedeutendsten Risikofaktoren für Diabetes mellitus Typ 2 gehören: Übergewicht (vor allem Fettgewebe im Bauchraum: viszerales Fett), Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung.
Bei Diabetikern müssen die Nierenwerte stets gut kontrolliert werden. Denn auch dieses Organ leidet bei zu hohen Zucker- und Blutdruckwerten. Eine kranke Niere wiederum begünstigt Herzerkrankungen.
Was ist Ihr Fazit?
Prof. Dr. Lehrke: Wer heute handelt, kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen aktiv vorbeugen – und gewinnt das Wertvollste zurück: mehr gesunde Lebensjahre.
Vielleicht noch ein Hinweis: Wenn die Leserinnen und Leser Fragen zur Herzgesundheit an mich haben, finden Sie mich zusammen mit meinen Kollegen von der Inneren Medizin am Samstag, 4. Oktober auf dem Stand der Kliniken Südostbayern in Halle 9 der TRUNA-Messe in Traunstein. An den anderen Tagen stehen meine Kolleginnen und Kollegen von der Geriatrie, der Alterstraumatologie und der Schmerztherapie (1.10.), der Gefäßchirurgie (2.10), der Viszeralchirurgie, des Viszeralonkologischen Zentrums und des Psychologischen Dienstes (3.10.) sowie der Kinderklinik mit Kinderintensiv und der Frauenklinik mit Brustzentrum (5.10) für die Fragen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.
18.09.2025 - Klinikum Traunstein
Zwei Geburtstagsfeiern für Zwillinge
Die Zwillings-Frühchen suchen sich je ihr eigenes Geburtsdatum aus
Das Kinderzimmer war zwar noch nicht ganz fertig, aber die beiden Mädels wollten trotzdem schon auf die Welt kommen. Früher als ursprünglich geplant, nämlich schon in der 35. Schwangerschaftswoche, kam Mutter Adelina Dietlmeier in Begleitung ihres Mannes Peter morgens am 13. September ins Klinikum Traunstein – die Fruchtblase war geplatzt. mehr...
Noch am selben Tag wurde um 23.56 Uhr Liya Mirella, die „Ältere“ der beiden Mädchen, mit einem Geburtsgewicht von 2115 Gramm und 42 cm geboren. Dann, eben am folgenden 14. September, erblickte um 00.03 Uhr Amelie Grace mit 2575 Gramm und ebenfalls 42 cm das Licht der Welt. Prof. Dr. Schindlbeck freut sich, dass es allen gut geht: „Beide Mädchen legen sehr gut an Gewicht zu und sind trotz des verfrühten Geburtstermins fit und munter. Es war gut, dass die Eltern gleich zu uns gekommen sind, denn wir im Mutter-Kind-Zentrum Level I am Klinikum Traunstein versorgen alle kleinen Frühchen und Risikogeburten aus den Landkreisen Traunstein, Mühldorf, Altötting und Berchtesgadener Land.
Um das Wohlergehen kümmert sich auch die Kinderpflegerin Laura Schneider, die für Mutter und Kinder da ist und sie liebevoll umsorgt.
Ob die beiden Mädels an einem Tag Geburtstag feiern wollen, oder ob jede auf einer eigenen Feier besteht, wird sich zeigen. Spoiler: das Kinderzimmer ist jetzt fertig.
15.09.2025 - Klinikum Traunstein
Telefonaktion „Wenn der Schmerz zu viel wird“

In einer Telefonaktion am 24. September 2025 von 9 Uhr bis 10:30 Uhr steht Richard Strauss, Leitender Arzt der Multimodalen Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg, Anruferinnen und Anrufern für Fragen zu ihren Schmerzen und den Problemen damit zur Verfügung. Die Telefonnummer ist 0862187-1290. mehr...
Richard Strauss ist ein erfahrener Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, und ist Experte für interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie.
Die multimodale Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg kombiniert medizinische, physiotherapeutische und psychologische Maßnahmen. Ziel ist es, nicht nur die Schmerzursache zu behandeln, sondern auch den Umgang der Patientinnen und Patienten mit dem Schmerz zu verbessern. Das interdisziplinäre Team aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen, Therapeutinnen und Pflegekräften arbeitet dabei eng zusammen. Jeder Behandlungsplan wird individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt. Regelmäßige Gespräche, Bewegungstherapien und Entspannungsverfahren ergänzen die medikamentöse Behandlung. So wird eine nachhaltige Schmerzlinderung und eine Steigerung der Lebensqualität angestrebt.
11.09.2025 - Klinikum Traunstein
Wir sind für die Familien da: Frühchenversorgung mit Technik und Herz
Zum Welttag der Patientensicherheit

Unter dem Slogan „Patientensicherheit von Kind an – eine Investition fürs Leben“ steht heuer der Welttag der Patientensicherheit im September. Für Frühchen ist diese „Investition fürs Leben“ sprichwörtlich: denn sie brauchen die beste Versorgung für ihren Start ins Leben. mehr...
Es passiert unerwartet. Der Bauch spannt, die Wehen setzen ein – und plötzlich wird aus neun Monaten Vorfreude eine Entscheidung über Leben und Überleben. Frühgeburt: ein Wort, das Eltern erschreckt. Doch es ist eine Herausforderung und eine Chance – für Kind und Eltern gleichermaßen. Zum Welttag der Patientensicherheit haben wir gesprochen mit Prof. Dr. Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, und Prof. Dr. Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, über Frühchen und was sie brauchen. Die Kinderklinik und die Frauenklinik bilden das Perinatalzentrum Level I am Klinikum Traunstein.
Herr Professor Wolf, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Baby zu früh kommt?
Wolf: Eine Frühgeburt liegt vor, wenn ein Kind vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickt. In Deutschland sind das etwa 65.000 Babys jedes Jahr. Je früher ein Kind geboren wird, desto unreifer sind Organe und Körperfunktionen. Das bedeutet: Herz, Lunge, Darm, ja selbst die Haut müssen unterstützt werden. Aber: Medizin und Pflege haben enorme Fortschritte gemacht. Selbst die ganz Kleinen unter 500 Gramm Gewicht haben heute Chancen, gesund groß zu werden – und darauf sind wir hier im Perinatalzentrum I am Klinikum Traunstein spezialisiert. Wenn Babys und speziell Frühgeborene Babys in einem Level I Perinatalzentrum zu Welt kommen, ist die gesamte Versorgung gewährleistet. Das Baby muss nicht mehr in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, alle Spezialisten sind bereits vor Ort.
Herr Prof. Dr. Schindlbeck, viele Eltern sind unsicher und fragen sich, warum gerade ihr Kind zu früh kommt.
Schindlbeck: Das ist ein Schmerz und Fragen, die wir oft erleben. Aber es ist ein Trugschluss: Eine Frühgeburt ist kein Versagen, da gibt es keine Schuld. Die Ursachen sind vielfältig – Infektionen, Mehrlingsschwangerschaften, Stress, manchmal auch Gründe, die wir nicht kennen. Eltern sollten in dieser Situation nicht die Schuld bei sich suchen, sondern auf die Stärke vertrauen, die wir ihnen geben können. Und das tun wir, indem wir sie von Beginn an einbinden. Wir versuchen im Perinatalzentrum Traunstein immer, so lange es geht eine Frühgeburt zu verhindern und die Schwangerschaft zu verlängern. Dabei sind wir auch sehr erfolgreich.
Was können Sie konkret tun, wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt?
Wolf: Bei uns im Perinatalzentrum Level I am Klinikum Traunstein arbeiten Expertinnen und Experten für Geburtsmedizin, Neonatologie, Kinderchirurgie, Anästhesie sowie Pflegekräfte, Psychotherapeutinnen und Physiotherapeuten Schulter an Schulter und Hand in Hand – rund um die Uhr. Die Technik ist auf höchstem Niveau – Inkubatoren, Beatmungsgeräte, feinste Überwachungsmonitore und auch ganz spezielle Geräte für Frühgeborene, wie der Concord Birth Trolley. Das ist ein Versorgungstisch, auf dem das Frühgeborene direkt bei der Mutter stabilisiert und ggf. beatmet werden kann, während es noch an der Nabelschnur ist. Solche Einrichtungen haben nur ganz wenige Kliniken in Deutschland. Das Entscheidende ist: Wir schaffen Nähe. Frühgeborene brauchen Wärme, Körperkontakt, Herzschlag. Deshalb setzen wir auf das sogenannte ‚Känguruhen‘. Mutter oder Vater kuscheln mit dem Baby und hierbei ist wichtig: „Haut auf Haut“. Das stabilisiert Puls und Atmung – und gibt die Geborgenheit, die kein Gerät ersetzen kann und die gerade ein Frühchen dringend braucht. Wichtig ist auch die Präsenz der Kinderchirurgie in Traunstein: ein Team von fünf Kinderchirurgen, unter der Leitung von Dr. Marc J. Jorysz und Dr. Bernd Geffken, steht rund um die Uhr bereit, wenn das Frühgeborene operiert werden muss.
Viele Eltern fürchten sich: So klein, so zerbrechlich, wie kann ich meinem Baby nahe sein?
Wolf: Nähe und erster Hautkontakt sind absolut unverzichtbar! Natürlich vorsichtig, und wir in der Neonatologie sind 24 Stunden 7 Tage die Woche da, um die Eltern in genau diesen Momenten zu begleiten. Die Eltern erleben: Ich kann etwas für mein Kind tun. Nicht Pflegekraft und Arzt oder Ärztin allein, sondern auch die Mutter, der Vater sind es, die Nähe schenken können bei uns. Und diese Nähe wirkt wie Medizin. Studien zeigen: Frühchen, die viel Hautkontakt erleben, entwickeln sich oft besser, brauchen weniger Schmerzmittel und haben stabilere Kreisläufe.
Und wie früh können Eltern ihr Kind auf diese Weise unterstützen?
Wolf: Schon am Tag der Geburt. Wir versuchen, sofort die Eltern zur Erstversorgung dazu zu holen, meistens ist das der Papa, besonders wenn das Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Wir versuchen dann gleich mit Kind im Inkubator noch bei der Mama vorbeizuschauen. Die Pflege spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Unsere Kinderkrankenschwestern und -pfleger sind rund um die Uhr da und binden die Eltern mit ein. Selbst wenn Beatmungsschläuche und Kabel da sind – die Eltern sind von Anfang an dabei. Darauf legen wir ganz großen Wert, denn diese enge Elternbindung von Anfang an ist ein Fundament. Kinder, die früh Nähe erleben, entwickeln nicht nur bessere körperliche Stabilität, sondern auch emotionale Sicherheit. Und die Eltern gewinnen Vertrauen in sich und in ihr Kind. Dieses Gefühl trägt durch die Wochen auf der Intensivstation und darüber hinaus.
Welche Rolle spielt die Versorgung schon vor der Geburt?
Schindlbeck: Wenn sich eine Frühgeburt abzeichnet, können wir am Klinikum Traunstein die Mutter aufnehmen und überwachen. Wir von der Geburtsmedizin und das Team von Prof. Dr. Wolf von der Neonatologie arbeiten ganz eng zusammen, um die beste Versorgung für Mutter und Kind sicherzustellen. So können wir die Zeit bis zur Geburt etwas weiter verlängern, Medikamente zur Lungenreifung geben oder Infektionen behandeln. Jede Stunde im Mutterleib zählt – und doch ist manchmal der frühere Geburts-Zeitpunkt der bessere. Wichtig ist: diese Entscheidungen treffen wir immer gemeinsam mit den Eltern.
Ihr Perinatal-Zentrum ist wohnortnah für die Bevölkerung in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf. Was bedeutet das für die Familien?
Wolf: Es bedeutet schlicht: Sicherheit und Gewissheit. Selbst im unerwarteten Moment sind die Spezialistinnen und Spezialisten da, die wissen, was zu tun ist – wohnortnah. Keiner muss nach München, Passau oder Salzburg fahren, das ist im Zweifelsfall viel zu weit. Wir möchten den Menschen in Südostbayern mitteilen: Auch, wenn das Leben gerade anders läuft als geplant: Wir sind da, immer.
Neonatologie und Geburtshilfe auf der TRUNA
Sie können Prof. Dr. Gerhard Wolf und Prof. Dr. Christian Schindlbeck dort persönlich treffen und Fragen stellen: Am 5. Oktober in Halle 9 auf dem Stand der Kliniken Südostbayern.
An den anderen Tagen können Sie mit Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften aus diesen anderen Fachbereichen sprechen:
01.10. Geriatrie, der Alterstraumatologie und der Schmerztherapie
02.10. Gefäßchirurgie
03.10. Viszeralchirurgie und Viszeralonkologisches Zentrum sowie der Psychologische Dienst der Intensivstationen
04.10. Innere Medizin, Lungenzentrum
04.09.2025 - Kliniken Südostbayern
Letzte Chance: Hochpräzisions-Strahlentherapie
Die Diagnose: Ein Lungentumor verhindert die Behandlung einer schweren COPD und die eingeschränkte Lungenfunktion aufgrund der COPD verhindert die Behandlung des Tumors – Die Chance: Hochpräzisions-Strahlentherapie als Einzelfallentscheidung trotz höherem Risiko, um den fatalen Kreislauf zu durchbrechen. mehr...
Hias B. ist eine drahtige Erscheinung, wenn man ihn sieht. Aber der erste Eindruck täuscht: Der 58-Jährige hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich und tut sich schwer, eine weitere Strecke zu gehen, er bleibt immer wieder stehen, stützt sich auf und ringt nach Luft. Aber seine jetzige Verfassung ist auf jeden Fall besser als im Februar 2024, als er zum ersten Mal von Dr. Danijel Jelusic, niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie in Traunstein, untersucht wird, denn da hat er bereits große Beschwerden. Dr. Jelusic beginnt die leitliniengerechte Basistherapie und überweist Hias B. im Verlauf zu Prof. Dr. Tobias Lange, Chefarzt der Pneumologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Dieser erinnert sich genau: „Die Diagnose war ‚Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) Stadium 4‘. In diesem Stadium – der schwersten Form der COPD – führen selbst einfache Tätigkeiten wie Anziehen oder Gehen zu schwerer Atemnot, die plötzliche Verschlechterung der Symptome kommt häufig vor und kann lebensbedrohlich sein.“
Der Plan: Lunge verkleinern, um wieder atmen zu können
Der Behandlungsansatz soll eine bronchoskopische Lungenvolumenreduktion sein, um das Atmen wieder zu verbessern. Hias B. setzt seine Hoffnungen auf diesen Eingriff: „Ich konnte absolut nichts mehr machen, meinen handwerklichen Beruf musste ich an den Nagel hängen, keine Chance. Die Verringerung des Lungenvolumens sollte es wieder richten, dass der gesündere Teil meiner Lunge wieder ordentlich arbeiten kann.“
Doch bei der vorbereitenden CT-Untersuchung im März 2024 wird ein runder Herd in seiner Lunge entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Herd einen Durchmesser von 8 mm, Hias B. hatte davon nichts bemerkt. Da der Herd zu klein ist für eine Biopsie und eine Operation aufgrund der schweren COPD nicht möglich, erfolgen zunächst weitere Kontrollen. Bei der zweiten CT-Untersuchung Mitte 2024 zeigt der Herd schon einen Durchmesser von 13 mm. Daraufhin wird im Oktober 2024 in der Kreisklinik Bad Reichenhall eine Biopsie des Herdes durchgeführt und ein bösartiges Karzinom mit einem Durchmesser von jetzt bereits 20 mm diagnostiziert. Bei dieser Untersuchung wird auch festgestellt, dass die Lunge voraussichtlich für eine Volumenreduktion geeignet ist, sie erfüllt die Vorbedingungen hierfür, also geschlossene Fissuren zwischen den Lungenlappen. Die schlechte Nachricht für Hias B.: Eine Reduktion des Lungenvolumens zur Eindämmung der COPD ist aufgrund des entdeckten Tumors ohnehin ausgeschlossen und eine operative Behandlung des Tumors ist nicht möglich aufgrund der COPD.
Auch eine Hochpräzisionsstrahlentherapie zur Behandlung des Tumors erscheint höchst kritisch, da hierfür eigentlich eine bessere Lungenfunktion unbedingt erforderlich wäre. Prof. Dr. Lange bespricht den Fall von Hias B. eingehend mit Priv.-Doz. Dr. Matthias Hautmann, Chefarzt der Strahlentherapie am Klinikum Traunstein. Nach genauem Abwägen kommen sie zu dem Schluss, dass für diesen Patienten eine spezielle Hochpräzisions-Strahlentherapie Besserung bringen kann – eine absolute Einzelfallentscheidung und durchaus risikobehaftet. Hias B. wird von Prof. Dr. Lange zur Besprechung dieser möglichen Hochpräzisions-Strahlentherapie an Priv.-Doz. Dr. Hautmann nach Traunstein überwiesen.
Ein Lungentumor verhindert die Behandlung
Priv.-Doz. Dr. Hautmann weiß noch: „Ich habe mit Hias B. die durchaus gegebenen Risiken besprochen, aber wir haben gemeinsam gesehen, dass in der atemgetriggerten, stereotaktischen Strahlentherapie seine einzige Chance besteht, wieder ein Leben ohne diese großen Einschränkungen zu führen. Hias B. war auch sofort bereit dazu, das zu machen, das stand für ihn außer Frage. Er war dann ab Dezember bei acht Sitzungen innerhalb von zwei Wochen bei uns. Aus heutiger Sicht bin ich wirklich sehr froh, dass wir miteinander einen guten Weg gefunden haben. Denn die Ausgangslage, dass eine COPD-Behandlung nicht möglich ist aufgrund einer anderen schwerwiegenden Tumor-Thematik, war schon herausfordernd. Und darum haben wir mit der speziellen Technik der atemgetriggerten Hochpräzisions-Bestrahlung den ersten, entscheidenden Schritt getan, um ihm eine weitere Therapie zu ermöglichen.“
Erfolg: Der Patient ist krebsfrei
Ende Dezember wird die Lungenfunktion getestet, diese ist nach der Strahlentherapie unverändert, was positiv ist. Die nächste CT im Klinikum Traunstein findet im Januar 2025 statt – mit gutem Ergebnis, wie Priv.-Doz. Dr. Hautmann erklärt: „Der Herd hatte sich verkleinert, die Bestrahlung hatte sehr gute Wirkung gezeigt. Der Vorteil für Hias B. war, dass er keinerlei Metastasen des Tumors in der Lunge hatte. Auch beim Kontroll-CT im März 2025 konnten wir feststellen, dass der Tumor sich weiter zusammengezogen hatte und nur noch ein narbiger Rest verblieben war, was für eine sehr positive Tendenz sprach. Wir haben Hias B. engmaschig weiterbetreut, er war aufgrund des hohen Risikos jede Woche zur Überwachung bei uns. Wir waren da auch mit Prof. Dr. Lange in Bad Reichenhall und seinem behandelnden Arzt, Dr. Jelusic, in ganz engem Kontakt. Und bei der letzten CT haben wir dann feststellen können: Der Tumor ist weg, der Patient ist krebsfrei. Das ist ein sehr großer Erfolg.“ Prof. Dr. Lange ergänzt: „Nur seine Hoffnung, dass jetzt gleich die Volumenreduktion durchgeführt werden kann, musste ich leider nach der erneuten Testung der Fissurendichte zwischen den Lungenlappen bremsen.“
Die Lunge spielt nicht mit
Hias B. geht im März 2025 wegen der COPD auf Reha, um auf diesem Wege eine Besserung der Lungenfunktion zu erreichen. Für weitere Untersuchungen dazu besucht er danach nochmals Prof. Dr. Lange in der Pneumologie in der Kreisklinik Bad Reichenhall und hat danach einen gemischten Blick auf seine Situation. Einerseits ist Hias B. sehr froh, dass der Tumor unter Kontrolle ist. Doch die vor einem Jahr noch geschlossenen Fissuren haben sich geöffnet, die Lungenvolumenreduktion kann deswegen nicht durchgeführt werden: „Manchmal kann ich ein oder zwei Kilometer gehen, manchmal schaffe ich es kaum vom Auto zur Haustür. Ich muss immer schauen, wo ich parken kann, damit ich nicht zu weit gehen muss. Ich bräuchte dringend eine neue Wohnung im Erdgeschoss, damit ich keine Treppen mehr laufen muss.“
Hias B. gibt nicht auf: „Ich bleib trotzdem dran und bleibe so gut es geht in Bewegung – weil, ohne wird es nur schlechter. Ich schnappe mir täglich meine Stecken und mach mich auf die Socken, es bleibt mir nichts Anderes übrig. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass Priv.-Doz. Dr. Hautmann so mutig war und die Bestrahlungen bei mir durchgeführt hat, denn ohne ginge es mir heute viel, viel schlechter.“
03.09.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
34 neue Auszubildende starten an der Berufsfachschule für Pflege in Bad Reichenhall

34 junge Menschen haben in diesen Tagen ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Pflege in Bad Reichenhall aufgenommen. Im Namen der Kliniken Südostbayern (KSOB) begrüßte Dajana Riske, Schulleiterin der Berufsfachschule, die angehenden Pflegefachfrauen und -männer herzlich an ihrem Ausbildungsort. mehr...
Die Auszubildenden bilden eine bunte und vielfältige Gruppe aus insgesamt 15 Nationen. Diese Internationalität spiegelt nicht nur die offene Willkommenskultur der Kliniken Südostbayern wider, sondern bereichert auch den Austausch und das Miteinander innerhalb der Klassen.
„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele junge Menschen für den Pflegeberuf entschieden haben. Mit ihrer Ausbildung leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in unserer Region – und zugleich ergreifen sie einen Beruf mit Zukunft und Sinn“, betont Schulleiterin Dajana Riske.
Während der kommenden drei Jahre erwerben die Auszubildenden umfassende theoretische und praktische Kenntnisse, die sie optimal auf ihre Tätigkeit in der professionellen Pflege vorbereiten. Neben dem Unterricht an der Berufsfachschule stehen zahlreiche Praxiseinsätze in den Kliniken Südostbayern sowie bei weiteren Kooperationspartnern auf dem Ausbildungsplan.
Mit dem neuen Ausbildungsjahrgang setzen die Kliniken Südostbayern ihr Engagement für die Nachwuchsförderung in den Gesundheitsberufen konsequent fort. Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte auszubilden und den jungen Menschen zugleich attraktive berufliche Perspektiven in der Region zu eröffnen.
03.09.2025 - Kliniken Südostbayern
Schultüten für alle
Mehr als 80 junge Leute beginnen ihre Ausbildung in den Kliniken Südostbayern
Das war am vergangenen Montag ein Gewusel in der Aula des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in der Herzog-Friedrich-Straße in Traunstein:
Mehr als 80 junge Leute, alle etwas aufgeregt und neugierig auf das, was kommt, wurden von Steffen Köhler, Leiter Geschäftsbereich Personal und Bildung der KSOB, Dunja Wondra, Pflegeleitung am Standort Trostberg, sowie Randy Uhl und Petra Lösch, beide MFA-Ausbildung & Praktikantenmanagement, zum Start ihrer Ausbildung herzlich in Empfang genommen. mehr...
Damit begann am 1. September um Punkt 8 Uhr ein neuer Lebensabschnitt für die Menschen, die lernen wollen, wie sie anderen Menschen am besten helfen.
Steffen Köhler, Petra Lösch und Dunja Wondra konnten dabei eine multinationale Gruppe begrüßen: 35 Gesundheits- und Krankenpfleger (GKP) aus 6 Nationen, 14 Medizinische Fachangestellte (MFA) aus 6 Nationen, 29 Pflegefachhilfskräfte (PFH) aus 13 Nationen sowie 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst – auch kurz Bufdis genannt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Einführungstag bekamen nach der Begrüßung auch gleich einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen zu Fragen der Hygiene, der Arbeitssicherheit, betrieblichen Belangen und dem Brandschutz vermittelt.
Um 12 Uhr war dann mit der Schultüte im Arm der erste Schritt ins neue Leben geschafft.
29.08.2025 - Klinikum Traunstein
Erfolgreiche Zertifizierung: Neues Nierenkrebszentrum am Klinikum Traunstein
Überwachungsaudits für Prostata- und Hodenkrebszentrum bestätigen Qualität

Das Klinikum Traunstein setzt neue Maßstäbe in der onkologischen Versorgung: Das neu eingerichtete Nierenkrebszentrum wurde erfolgreich durch die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) erst-zertifiziert. Die DKG hat sehr hohe Anforderungen für ihre Zertifizierungsprozesse. Damit gehört das Klinikum Traunstein zu den wenigen Anbietern im südbayerischen Raum, die die komplexe Versorgung von Nierentumoren auf höchstem Qualitätsniveau anbieten. mehr...
Parallel dazu haben auch das Prostatakrebszentrum sowie das Hodenkrebszentrum der Kliniken Südostbayern (KSOB) ihre Überwachungsaudits durch die DKG erfolgreich bestanden. Damit setzen die KSOB ihre konsequente Qualitätsoffensive im Bereich der onkologischen Versorgung fort und stärken ihre Position als führender Anbieter in der Region.
„Diese Auszeichnungen sind ein wichtiger Schritt für unsere Kliniken und sie bestätigen die hervorragende Arbeit unserer Fachärztinnen und Fachärzte sowie aller beteiligten Teams“, betont Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der KSOB. „Sie stehen für höchste Qualität, Patientensicherheit und eine enge Zusammenarbeit zwischen den KSOB und den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in der Region.“
Auch Prof. Dr. Dirk Zaak, Leiter des neuen Nierenkrebszentrums, hebt die Bedeutung der erfolgreichen Zertifizierungen hervor: „Das Ergebnis ist Ausdruck einer außergewöhnlich guten Teamarbeit über alle Bereiche hinweg – von der Klinik über die Praxisstrukturen bis hin zu den unterstützenden Einrichtungen. Nur gemeinsam war dieser Erfolg möglich.“
Der Zertifizierungsprozess wurde vom Qualitätsmanagement der KSOB umfassend begleitet.
Positive Rückmeldungen der Auditoren
Alle Auditoren sind ausgewiesene medizinische Experten. Sie stellten dem neuen Nierenkrebszentrum sowie den Prostata- und Hodenkrebszentren ein durchwegs sehr positives Zeugnis aus. Besonders hervorgehoben wurden:
- die hohe Motivation der Zentrumsteams,
- die ausgezeichnete Vorbereitung auf die Audits, die einen reibungslosen Ablauf ermöglichte,
- die enge Einbindung aller drei Zentren in das Onkologische Zentrum am Klinikum Traunstein.
Als zentrale Qualitätsmerkmale betonte das Expertengremium:
- die hohe Expertise in der robotischen Chirurgie, die in Traunstein auf exzellentem Niveau durchgeführt wird,
- die zeitnahe Information der zuweisenden Fachärzte über histologische Befunde,
- die klaren Strukturen und sehr guten Ergebnisse der interdisziplinären Tumorkonferenzen.
Besonders positiv bewerteten die Auditoren zudem das Engagement des Vereins gemeinsam gegen Krebs e.V., der Patientinnen und Patienten zusätzliche Unterstützung bietet und das medizinische Spektrum der KSOB-Zentren wertvoll ergänzt.
Fazit
Das abschließende Urteil fiel eindeutig aus: Die Auditoren sprachen eine klare Empfehlung zur Zertifizierung des neuen Nierenkrebszentrums sowie zur Aufrechterhaltung der Zertifikate für das Prostata- und Hodenkrebszentrum aus.
Damit unterstreicht das Klinikum Traunstein einmal mehr seine Rolle als Kompetenzzentrum für die Behandlung von Krebserkrankungen – für die Region Südostoberbayern und weit darüber hinaus.
28.08.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Wenn die Halsschlagader eng wird
Vortragsreihe Gesundheit AKTIV

Engstellen in der Halsschlagader, sogenannte Carotisstenosen, sind eine häufige Ursache für Schlaganfälle. Etwa 15 Prozent aller Fälle lassen sich auf diese Verengungen zurückführen. Das Tückische daran: Betroffene bemerken oft nichts, bis erste neurologische Symptome auftreten. Dr. med. Volker Kiechle, Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall, erklärt, wie sich solche Ablagerungen entwickeln, wann sie gefährlich werden und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. mehr...
„Das Heimtückische ist, dass die Engstelle selbst keine Beschwerden macht“, betont Dr. Kiechle. „Viele Patienten denken an ein Ziehen am Hals, das hat damit nichts zu tun. Erst wenn Partikel von der Ablagerung ins Gehirn gelangen, treten Symptome auf, die bis hin zum Schlaganfall reichen können.“
Verborgene Gefahr im Hals
Carotisstenosen entstehen durch Ablagerungen in der Gefäßwand, sogenannte Plaques. Diese bestehen aus Cholesterin, Kalk und Bindegewebe und können sich über Jahre unbemerkt entwickeln. Anders als bei Durchblutungsstörungen in den Beinen verursacht die Engstelle im Hals keinerlei Schmerzen. Beschwerden treten erst dann auf, wenn kleine Partikel oder Blutgerinnsel von der Engstelle aus ins Gehirn verschleppt werden. „Das Gehirn wird von vier großen Schlagadern versorgt, deswegen ist eine reine Mangeldurchblutung selten das Problem“, erklärt der Gefäßchirurg. „Gefährlich wird es, wenn sich an der Engstelle kleine Teilchen lösen. Weil die Halsschlagader direkt ins Gehirn führt, gelangen diese sofort in empfindliche Hirnregionen.“
Die Folge können kurze neurologische Ausfälle sein, die nach wenigen Minuten wieder verschwinden. Typische Symptome sind plötzliches Taubheitsgefühl oder Schwäche in Arm oder Bein, manchmal verbunden mit Sprachstörungen. „Wenn jemand für 20 Sekunden keine Kaffeetasse mehr halten kann oder die Worte nicht herausbekommt, kann das bereits ein Schlaganfall im Kleinen sein“, warnt Dr. Kiechle. „Solche Warnzeichen dürfen keinesfalls verharmlost werden. Wir wissen, dass in den ersten 14 Tagen danach die Gefahr für einen großen Schlaganfall besonders hoch ist.“
Diagnose, Behandlung und Operation
Entdeckt werden Carotisstenosen häufig zufällig, etwa bei einer Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße. Mit Abhören oder Abtasten komme man hier nicht weiter, so Kiechle, der Ultraschall sei der Standard. Zeigen sich dort Ablagerungen, wird zunächst beurteilt, ob sie hart und verkalkt oder weich und cholesterinreich sind und wie stark die Verengung ausgeprägt ist. Stark ausgeprägte weiche Plaques gelten als riskanter, da sie instabiler sein können und demzufolge leichter Partikel abgeben. Die Risikofaktoren ähneln denen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Rauchen und Diabetes mellitus. Besonders das Cholesterin spielt eine Schlüsselrolle. „Wenn jemand dauerhaft sehr hohe Cholesterinwerte hat, schauen wir gezielt auch auf die Halsschlagadern“, erklärt Dr. Kiechle.
Die Basis der Behandlung ist meist eine medikamentöse Therapie. Blutverdünner wie ASS verhindern die Bildung von Gerinnseln, Statine senken den Cholesterinspiegel und stabilisieren die Plaques. Ob zusätzlich ein Eingriff notwendig ist, hängt vom Ausmaß der Verengung, von der Beschaffenheit der Ablagerung und von individuellen Faktoren wie Alter oder Begleiterkrankungen ab. Leichte Verengungen bedeuten nur ein sehr geringes Schlaganfallrisiko, bei hochgradigen Stenosen oder instabilen Plaques steigt die Gefahr. „Hier müssen wir im Einzelfall entscheiden: Das Risiko der Operation muss kleiner sein als das Risiko des Schlaganfalls“, so Kiechle.
Kommt es zu einer Operation, wird die Halsschlagader freigelegt, kurzzeitig abgeklemmt und die Ablagerungen werden ausgeschält. „Der Eingriff ist in der Regel gut verträglich, die meisten Patienten können nach vier Tagen wieder nach Hause gehen“, erklärt Dr. Kiechle. Eine Alternative ist das Einsetzen eines Stents, eines feinen Metallgitters, das das Gefäß von innen offenhält. Dieses Verfahren spiele jedoch eher eine Nebenrolle, da die klassische Operation insgesamt sicherer sei. Auch nach einem Eingriff bleibt die medikamentöse Behandlung wichtig, um Rückfälle zu verhindern. Denn eine Carotisstenose kann sowohl erneut an der behandelten Seite als auch an der Gegenseite entstehen. Regelmäßige Ultraschallkontrollen seien deshalb unverzichtbar.
Veranstaltungshinweis
Im Vortrag „Verengung der Halsschlagader - wann wird es gefährlich?“ informiert Dr. med. Volker Kiechle, Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall, über Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten von Carotisstenosen. Er gibt praktische Hinweise, wie Betroffene Warnsignale richtig deuten und wann eine Operation sinnvoll ist.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „GesundheitAktiv“ der Kliniken Südostbayern (KSOB) am Donnerstag, 4. September 2025, von 16.00 bis 17.30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhallstatt. Der Eintritt ist frei.
27.08.2025 - Klinikum Traunstein
Die 1.000ste Geburt am Klinikum Traunstein

Am Dienstag, 26. August 2025, konnten die Kliniken Südostbayern die 1000. Geburt des Jahres 2025 im Klinikum Traunstein vermelden:
„Morgens um 8.40 Uhr erblickte die kleine Ines das Licht der Welt. Sie ist gesund und munter und mit einem Gewicht von 4.140 Gramm, einem Kopfumfang von 35 cm und einer Körperlänge von 50 cm bestens gediehen“, so Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik. Auch der Mutter Katarina Loncar geht es gut und sie freut sich zusammen mit Vater Ivan Loncar sehr über den Familienzuwachs. Dieser wird die beiden Damen bald mit nach Hause nehmen können. mehr...
Es passiert unerwartet. Der Bauch spannt, die Wehen setzen ein – und plötzlich wird aus neun Monaten Vorfreude eine Entscheidung über Leben und Überleben. Frühgeburt: ein Wort, das Eltern erschreckt. Doch es ist eine Herausforderung und eine Chance – für Kind und Eltern gleichermaßen. Zum Welttag der Patientensicherheit haben wir gesprochen mit Prof. Dr. Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, und Prof. Dr. Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, über Frühchen und was sie brauchen. Die Kinderklinik und die Frauenklinik bilden das Perinatalzentrum Level I am Klinikum Traunstein.
Herr Professor Wolf, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Baby zu früh kommt?
Wolf: Eine Frühgeburt liegt vor, wenn ein Kind vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickt. In Deutschland sind das etwa 65.000 Babys jedes Jahr. Je früher ein Kind geboren wird, desto unreifer sind Organe und Körperfunktionen. Das bedeutet: Herz, Lunge, Darm, ja selbst die Haut müssen unterstützt werden. Aber: Medizin und Pflege haben enorme Fortschritte gemacht. Selbst die ganz Kleinen unter 500 Gramm Gewicht haben heute Chancen, gesund groß zu werden – und darauf sind wir hier im Perinatalzentrum I am Klinikum Traunstein spezialisiert. Wenn Babys und speziell Frühgeborene Babys in einem Level I Perinatalzentrum zu Welt kommen, ist die gesamte Versorgung gewährleistet. Das Baby muss nicht mehr in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, alle Spezialisten sind bereits vor Ort.
Herr Prof. Dr. Schindlbeck, viele Eltern sind unsicher und fragen sich, warum gerade ihr Kind zu früh kommt.
Schindlbeck: Das ist ein Schmerz und Fragen, die wir oft erleben. Aber es ist ein Trugschluss: Eine Frühgeburt ist kein Versagen, da gibt es keine Schuld. Die Ursachen sind vielfältig – Infektionen, Mehrlingsschwangerschaften, Stress, manchmal auch Gründe, die wir nicht kennen. Eltern sollten in dieser Situation nicht die Schuld bei sich suchen, sondern auf die Stärke vertrauen, die wir ihnen geben können. Und das tun wir, indem wir sie von Beginn an einbinden. Wir versuchen im Perinatalzentrum Traunstein immer, so lange es geht eine Frühgeburt zu verhindern und die Schwangerschaft zu verlängern. Dabei sind wir auch sehr erfolgreich.
Was können Sie konkret tun, wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt?
Wolf: Bei uns im Perinatalzentrum Level I am Klinikum Traunstein arbeiten Expertinnen und Experten für Geburtsmedizin, Neonatologie, Kinderchirurgie, Anästhesie sowie Pflegekräfte, Psychotherapeutinnen und Physiotherapeuten Schulter an Schulter und Hand in Hand – rund um die Uhr. Die Technik ist auf höchstem Niveau – Inkubatoren, Beatmungsgeräte, feinste Überwachungsmonitore und auch ganz spezielle Geräte für Frühgeborene, wie der Concord Birth Trolley. Das ist ein Versorgungstisch, auf dem das Frühgeborene direkt bei der Mutter stabilisiert und ggf. beatmet werden kann, während es noch an der Nabelschnur ist. Solche Einrichtungen haben nur ganz wenige Kliniken in Deutschland. Das Entscheidende ist: Wir schaffen Nähe. Frühgeborene brauchen Wärme, Körperkontakt, Herzschlag. Deshalb setzen wir auf das sogenannte ‚Känguruhen‘. Mutter oder Vater kuscheln mit dem Baby und hierbei ist wichtig: „Haut auf Haut“. Das stabilisiert Puls und Atmung – und gibt die Geborgenheit, die kein Gerät ersetzen kann und die gerade ein Frühchen dringend braucht. Wichtig ist auch die Präsenz der Kinderchirurgie in Traunstein: ein Team von fünf Kinderchirurgen, unter der Leitung von Dr. Marc J. Jorysz und Dr. Bernd Geffken, steht rund um die Uhr bereit, wenn das Frühgeborene operiert werden muss.
Viele Eltern fürchten sich: So klein, so zerbrechlich, wie kann ich meinem Baby nahe sein?
Wolf: Nähe und erster Hautkontakt sind absolut unverzichtbar! Natürlich vorsichtig, und wir in der Neonatologie sind 24 Stunden 7 Tage die Woche da, um die Eltern in genau diesen Momenten zu begleiten. Die Eltern erleben: Ich kann etwas für mein Kind tun. Nicht Pflegekraft und Arzt oder Ärztin allein, sondern auch die Mutter, der Vater sind es, die Nähe schenken können bei uns. Und diese Nähe wirkt wie Medizin. Studien zeigen: Frühchen, die viel Hautkontakt erleben, entwickeln sich oft besser, brauchen weniger Schmerzmittel und haben stabilere Kreisläufe.
Und wie früh können Eltern ihr Kind auf diese Weise unterstützen?
Wolf: Schon am Tag der Geburt. Wir versuchen, sofort die Eltern zur Erstversorgung dazu zu holen, meistens ist das der Papa, besonders wenn das Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Wir versuchen dann gleich mit Kind im Inkubator noch bei der Mama vorbeizuschauen. Die Pflege spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Unsere Kinderkrankenschwestern und -pfleger sind rund um die Uhr da und binden die Eltern mit ein. Selbst wenn Beatmungsschläuche und Kabel da sind – die Eltern sind von Anfang an dabei. Darauf legen wir ganz großen Wert, denn diese enge Elternbindung von Anfang an ist ein Fundament. Kinder, die früh Nähe erleben, entwickeln nicht nur bessere körperliche Stabilität, sondern auch emotionale Sicherheit. Und die Eltern gewinnen Vertrauen in sich und in ihr Kind. Dieses Gefühl trägt durch die Wochen auf der Intensivstation und darüber hinaus.
Welche Rolle spielt die Versorgung schon vor der Geburt?
Schindlbeck: Wenn sich eine Frühgeburt abzeichnet, können wir am Klinikum Traunstein die Mutter aufnehmen und überwachen. Wir von der Geburtsmedizin und das Team von Prof. Dr. Wolf von der Neonatologie arbeiten ganz eng zusammen, um die beste Versorgung für Mutter und Kind sicherzustellen. So können wir die Zeit bis zur Geburt etwas weiter verlängern, Medikamente zur Lungenreifung geben oder Infektionen behandeln. Jede Stunde im Mutterleib zählt – und doch ist manchmal der frühere Geburts-Zeitpunkt der bessere. Wichtig ist: diese Entscheidungen treffen wir immer gemeinsam mit den Eltern.
Ihr Perinatal-Zentrum ist wohnortnah für die Bevölkerung in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf. Was bedeutet das für die Familien?
Wolf: Es bedeutet schlicht: Sicherheit und Gewissheit. Selbst im unerwarteten Moment sind die Spezialistinnen und Spezialisten da, die wissen, was zu tun ist – wohnortnah. Keiner muss nach München, Passau oder Salzburg fahren, das ist im Zweifelsfall viel zu weit. Wir möchten den Menschen in Südostbayern mitteilen: Auch, wenn das Leben gerade anders läuft als geplant: Wir sind da, immer.
Neonatologie und Geburtshilfe auf der TRUNA
Sie können Prof. Dr. Gerhard Wolf und Prof. Dr. Christian Schindlbeck dort persönlich treffen und Fragen stellen: Am 5. Oktober in Halle 9 auf dem Stand der Kliniken Südostbayern.
An den anderen Tagen können Sie mit Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften aus diesen anderen Fachbereichen sprechen:
01.10. Geriatrie, der Alterstraumatologie und der Schmerztherapie
02.10. Gefäßchirurgie
03.10. Viszeralchirurgie und Viszeralonkologisches Zentrum sowie der Psychologische Dienst der Intensivstationen
04.10. Innere Medizin, Lungenzentrum
26.08.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Über Atemnot, Rückschläge und neuen Lebensmut
Eine Patientengeschichte über eine jahrelang verdrängte schwere Lungenkrankheit und die Rückkehr zu einem Stück Normalität nach langer Leidenszeit

Sepp O. sitzt mit Sauerstoff in der Nase am Esstisch seiner geschmackvoll eingerichteten Wohnung. Über eine meterlange Leitung ist er immer mit dem großen Sauerstofftank verbunden, der zwischen Wohn- und Küchenbereich steht. Das ist ausreichend für seinen Bewegungsradius in der Wohnung, für Spaziergänge hat er ein tragbares Gerät. Doch es ist ein langer Weg von den Anfängen seiner Krankheit, über Rückschläge und Krisen, bis er dahin kommen konnte, wo er heute steht. mehr...
Seine Krankheit heißt COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die sowohl in Deutschland als auch weltweit eine häufige Erkrankung darstellt und zu irreversiblen Schäden an den Atemwegen und der Lunge führt. Sepp O. hat das schwerste Stadium 4 – das fortgeschrittenste Stadium, bei dem die Patienten immer unter schwerer Atemnot leiden, auch in Ruhe. Und das ist seine Geschichte:
Verdrängen statt behandeln lassen
Der 64-Jährige ist, oder besser war, von Beruf Fahrerbetreuer bei einer großen Spedition in Rosenheim mit 160 LKWs – er ist dort verantwortlich für die Einstellung und Betreuung von 200 LKW-Fahrern. Er hat einen stressigen Job, raucht ca. 8 – 10 Zigaretten pro Tag und war in den 20 Jahren seiner Betriebszugehörigkeit nie krank. Alles in allem lebt er also ein normales Leben.
2022 geht er zum Arzt, weil er feststellt, dass er nach 500 Metern Gehstrecke anhalten und schnaufen muss. Aber eigentlich will er sich gar nicht näher damit befassen: „Ich habe das Problem verdrängt nach dem Motto ‚is oiwei no guad ganga‘.“
Ab Januar 2024 wird die Atemnot präsenter, Sepp O. merkt selbst, dass etwas nicht stimmt. Im April geht er deswegen zu seinem Hausarzt: „Ich kam immer noch gut vom Parkplatz ins Büro und war nicht krankgeschrieben.“
Die Atemnot bestimmt das Leben
Kurz danach muss sein Sohn nachts um 2 Uhr den Rettungswagen rufen – Sepp O. schafft es nicht einmal mehr selbst zum Telefon. Er wird daraufhin vom 12. – 19. April 2024 stationär in der Kreisklinik Trostberg behandelt. Er erinnert sich: „Ich bin sehr gut behandelt worden, das möchte ich betonen. Als ich danach wieder Zuhause war, ging‘s mir mit der Zeit immer schlechter. Beim Sitzen, beim Laufen, irgendetwas tragen war nicht mehr möglich. Und ich habe danach 10 kg abgenommen, weil ich entweder schnaufen ODER essen konnte. Krankgeschrieben bin ich seitdem bis heute.“ Am 15.6.24 ruft sein Sohn wieder den Rettungswagen und wieder wird er in der Kreisklinik Trostberg aufgepäppelt. Er bleibt bis zum 18.6. in der Klinik. Zum wiederholten Male muss dann am 12.8.2024 der Rettungswagen gerufen werden, wieder mitten in der Nacht, denn Sepp O. bekommt plötzlich keine Luft mehr.
Im September 2024 geht Sepp O. dann auf Reha, um die Lungenfunktion zu verbessern. Dort kommt am dritten Tag der Zusammenbruch – er mutet sich selbst zu viel Bewegung zu, läuft den ganzen Tag, aber die Lunge macht das nicht mit: „Ich hab‘ gedacht, das geht und ich wollte das auch so, aber dann saß ich plötzlich im Rollstuhl.“
Am 20. November das gleiche Spiel wie vor der Reha: Wieder keine Luft mehr, wieder mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er wird erneut durchgecheckt, alle anderen Organe sind in Ordnung, auch die Blutwerte sind gut. Über seinen Lungenarzt Dr. Koch in Trostberg kommt er zu Prof. Dr. Tobias Lange, Chefarzt der Pneumologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall.
Zu diesem Zeitpunkt ist seine Alltags-Situation schon dramatisch: „Wenn ich zum Beispiel duschen wollte, musste ich langsam Schritt für Schritt ins Bad gehen, um mir dort alles vorzubereiten. Dann brauchte ich erstmal eine Stunde Pause und musste mich hinlegen. Dann habe ich den Weg ins Bad wieder in Angriff genommen. Dort angekommen, war erstmal Pause angesagt. Das Duschen selbst war so anstrengend für mich, es hat ewig gedauert, bis ich das letzte Schaum-Quäntchen wieder weghatte. Und das Bad aufräumen war dann die nächste Aktion, die Stunden in Anspruch genommen hat.“
Behandlung und Rückschläge
Im April 2025 kommt Sepp O. dann zur Voruntersuchung zu Prof. Dr. Lange nach Bad Reichenhall. Es ist die Reduktion seines Lungenvolumens geplant, die ihm dann das Atmen mit dem gesünderen Teil der Lunge wieder ermöglichen soll. Prof. Dr. Lange erklärt ihm alles ganz genau – und er spricht auch die Risiken an, die dieser Eingriff beinhaltet, nämlich, dass die Lunge zusammenfallen könnte und dann sofort gehandelt werden muss.
Der Eingriff am 2. Juni 2025 findet bei Prof. Dr. Lange in der Kreisklinik Bad Reichenhall statt und bringt ihm dann auch direkt nach der OP Besserung. Doch tatsächlich kommt am dritten Tag die befürchtete Komplikation: Die Lunge fällt zusammen und Sepp O. muss sofort in der Kreisklinik behandelt werden. Es wird eine sogenannte Thoraxdrainage angelegt, ein dünner Schlauch, der zwischen den Rippen hindurch in den Brustkorb eingeführt wird, um die Luft wieder abzusaugen.
„Das Zusammenfallen der Lunge, ein sogenannter Pneumothorax, entsteht durch einen kleinen Riss im Überzug der Lunge, dem „Lungenfell“, ausgelöst durch das Wandern der Lunge entlang der Brustwand nach der Verkleinerung des anderen Lungenlappens“ erklärt Prof. Dr. Lange. „Es stellt eine Komplikation im Rahmen der bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion mittels Ventilimplantation dar, kann aber gut beherrscht werden.“
Den Genesungsweg fest im Blick
Nach drei Wochen in der Klinik ist die Krise überstanden, Sepp O. kann nach Hause gehen. Bei einer Nachuntersuchung wird festgestellt, dass er Wasser in der Lunge hat, wieder ein Nackenschlag. Kurz danach fällt die Lunge nach Punktion des Wassers erneut zusammen, doch auch dieses Mal steckt er die Krise weg und kann seinen Genesungsweg fortsetzen. Die Reha im August 2025 gibt ihm ein neues Ziel: „Ich möchte wieder besser leben, dazu will ich wieder meine Muskulatur aufbauen und mich wieder mehr bewegen. Sepp O. resümiert die Zeit: „Trotz der Rückschläge, die jedes Mal wunderbar behandelt wurden, empfinde ich es immer wieder als ein tolles Gefühl, dass die Luft nicht mehr auf dem Weg irgendwo hängen bleibt, so war das vorher immer. Der Unterschied ist unvorstellbar. Ich hätte den Professor Lange am liebsten umarmt. Was mir auch wirklich wichtig ist: Ich möchte dem ganzen Team der Station in der Kreisklinik Bad Reichenhall danken, den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften, alle waren so nett und kompetent.“
Eis essen, Freunde treffen: Wieder leben
Er kann keine großen Sprünge machen, wie er es formuliert, aber: „Ich kann wieder zum Eis essen gehen und sogar mal – mit meinem tragbaren Sauerstoffgerät – einen Tagesausflug machen. Vorher bin ich ein Jahr lang nicht aus der Wohnung gekommen, weil ich nicht mal die 500 m zu meinem Arzt gehen konnte. Jetzt macht auch Duschen wieder Spaß.“ Sepp O. ist nachdenklich, aber optimistisch, wenn er über seine Zukunft spricht: „Mein persönliches Ziel ist, ganz normal am Alltagsleben teilzunehmen. Wieder Kontakte pflegen zu können und meine zwei besten Freunde wieder zu treffen. Einfach mal selbst zu denen hinfahren, das geht jetzt wieder mit meinem mobilen Sauerstoff – darüber freue ich mich besonders!“
21.08.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Üben für die blutige Realität
Das Team der Notaufnahme der Kreisklinik Bad Reichenhall trainierte für einen Massenanfall von Verletzten
Massenkarambolagen auf der Autobahn, Busunfälle oder das Zugunglück vor kurzem in Baden-Württemberg – der so genannte Massenanfall von Verletzten (MANV) stellt medizinische Teams vor außergewöhnliche Herausforderungen. Um im Ernstfall schnell und präzise handeln zu können, sind realitätsnahe Übungen von entscheidender Bedeutung: Ein Blick hinter die Kulissen des MANV-Trainings in der Kreisklinik Bad Reichenhall. mehr...
Dr. Verena Kollmann-Fakler, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme der Kreisklinik Bad Reichenhall, und Sonja Burkert-Rettenmaier, Ärztin im festen Team der Notaufnahme, geben einen Einblick: „Ein Vorkommnis, bei dem plötzlich viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen, ist für jedes Krankenhaus eine Ausnahmesituation. Schwere Unfälle, Zwischenfälle bei Großveranstaltungen oder technische Katastrophen – all diese Szenarien stellen nicht nur die eingesetzten Rettungskräfte auf die Probe, sondern auch uns in den Notaufnahmen der Krankenhäuser, da wir dann sofort einsatzbereit sein müssen. Dann gilt es, so schnell wie möglich viele Patientinnen und Patienten nach Sichtungskategorien, also nach Schwere der Verletzung, bestmöglich zu versorgen.“
Schwerste Verletzungen zu versorgen
Der an sich fordernde Alltag in einer Notaufnahme verlangt selten eine solch extreme Dringlichkeit und gleichzeitige Höchstbelastung, wie sie bei einem MANV auftritt. Die Herausforderungen liegen dann nicht nur in der schieren Anzahl an Verletzten, sondern auch in der Art der Verletzungen, die plötzlich und gehäuft auftreten. Ein Beispiel: Das schnelle Stillen starker Blutungen, das im Klinikalltag eher selten vorkommt, kann im MANV über Leben und Tod entscheiden. Ebenso können schwere Verletzungen der Extremitäten oder der Organe, die normalerweise eher isoliert auftreten, bei solchen Ereignissen plötzlich gehäuft vorkommen.
Maßgeschneidertes Konzept
Um auf solche Extremsituationen vorbereitet zu sein, hat die Kreisklinik Bad Reichenhall, lokales Traumazentrum der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, ihr Konzept zur Behandlung schwerverletzter Patienten bei einem solchen MANV umfassend weiterentwickelt. Sonja Burkert-Rettenmaier war daran maßgeblich beteiligt: „Als Notärztin und langjährige Trainerin in der Notfallmedizin ist mir wichtig, Konzepte zu erstellen, die in der anspruchsvollen Umgebung der Notaufnahme auch wirklich funktionieren.“ Dieses Konzept orientiert sich an den Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und ist passgenau auf die Strukturen und Abläufe vor Ort zugeschnitten. Das Ziel: Auch unter extremem Druck strukturiert und sicher agieren.
Dieser erste MANV-Trainingstag im Juli ging dabei weit über eine bloße Theorieeinheit hinaus. Die Übung fand buchstäblich nicht am Schreibtisch, sondern auf der Behandlungsliege statt. Dabei wurde das Stresslevel bewusst hochgefahren und hochgehalten, sowohl körperlich als auch psychisch. Im Fokus stand dabei, die Teams aus Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften in realitätsnahen Szenarien an ihre Belastungsgrenze heranzuführen, um Abläufe zu festigen und die Zusammenarbeit unter Druck zu trainieren. Das Training war alles andere als harmlos: Mit realistischer Wunddarstellung und Verletztendarstellern wurde der Ernstfall simuliert, das Training wurde dafür durch Schauspieler der Notfalldarstellung Traunstein sowie durch den Trainer Rhys Williams unterstützt, der seine handgefertigten Wundmodelle kostenlos zur Verfügung stellte. Beispielsweise wurden Übungspatienten, überzogen mit Kunstblut, in den Schockraum der Notaufnahme gebracht. Eine nicht alltägliche Erfahrung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Regelmäßige Übungen sind unerlässlich
Dieses besonders intensive Training ist Teil des regelmäßigen Trainings-Programms der Notaufnahme, das wöchentlich von Chefärztin Dr. Verena Kollmann-Fakler und der Ärztin Sonja Burkert-Rettenmaier durchgeführt wird. Diese regelmäßigen Übungen dienen dazu, die Versorgung schwerverletzter Patienten systematisch zu verbessern, klare Entscheidungswege zu festigen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im gesamten Team zu stärken.
„Vorbereitung ist der Schlüssel,“, sagt Sonja Burkert-Rettenmaier, „denn nur so können wir in den KSOB bei einem MANV tatsächlich die höchste medizinische Qualität bieten – auch unter extremen Bedingungen.“ Mit diesem Ansatz setzen die Kliniken Südostbayern ein klares Zeichen: Auch in der Zentralen Notaufnahme der Kreisklinik Trostberg finden solche MANV-Fortbildungen statt und in der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Traunstein stehen die nächsten MANV-Fortbildungen bereits im September und Oktober an.
20.08.2025 - Kliniken Südostbayern
Mehr als ein Zeugnis: Der Beginn eines Berufs voller Verantwortung
Erfolgreichen Abschluss ihrer Pflegefachhelferinnen und Pflegefachhelfer
Ein Sommertag, ein Fest der Freude: Am 19. August feierte die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe den erfolgreichen Abschluss ihrer Pflegefachhelferinnen und Pflegefachhelfer im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Traunstein. 25 junge Menschen haben ihre Zeugnisse bekommen, 23 von ihnen dürfen fortan offiziell den Titel „Pflegefachhelferin“ tragen – eine stolze Gruppe, die sich für diese Feier besonders schick gemacht hatte. mehr...
Drei Namen wurden auch noch besonders erwähnt: Leni Kecht, Aneta Walzcak und Hope Nansubuga. Mit der Abschlussnote 1,4 haben die Drei gezeigt, wie viel Fleiß, Herz und Ausdauer in dieser Ausbildung stecken. Doch nicht nur Leistung zählt – auch Verantwortung: Die Klassensprecher Leni Kecht und Samet Demircan haben zusammen mit ihrer Klassenleitung Lara Treppner eine besondere Geste beschlossen. Der gesamte Inhalt der Klassenkasse wurde an die Kinderklinik gespendet. Eine Tat, die zeigt: Wer in der Pflege arbeitet, denkt immer auch an andere.
Mehr als 20 der frischgebackenen Pflegehelferinnen und Pflegehelfer werden direkt von den Kliniken Südostbayern übernommen werden. Ein starkes Signal: Hier wächst eine Generation heran, die nicht nur gelernt hat, wie man Verbände wechselt oder Blutdruck misst, sondern auch, was Menschlichkeit bedeutet.
So endet eine Ausbildungszeit voller Prüfungen und Anstrengungen – und beginnt eine Zukunft, die Hoffnung macht. Denn hinter jedem Zeugnis, hinter jeder Urkunde steht ein Mensch, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und allein das ist ein Grund zum Feiern.
Bilder:
Bild 1: Die stolzen frischgebackenen Pflegefachhilfskräfte wurden von Philipp Hämmerle und Johannes Schreiber, KSOB, sowie von Burgi Mörtl-Körner beglückwünscht.
Bild 2: v.l. Sepp Konhäuser, stv. Landrat, Susanne Fersterer, Lehrerin, Burgi Mörtl-Körner, 2. Bürgermeisterin Stadt Traunstein, Aneta Walzcak Leni Kecht und Hope Nansubuga, die drei Jahrgangsbesten, Johannes Schreiber, Pflegeleiter Klinikum Traunstein, Philipp Hämmerle, Vorstand der KSOB, Lara Treppner, Klassenleitung und stv. Schulleitung.
Bild 3: Die Klassensprecher Leni Kecht (3.v.l.) und Samet Demircan (1.v.l.) zusammen mit ihrer Klassenleitung Lara Treppner (re.) und der Lehrerin Susanne Fersterer (2. v.l.) mit der Spende für die neue Kinderklinik am Klinikum Traunstein.
14.08.2025 - Gesundheitscampus Freilassing
Bündelung der ambulanten Chirurgie am Gesundheitscampus Freilassing

Bereits jetzt steht für die Bevölkerung am Gesundheitscampus Freilassing eine ambulante chirurgische Praxis des Fachärztezentrums der Kliniken Südostbayern zur Verfügung. Diese wird nun mit zusätzlichen Kapazitäten weiter ausgebaut, um die chirurgische und unfallchirurgische Diagnostik und Notfallversorgung in Freilassing zu stärken. mehr...
Durch die Bündelung der ambulanten Chirurgie am Gesundheitscampus Freilassing schaffen die Kliniken Südostbayern damit eine effizientere Versorgung für die Patientinnen und Patienten. Mit dieser Maßnahme haben die Kliniken die Steigerung der Qualität der ambulanten Versorgung im Fokus.
„Mit der Verstärkung der ambulanten Chirurgie setzen wir einen entscheidenden Impuls für die Gesundheitsversorgung in Freilassing“, ist Landrat Bernhard Kern überzeugt. „Wir schaffen damit ein gutes ambulantes Angebot für die Patientinnen und Patienten im Berchtesgadener Land und können gleichzeitig den steigenden Anforderungen des Gesundheitssystems gerecht werden.“
Der Gesundheitscampus Freilassing setzt somit einen wichtigen Meilenstein in der Stärkung der ambulanten chirurgischen Versorgung im Berchtesgadener Land.
11.08.2025 -
Überregionale Stroke Unit am Klinikum Traunstein erneut zertifiziert
Dass die Schlaganfall-Expertise an den KSOB nicht nur spürbar, sondern auch überprüfbar ist, zeigt die wiederholt erteilte Zertifizierung der Überregionalen Stroke Unit durch die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe & Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft. Eine Auszeichnung, die hohe Anforderungen an Struktur- und Prozessqualität stellt und im Klinikum Traunstein seit vielen Jahren durchgehend besteht. mehr...
„Wir haben von Anfang an konsequent auf Qualität gesetzt – und auf Zusammenarbeit“, so Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Traunstein. „Die Zertifizierung ist für uns eine wichtige Grundlage und der Nachweis unserer Kompetenz. Wir freuen uns sehr, dass die Auditoren unter anderem die sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit positiv hervorgehoben haben.“
Das Klinikum Traunstein verfügt zwischen München und Salzburg über die einzige „Überregionale Stroke Unit“, also eine spezialisierte Schlaganfall-Abteilung, in der das komplette Spektrum der Therapien rund um die Uhr vorgehalten wird. Davon profitieren auch die Bewohner angrenzender Landkreise, und hier besonders die Patientinnen und Patienten aus dem Berchtesgadener Land: Die telemedizinische, vernetzte Stroke Unit der Kreisklinik Bad Reichenhall kooperiert sehr eng mit der im Klinikum Traunstein.
Die Überregionale Stroke Unit im Klinikum Traunstein verfügt über 6 Betten mit Schnittstellen zu allen relevanten Bereichen. Sie ist außerdem als Thrombektomiezentrum in das „Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung – TEMPiS" der Region Süd-Ost-Bayern eingegliedert. Die Schlaganfall-Einheit ist zusätzlich als „ESO Stroke Centre“ auch nach europäischen Standards zertifiziert.
31.07.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Kleine Steine, große Schmerzen
GesundheitAKTIV-Vortrag zum Thema Gallensteine

Etwa jeder Fünfte in Deutschland trägt Gallensteine, oft ohne es zu bemerken. Nur ein Viertel der Betroffenen entwickelt Beschwerden, von krampfartigen Schmerzen bis hin zu schweren Entzündungen. Dank moderner Diagnostik und minimal-invasiver Operationstechniken lassen sich Gallensteine heute sicher und schonend behandeln, wie Anne Muth, Assistenzärztin der Abteilung Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasiven Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall erklärt. mehr...
„Es gibt verschiedene Risikofaktoren für Gallensteine. Zum einen spielen Genetik, Geschlecht und Alter eine Rolle, aber auch Ernährung und Bewegungsmangel“, erklärt Medizinerin Anne Muth. Weitere Risikofaktoren seien Schwangerschaften oder die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel wie der Pille. Auch Darmerkrankungen, Diabetes oder ein schneller, starker Gewichtsverlust könnten zur Bildung von Gallensteinen führen. All das erkläre die hohe Häufigkeit – und die Tendenz sei sogar steigend.
Häufig, aber oft unbemerkt
Die Galle ist eine grünlich-gelbe Flüssigkeit, die in der Leber gebildet und in der Gallenblase gespeichert wird. Sie hilft bei der Verdauung von Fetten, indem sie diese in winzige Tröpfchen zerlegt, ähnlich wie Spülmittel Fett von einem Teller löst. Normalerweise entleert sich die Gallenblase regelmäßig, vor allem nach dem Essen. Geschieht das jedoch selten oder nur unvollständig, bleibt Galle länger stehen und wird zähflüssig. Zusammen mit Veränderungen in der Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit können sich kleine Kristalle bilden, die mit der Zeit zu Gallensteinen heranwachsen.
Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, vor allem über 40-Jährige. Übergewicht erhöht das Risiko zusätzlich. Die meisten Betroffenen spüren davon jedoch lange nichts: „Einige Gallensteine werden zufällig im Ultraschall entdeckt“, berichtet Chirurgin Anne Muth. Beschwerden entstehen oft erst, wenn Steine wandern und Gallengänge blockieren. Typisch sind krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch, manchmal in Rücken oder Schulter ausstrahlend, häufig nach dem Essen und gelegentlich begleitet von Übelkeit oder Erbrechen. „Gallenkoliken sind sehr schmerzhaft, wer das einmal erlebt hat, sucht freiwillig einen Arzt auf“, weiß die Medizinerin. Gefährlich wird es, wenn Entzündungen der Gallenblase, Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder Infektionen der Gallenwege auftreten.
Behandlung und Vorbeugung
Die Diagnose erfolgt über Anamnese, körperliche Untersuchung, Laborwerte und eine Ultraschalluntersuchung, die Gallensteine in mehr als 95 Prozent der Fälle sichtbar macht. Sitzt ein Stein im Gallengang und blockiert den Abfluss der Galle, kann er in einem speziellen endoskopischen Verfahren (ERCP) entfernt werden. Dabei wird ein flexibles Endoskop über den Mund bis in den Zwölffingerdarm vorgeschoben, und von dort aus kann der Stein mit feinen Instrumenten aus dem Hauptgallengang entfernt werden. Bei akuten Gallenkoliken helfen Medikamente, die krampflösend wirken und die Schmerzen lindern. „Was es leider nicht gibt, ist ein Medikament, das Gallensteine auflöst“, sagt Muth.
Wenn Beschwerden immer wiederkehren oder eine Entzündung vorliegt, kann eine Operation notwendig werden. „Nur weil man einmal eine Gallenkolik hatte, muss nicht sofort operiert werden“, betont die Chirurgin. „Es gibt aber klare Indikationen, etwa eine akute Entzündung.“ In solchen Fällen wird die gesamte Gallenblase entfernt, nicht nur der Stein, damit sich keine neuen bilden können. In der Kreisklinik Bad Reichenhall erfolgt dieser Eingriff meist minimal-invasiv über drei bis vier kleine Schnitte, was eine schnelle Erholung ermöglicht. „Die Patienten sind schnell wieder fit, müssen in der Regel nicht lange im Krankenhaus bleiben und brauchen keine spezielle Diät“, ergänzt Muth. „Außerdem verwenden wir inzwischen selbstauflösendes Nahtmaterial, sodass kein Fädenziehen mehr nötig ist.“
Neben der Behandlung spielt auch die Vorbeugung von Gallensteinen eine wichtige Rolle. „Empfohlen werden mehrere kleine Mahlzeiten statt weniger großer. Nüchternphasen sollten nicht zu lang sein“, sagt Muth. Ideal sei eine ballaststoffreiche Ernährung mit pflanzlichen Fetten, ergänzt durch regelmäßige Bewegung und ein gesundes Körpergewicht. „Manchmal entwickeln aber auch Menschen, die sich sehr gesund ernähren, Gallensteine. Ernährung ist nur ein Faktor von mehreren.“ Intervallfasten oder lange Essenspausen seien dagegen bei Menschen mit kleinen Steinen eher ungünstig, so die Medizinerin.
30.07.2025 - Kliniken Südostbayern
Deutlich mehr Patienten, deutlich weniger Defizit
Kliniken Südostbayern AG mit positiver Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 – Aufsichtsratsvorsitz neu besetzt

Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) blicken auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2024 zurück. Im Rahmen der gestrigen Jahreshauptversammlung präsentierte der Vorstand den Kreisräten der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land eine deutliche wirtschaftliche und leistungsbezogene Verbesserung. Im Anschluss wurde im Aufsichtsrat Landrat Andreas Danzer (Landkreis Traunstein) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Landrat Bernhard Kern (Berchtesgadener Land), der künftig als stellvertretender Vorsitzender fungiert. mehr...
Wirtschaftlich deutlich stabilisiert
Im Vergleich zum Vorjahr konnte die KSOB ihr Jahresergebnis signifikant verbessern: Das Defizit reduzierte sich von -39,76 Mio. EUR im Jahr 2023 auf -7,36 Mio. EUR im Jahr 2024. Gleichzeitig stiegen die betrieblichen Erträge um 11,3 % auf 354,8 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf höhere Erlöse aus Krankenhausleistungen zurückzuführen. Zudem konnte erstmals seit Jahren wieder ein leicht positiver operativer Cashflow (+0,46 Mio. EUR) erreicht werden. Der gesamte Mittelzufluss aus laufender Geschäftsstätigkeit lag in 2024 bei rund +10,5 Mio. EUR, wobei dabei Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von 10 Mio. EUR enthalten sind.
„Das vergangene Jahr war von einer bemerkenswerten wirtschaftlichen Stabilisierung geprägt, wir haben die Talsohle durchschritten. Ein gemeinsamer Erfolg, den wir dem großen Einsatz unserer Mitarbeitenden und der finanziellen Unterstützung durch unsere Anteilseigner – die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land – zu verdanken haben“, betont KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. „Ohne das tägliche Engagement und den Zusammenhalt in unseren Häusern wäre diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen. Dieser Erfolg ist eine Teamleistung, die das Vertrauen der Patienten in uns weiterhin stärken wird.“
Mehr Patienten, mehr Vertrauen
So war auch die medizinische Leistungsentwicklung ausgesprochen erfreulich: Über 52.000 stationäre Patienten wurden 2024 behandelt – ein Anstieg von 9,7 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung klar übertroffen. Der Zuwachs zeugt vom gestiegenen Vertrauen der Bevölkerung in die wohnortnahe Versorgung durch die KSOB-Kliniken.
Parallel dazu konnte das Unternehmen auch personell wachsen: Im Bereich Pflege wurden 78 Beschäftigte (+4,9 %) gewonnen, und auch der ärztliche Dienst wurde weiter gestärkt.
Der Lagebericht 2024 der Kliniken Südostbayern AG findet sich hier.
29.07.2025 - Klinikum Trausntein
Neue Hoffnung für das schwache Herz
Seit einem Jahr wird Minimalinvasives Clip-Verfahren eingesetzt
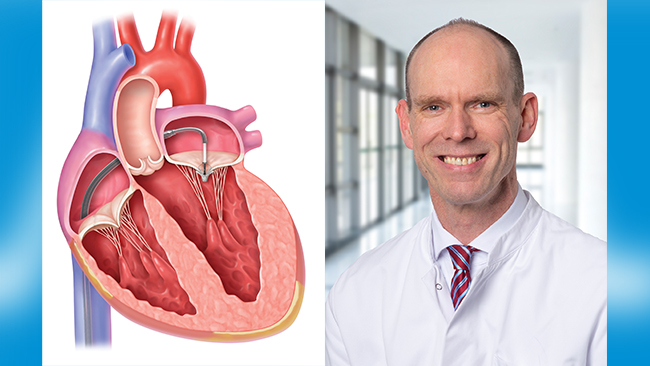
Ein gesundes Herz arbeitet wie eine kräftige Muskelpumpe und sorgt mit jedem Herzschlag dafür, dass sauerstoffreiches Blut zu den Organen und sauerstoffarmes Blut zur Lunge gepumpt wird. Im Laufe eines menschlichen Lebens schlägt ein Herz etwa 3 Milliarden Mal. Doch was, wenn der Blut-Transport innerhalb des Herzens nicht mehr richtig funktioniert?
Seit einem Jahr wird am Klinikum Traunstein das minimalinvasive Clip-Verfahren zur Behandlung schwerer Herzklappenundichtigkeiten eingesetzt. Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Südostbayern, erklärt im Gespräch, wie der Eingriff funktioniert, für wen er geeignet ist und warum bereits wenige Stunden nach dem Eingriff in der Regel eine spürbare Erleichterung beim Patienten eintritt mehr...
Herr Prof. Dr. Lehrke, warum sind funktionierende Herzklappen so entscheidend für unsere Gesundheit?
Prof. Dr. Lehrke: Die Leistung des Herzens hängt maßgeblich von intakten Herzklappen ab. Diese Ventile steuern den Blutfluss zwischen Vorhöfen und Hauptkammern sowie zwischen Hauptkammer und großen Gefäßen. Wenn Herzklappen nicht mehr korrekt schließen, kann Blut in die falsche Richtung zurückfließen, was zu einer bedeutsamen Mehrbelastung des Herzens führt und auf Dauer mit einer Herzschwäche einhergehen kann. Umgekehrt kann eine bestehende Herzschwäche durch die hiermit verbundene Vergrößerung der Herzhöhlen zu einer Klappenundichtigkeit führen: ein Teufelskreis.
Welche Symptome zeigen Betroffene und woher kommen diese?
Das hängt davon ab, welche Klappe betroffen ist (siehe auch Infokasten): Ist die Mitralklappe undicht, d. h. die Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Hauptkammer, klagen die Patienten oft über Atemnot bei körperlicher Belastung. Leistungsabfall und Herzrhythmusstörungen wie einem Vorhofflimmern. Bei einer Undichtigkeit der rechtsseitigen Trikuspidalklappe sind es eher Symptome wie Wassereinlagerungen in den Beinen und eine allgemein verringerte Belastbarkeit. In beiden Fällen ist die Lebensqualität stark eingeschränkt – viele der Betroffenen können nur noch mit Mühe kleine Wege zurücklegen.
Je nach Ursache der Klappenundichtigkeit kann eine medikamentöse Therapie angezeigt sein, welche die Undichtigkeit reduzieren und Beschwerden lindern kann. Bei hochgradigen Undichtigkeiten ist eine alleinige Medikamenten-Gabe jedoch häufig nicht ausreichend und im Verlauf eine Reparatur oder ein Ersatz der Klappe erforderlich.
Seit einem Jahr wenden Sie in Traunstein ein Katheter-basiertes Clip-Verfahren bei hochgradigen Undichtigkeiten der Mitral- oder Trikuspidalklappe an. Was genau passiert dabei?
Zur Vermeidung einer offenen Herzoperation steht mittlerweile ein Katheter-basiertes, minimal-invasives Clip-Verfahren zur Verfügung. Dieses wird in der Fachsprache auch „edge-to-edge“ Repair oder, je nach behandeltem Klappentyp, Mitra- bzw. Triclip genannt.
Stellen sie sich die Mitralklappe wie eine doppelflügelige Tür vor, bei der beide Türen verzogen sind und bei der selbst in eigentlich geschlossener Position immer noch Luft in der Mitte durchzieht oder die Flügel sogar nach hinten umschlagen und dann noch mehr Zugluft durchlassen. Mit Hilfe eines Riegels in der Mitte kann die Position der Flügeltür gesichert und Zugluft reduziert werden. Ähnlich werden die beiden Segel der Mitralklappe mit einem Clip an der Stelle der stärksten Undichtigkeit gesichert und hierdurch der Blutrückfluss reduziert.
Der Eingriff erfolgt in der Regel im Rahmen einer kurzen Vollnarkose und dauert etwa zwei Stunden. In der Regel kann der Patient oder die Patientin nach zwei Nächten die Klinik verlassen.
Sie selbst haben langjährige Erfahrung mit diesem Verfahren gesammelt?
In meiner vorherigen beruflichen Station an der Universitätsklinik der RWTH Aachen konnte ich über viele Jahre umfassende Erfahrungen mit dem Clip-Verfahren sammeln. Dieses Wissen und meine langjährige praktische Erfahrung bringe ich seit letztem Jahr im Klinikum Traunstein ein. Das hat uns erlaubt, von Anfang an ein hohes medizinisches Niveau zu bieten. Wir können dadurch auch hochbetagte, schwerkranke Patienten wohnortnah bestens versorgen. Das Clip-Verfahren hat sich in nur einem Jahr als hocheffektive Therapie und fester Bestandteil der modernen Kardiologie bei uns am Klinikum etabliert.
Welche Patienten profitieren besonders?
Vor allem für ältere Menschen mit hochgradiger Klappeninsuffizienz, also einer starken Undichtigkeit, ist der Clip nachhaltig lebensverbessernd. Die Überweisung für diesen Eingriff zu uns ins Klinikum erfolgt zumeist von den niedergelassenen kardiologischen Fachpraxen. Die Nachfrage wächst, auch weil es eine schonende und effektive Methode ist. In aller Regel merken die Patientinnen und Patienten bereits direkt nach dem Eingriff, dass sie wieder besser Luft bekommen. Danach werden sie in enger Zusammenarbeit mit den hausärztlichen und kardiologischen Praxen ambulant weiterbetreut. Die Patientinnen und Patienten sind mobiler und können wieder mehr unternehmen.
25.07.2025 - Fachklinik Berchtesgaden
Fachklinik Berchtesgaden offiziell als Fachkrankenhaus der Versorgungsstufe „Level F“ anerkannt
Bayerisches Gesundheitsministerium bestätigt spezialisiertes Leistungsprofil der Kliniken Südostbayern
Die Fachklinik Berchtesgaden wurde nun offiziell durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) als Fachkrankenhaus der Versorgungsstufe „Level F“ anerkannt. Damit erhält die Klinik eine neue Einordnung, die ihrer spezialisierten medizinischen Ausrichtung vollumfänglich Rechnung trägt. mehr...
„Die Zuweisung zur Versorgungsstufe ‚Level F‘ ist für uns eine bedeutende Bestätigung unseres strategischen Kurses: Spezialisierung, Qualität und Zukunftssicherheit“, betont Philipp Hämmerle, KSOB-Vorstand und strategisch verantwortlich für die Fachklinik Berchtesgaden. „Gleichzeitig sichern wir damit den Standort Berchtesgaden langfristig ab – für unsere Mitarbeitenden ebenso wie für unsere Patientinnen und Patienten in der Region.“
Erfüllung aller fachlichen Voraussetzungen – Fokus auf Orthopädie, Geriatrie und spezialisierte Versorgung
Grundlage der Einstufung ist die Fallstruktur der Klinik im Jahr 2024, die zeigt, dass der überwiegende Teil der behandelten stationären Fälle auf hochspezialisierte Leistungsgruppen entfällt. Insbesondere lag der Anteil der Behandlungen in den Leistungsgruppen
- Endoprothetik Hüfte (LG 23),
- Endoprothetik Knie (LG 24) und
- Geriatrie (LG 56)
bei über 80 Prozent aller Fälle – ein zentrales Kriterium für die Zuweisung zur Versorgungsstufe „Level F“. Die erforderliche Mindestverteilung auf spezifische Leistungsgruppen außerhalb der allgemeinen Inneren Medizin und Chirurgie wurde ebenfalls übertroffen.
Landkreis und Klinikleitung begrüßen zukunftsweisende Entscheidung
Auch Landrat Bernhard Kern zeigt sich zufrieden mit der offiziellen Anerkennung: „Die Fachklinik Berchtesgaden beweist seit Jahren, dass Spezialisierung und wohnortnahe Versorgung keine Gegensätze sein müssen. Die neue Zuordnung ist ein starkes Signal für die medizinische Zukunft des Landkreises Berchtesgadener Land.“
KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher ergänzt: „Die Mitarbeitenden vor Ort leisten seit Jahren hervorragende Arbeit in einem zunehmend herausfordernden Umfeld. Die Einordnung als Fachklinik ist auch Ausdruck dieser kontinuierlichen Spitzenleistung.“
Leistungsspektrum bleibt erhalten – Entwicklungsmöglichkeiten entstehen
Die Einstufung als „Level F“-Fachkrankenhaus sichert nicht nur den Status quo, sondern bietet neue Perspektiven für den Ausbau innovativer Versorgungsangebote – insbesondere in der orthopädischen und geriatrischen Rehabilitation sowie sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten.
Wichtig: Alle bestehenden Bereiche am Standort Berchtesgaden bleiben vollumfänglich erhalten. Gleichzeitig prüft die Klinikleitung mögliche nächste Schritte in Richtung sektorenübergreifender Versorgungsformen, wie vom Ministerium angeregt.
Ein wichtiger Schritt im Rahmen der Krankenhausreform
Hintergrund der Neuzuordnung ist eine bundesgesetzliche Neuregelung gemäß § 135d Abs. 4 Satz 3 SGB V, die eine differenzierte Klassifikation der Klinikstandorte und deren Leistungsspektren vorsieht. Die nun bestätigte „Level F“-Zuweisung ist Teil dieser strukturellen Reformen im deutschen Gesundheitswesen.
Die Kliniken Südostbayern sehen sich damit auf dem richtigen Weg:
„Unsere Vision ist das zukunftsfähige, spezialisierte Kliniknetz für den gesamten Südosten Bayerns – immer mit dem Fokus auf medizinische Exzellenz, regionale Verankerung und nachhaltige Personalentwicklung“, so Dr. Gretscher.
24.07.2025 - Klinikum Traunstein
Mehr Raum für Mütter und Familien in der Wochenbettstation des Klinikums Traunstein
Familienfreundlicher und flexibler: Neue Zimmerangebote unterstützen Eltern von Anfang an

Die ersten Tage nach der Geburt sind für Eltern eine ganz besondere Zeit – eine Zeit des Kennenlernens und Zusammenwachsens. In der Wochenbettstation des Klinikums Traunstein wurden nun Bettenkapazitäten und Zimmerstruktur überarbeitet, damit Mütter und Familien diese kostbaren Momente in Ruhe und Geborgenheit erleben können. Die 26 Betten der Wochenbettstation wurden nun nach Abschluss der Baumaßnahmen so verteilt, dass das Wohlergehen der Mutter und der jungen Familie im Vordergrund steht. mehr...
Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Traunstein und der Kreisklinik Bad Reichenhall, ist überzeugt von der Verbesserung: „Es ist uns wichtig, dass Mutter und Kind die ersten gemeinsamen Tage in einer positiven und behüteten Umgebung erleben. Mit den Veränderungen haben die Mütter jetzt die Möglichkeit, sich besser zu erholen, denn nicht nur das Baby ist empfindlich gegenüber unnötigen Störungen.“
Zwei zusätzliche Zwei-Bett-Zimmer
Zwei der vorgehaltenen Zimmer wurden zusätzlich in Zwei-Bett-Zimmer umgewandelt, sodass nun insgesamt unter anderem zehn Zwei-Bett-Zimmer zur Verfügung stehen. Diese Veränderung sorgt dafür, dass die Mütter mehr Ruhe und Raum haben und die Kinder weniger gestört werden – ein wichtiger Aspekt, um den Schlaf-Wach-Rhythmus von Mutter und Neugeborenem zu stabilisieren und das Trinkverhalten des Kindes zu verbessern.
Für Paare gibt es zudem die Option, ein Familienzimmer zu buchen. Dies ermöglicht es, dass die Begleitperson von Beginn an bei der Mutter bleiben kann. Das gemeinsame Erleben beginnt schon mit der Entbindung, der Partner oder die Partnerin kann das Kind gemeinsam mit der Mutter bis zur Entlassung aus der Klinik unmittelbar erleben und die Mutter unterstützen. Die gemeinsamen ersten Tage mit dem Neugeborenen schaffen eine unersetzliche Verbindung und fördern das Zusammenwachsen als Familie. Der Aufenthalt kostet für die Begleitperson etwa 90 Euro pro Tag, inklusive Vollverpflegung.
Mit diesen flexiblen Lösungen fördert die Frauenklinik nicht nur die physische Erholung der Mutter, sondern auch das emotionale Wohl der gesamten Familie. Es bietet den nötigen Raum, damit die Paare ihre neuen Rollen in einer unterstützenden Umgebung annehmen können – ohne Einschränkungen und mit der richtigen Portion Privatsphäre.
23.07.2025 - KIinikum Traunstein
Klinikum Traunstein erneut in der FAZ-Liste „Deutschland Beste Krankenhäuser“ ausgezeichnet

Bereits das achte Jahr in Folge bewertet das FAZ-Institut in Zusammenarbeit mit einer Analysegesellschaft und einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Die Kliniken Südostbayern (KSOB) wurden in der diesjährigen Studie erneut unter „Deutschlands Beste Krankenhäuser“ gelistet. mehr...
Bayernweit liegt das Klinikum Traunstein auf Platz 7 bei den Kliniken zwischen 500 und 800 Betten. Auch andere Standorte der KSOB sind in der Liste enthalten, in die überhaupt nur das obere Drittel der bewerteten Krankenhäuser Aufnahme findet. Jessica Koch, Leiterin des Klinikstandorts in Traunstein, freut sich: „Diese Auszeichnung zeigt, dass wir mitten im Chiemgau medizinische Leistungen auf sehr hohem Niveau anbieten und der hiesigen Bevölkerung damit wohnortnah beste Versorgung bieten.“
Grundlage der Analyse sind sowohl objektive Qualitätskriterien, wie die Daten aus dem Bundesklinikatlas, als auch emotionale Bewertungen aus öffentlichen Patientenportalen. Bei der sachlichen Bewertung werden die medizinische und pflegerische Qualität sowie die Services unter die Lupe genommen, die emotionale setzt sich u.a. zusammen aus den Dimensionen Gesamtzufriedenheit / Weiterempfehlung, Beratung/Behandlung und Ausstattung.
22.07.2025 - Kliniken Südostbayern
Wenn die Wunde nicht zuheilen will
Chronische Wunden sind meist ein Symptom – nicht das eigentliche Problem. Die Ursachenklärung ist für die Heilung unabdingbar
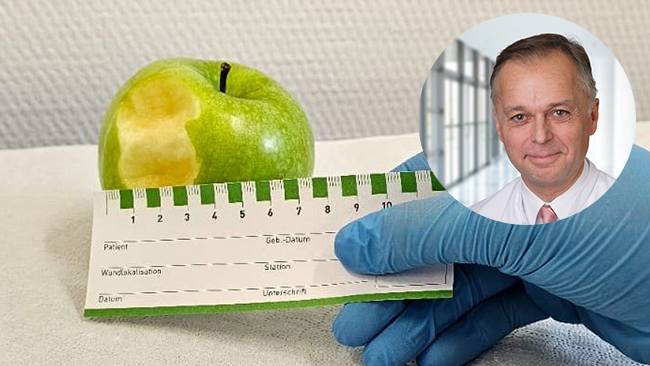
Etwa 2,3 Mio. Menschen in Deutschland haben eine chronische Wunde, die einfach nicht heilen will. Dadurch leiden sie oft unter Schmerzen und laufen Gefahr für eine Infektion oder gar für eine Blutvergiftung. Das tägliche Leben oder auch Urlaubsreisen sind eingeschränkt durch fehlende Mobilität, bis hin zur sozialen Isolation. Ein Gespräch mit Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie der Kliniken Südostbayern, über die unterschätzten Gefahren chronischer Wunden, die Suche nach den vielfältigen Ursachen und die wirksame Behandlung. mehr...
Herr Dr. Kiechle, viele Patientinnen und Patienten leben jahrelang mit offenen Wunden, meist an den Beinen. Was kann dafür der Auslöser sein?
Dr. Kiechle: Wichtig ist, die Wunde ist nicht die Erkrankung selbst, sondern ein Symptom. Und solange die Ursache dafür nicht gefunden ist, bleibt sie chronisch. Spätestens, wenn eine Wunde am Bein acht Wochen lang nicht zuheilt, sollte eine Untersuchung der Gefäße erfolgen, die in etwa 80 Prozent die Auslöser sind. Wenn Arterien verkalken, sich verengen oder verstopfen, Venenklappen versagen oder Lymphbahnen gestaut sind, fehlt dem Gewebe entweder Sauerstoff oder es sammelt sich Flüssigkeit – beides Gift für die Heilung. Die arterielle Verschlusskrankheit (AVK) etwa führt durch verengende arteriosklerotische Plaques zu einer Unterversorgung des Gewebes. Risikofaktoren sind hier Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck, hohe Blutfette und auch Erbanlagen. Auf der venösen Seite verursachen Krampfadern oder Venenschädigungen nach einer Thrombose Stauungen und Wassereinlagerungen – ein Nährboden für das „Ulcus cruris venosum“. Und bei den Lymphgefäßen führt eine Kombination aus Entzündung und angeborener Schwäche zum Lymphstau. Auch Wassereinlagerungen bei Herz- oder Nierenerkrankungen, hartnäckiger Bakterienbefall oder die chronische Entzündung kleiner oder mittelgroßer Arterien zählen zu den Übeltätern. Es kann aber auch eine Nervenschädigung zugrunde liegen, etwa bei Diabetikern, oder es handelt sich um eine spezielle Hauterkrankung durch eine fehlgeleitete Immunreaktion. Sie sehen, die Ursachen sind mannigfaltig und teils auch kombiniert, deswegen müssen wir ganz genau hinschauen. Und die eigentliche Frage muss lauten: Warum ist die Wunde überhaupt entstanden?
Sie sprechen von eingehender Diagnostik. Wie sieht das konkret aus?
Unser Ansatz beruht auf drei Säulen: Abklärung der Wundursache, dann gezielte Behandlung dieser Ursache und begleitend natürlich die entsprechende Lokalbehandlung der Wunde mit allen modernen Möglichkeiten. Es beginnt mit einer gründlichen Anamnese: Wie lange besteht die Wunde? Bestehen Schmerzen? Gab es Vorbehandlungen? Dann folgt die klinische Untersuchung: Lage, Größe, Wundrand, Umgebungsreaktion. Sind Stauungserscheinungen sichtbar? Gibt es Einschränkungen der Sensibilität? Anschließend überprüfen wir die Durchblutung – mit Pulsabtastung und Ultraschall.
Wenn nötig, folgen CT-Angiografie oder MR-Angiografie zur weiteren Gefäßabklärung. Zusätzlich schauen wir auf Laborwerte, mögliche Infektionen, und veranlassen – insbesondere bei Verdacht auf ein bösartiges Geschehen – auch eine feingewebliche, sogenannte histologische, Untersuchung. Erst wenn wir wissen, was wir wirklich vor uns haben, können wir zielgenau therapieren.
Und wie sieht dann die Behandlung aus?
Das kommt auf die Ursache an: Wenn wir beispielsweise eine arterielle Durchblutungsstörung feststellen, müssen wir diese unbedingt behandeln: Dementsprechend etwa die verengte Arterie erweitern (mittels Ballonaufdehnung oder Stent) oder operativ mit einem Bypass, also einer Blutumleitung, die Blutversorgung der Peripherie verbessern. Wenn die Venen ursächlich sind, hilft Kompression und bei größeren Schädigungen ebenfalls eine Operation. Eine Wunde braucht meist ein Debridement – das heißt, wir müssen abgestorbenes Gewebe entfernen. Wenn eine Infektion nachgewiesen ist, können wir zusätzlich mit Antibiotika gegensteuern. All das ist nur unter stationären Bedingungen möglich, denn die Behandlung ist komplex, langwierig und die Fortschritte müssen täglich überprüft werden. Wichtig ist: Keine Maßnahme wird „ins Blaue“ getroffen, sondern gezielt auf Basis der Erkenntnisse der Diagnostik.
Abtragen von abgestorbenem Gewebe klingt drastisch. Was ist noch Teil der Therapie bei Ihnen in der Gefäßchirurgie?
Zunächst sollten die Betroffenen keine Angst haben vor stationärer Behandlung, denn das Abtragen von Gewebe ist oft der erste Schritt zur Heilung. Nach einer stationären Behandlung durch unser Team in der Gefäßchirurgie können Patientinnen und Patienten nach einigen Wochen wieder wundfrei sein. Neben den angesprochenen zentralen Maßnahmen, wie etwa der Durchblutungsverbesserung oder der Wundsäuberung, spielen auch die Optimierung der Medikamente, Physiotherapie und Lymphdrainagen eine wichtige Rolle. Bei Bedarf können wir rasch die Kolleginnen und Kollegen anderer Fachrichtungen der Kliniken Südostbayern hinzuziehen, also beispielsweise die Plastische Chirurgie, die Schmerztherapie, die Kardiologie oder die Nephrologie.
Sie haben auch von Polyneuropathie und Diabetes gesprochen. Welche Rolle spielen diese Erkrankungen?
Diabetiker sind besonders gefährdet: Sie spüren Verletzungen oft nicht, weil die Nerven geschädigt sind, und gleichzeitig ist in vielen Fällen die Durchblutung der Extremitäten vermindert. So entstehen sogenannte neuropathische Ulzera – Wunden, die unbemerkt entstehen und schlecht heilen. Deshalb gilt bei Diabetikern: Nie barfuß gehen, gutes Schuhwerk tragen, Hautpflege betreiben und insbesondere: Wunden rasch abklären lassen, denn gerade beim Diabetiker besteht in dieser Situation große Dringlichkeit.
Ihr Appell an Betroffene?
Nehmen Sie kleine Wunden am Bein ernst. Wenn nach acht Wochen keine Besserung eintritt, muss eine Gefäßabklärung erfolgen. Es macht meist keinen Sinn, über Monate irgendwelche Wundauflagen auszuprobieren. Lieber einmal zu früh ins Krankenhaus als zu spät, denn eine chronische Wunde ist kein Schicksal, sondern eine Aufgabe. Und die können wir lösen.
18.07.2025 - Kliniken Südostbayern
Pflege mit Auszeichnung: Erfolgreicher Abschlussjahrgang an den Berufsfachschulen der Kliniken Südostbayern
Kliniken Südostbayern feiern 38 neue Pflegefachkräfte – Acht Staatspreise verliehen – Viele bleiben im Verbund
Große Freude an den Berufsfachschulen für Pflege der Kliniken Südostbayern AG (KSOB): Insgesamt 38 Absolventinnen und Absolventen haben ihre dreijährige generalistische Pflegeausbildung an den Standorten Traunstein und Bad Reichenhall erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden acht der jungen Pflegefachkräfte für ihre herausragenden schulischen Leistungen mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Besonders erfreulich: 22 Absolventinnen und Absolventen haben sich entschieden, im Klinikverbund KSOB zu bleiben. mehr...
Glänzende Ergebnisse an beiden Schulstandorten
In Traunstein erhielten 17 Schülerinnen und Schüler ihr Abschlusszeugnis – sechs von ihnen wurden mit einem Staatspreis des Freistaats Bayern geehrt. In Bad Reichenhall schlossen 21 Absolventinnen und Absolventen erfolgreich ab – zwei von ihnen durften sich über einen Staatspreis freuen. Die Preise würdigen hervorragende schulische Leistungen und besonderes Engagement.
Wertschätzende Worte der Gratulanten
In Bad Reichenhall überbrachte Landrat Bernhard Kern (Landkreis Berchtesgadener Land) persönlich seine Glückwünsche und lobte den Einsatz der jungen Pflegekräfte: „In den vergangenen drei Jahren haben Sie viel gelernt, Großes geleistet und sich mit großem Engagement auf Ihren zukünftigen Beruf vorbereitet. Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der nicht nur Fachwissen erfordert, sondern auch Mitgefühl, Empathie und die Bereitschaft, anderen in schwierigen Situationen beizustehen.“ Auch Steffen Köhler, Geschäftsbereichsleiter Personal und Bildung der KSOB, gratulierte den Absolventinnen und Absolventen in Bad Reichenhall herzlich: „Pflegefachkräfte sind ein zentraler Pfeiler unseres Gesundheitssystems. Umso mehr freuen wir uns über engagierte und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die ihre Ausbildung mit Bravour abgeschlossen haben.“
„Pflege ist eine Kunst – und wenn sie zur Kunst wird, ist sie voller Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit ist heute wichtiger denn je. Sie alle leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft.“, erklärte der gewählte stellvertretende Landrat Josef Konhäuser bei der Zeugnisverleihung in Traunstein. Auch Philipp Hämmerle, Vorstand der KSOB, würdigte die Leistung der Klasse und aller Beteiligten: „Herzlichen Glückwunsch! Drei Jahre generalistische Pflegeausbildung liegen hinter Ihnen – voller Fachwissen, praktischer Erfahrungen, persönlicher Entwicklung – und sicher auch mancher Herausforderung. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen an einer Ausbildung mitwirken – jede und jeder mit dem Ziel, Sie auf diesen heutigen Tag vorzubereiten. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Ihre Lehrkräfte!“
Engagement, Qualität und Perspektive
Ein wesentlicher Teil der Absolventinnen und Absolventen bleibt dem Klinikverbund treu: Sowohl in Traunstein als auch in Bad Reichenhall haben sich jeweils elf Absolventinnen und Absolventen entschieden, ihre berufliche Zukunft in den Einrichtungen der Kliniken Südostbayern AG zu starten.
Für die hohe Ausbildungsqualität stehen auch die erfahrenen Teams an beiden Standorten: In Traunstein wurde die Klasse von Klassenleiter Alexander Nißlein unter der Schulleitung von Lisa-Marie Eisenberger begleitet. In Bad Reichenhall lagen die pädagogischen Fäden bei Klassenleiter Dr. Markus Lauer und Schulleiterin Dajana Riske.
Pflege mit Perspektive
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung leisten die neuen Pflegefachkräfte einen wichtigen Beitrag zur regionalen Gesundheitsversorgung – und starten in ein Berufsfeld mit Sinn, Verantwortung und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Kliniken Südostbayern gratulieren herzlich und freuen sich, viele der Absolventinnen und Absolventen weiterhin als Kolleginnen und Kollegen im Team begrüßen zu dürfen.
17.07.2025 - Klinikum Traunstein
„Intensivstation weitergedacht“
Eva Mayr-Stihl Stiftung fördert zukunftsweisendes Projekt am Klinikum Traunstein mit 750.000 Euro
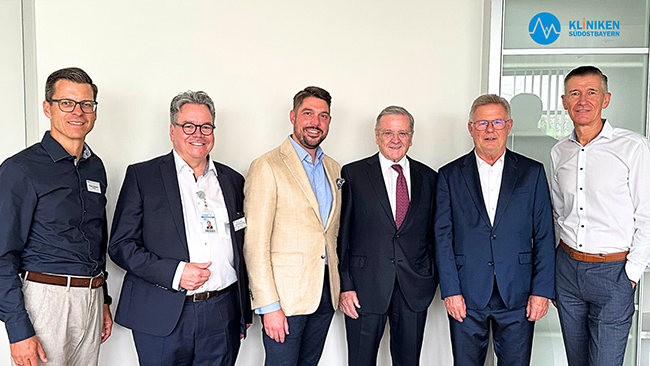
Die psychosoziale Begleitung von schwer kranken Menschen sowie innovative Lichtkonzepte in der Intensivpflege stehen im Fokus eines neuen Förderprojekts am Klinikum Traunstein. Mit einer Fördersumme von 750.000 Euro unterstützt die Eva Mayr-Stihl Stiftung das Projekt „Intensivstation weitergedacht“, das zwei zentrale Maßnahmen auf den Intensivstationen des Klinikums absichert und weiterentwickelt: den erfolgreichen psychologischen Dienst, der bereits seit drei Jahren von der Eva Mayr-Stihl Stiftung gefördert wird und die geplante Installation von biodynamischem Licht im Neubau, in den die Intensivstationen im nächsten Jahr umziehen. mehr...
Patienten auf der Intensivstation sind vielfältigen Eindrücken ausgesetzt. Neben der Schwere der Grunderkrankung oder Verletzung bringen invasive medizinische Eingriffe, mechanische Beatmung und der notwendige Einsatz starker Medikamente zusätzliche Belastungen mit sich. Faktoren wie eine Umgebung voller ungewohnter Geräusche, der häufig fehlende Tag-Nacht-Rhythmus, eingeschränkter sozialer Kontakt und die Trennung von Angehörigen können Gefühle von Angst, Verwirrung und Hilflosigkeit hervorrufen und die Genesung erschweren. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Patienten mit bestehenden Gedächtnisstörungen, mit vorbestehender Medikation sowie mit Gefäß- oder Lebererkrankungen und beatmete Patienten.
Zur Vorbeugung kognitiver und emotionaler Beeinträchtigungen wie dem Intensiv-Delir werden auch non-pharmakologische Behandlungsstrategien empfohlen. Das Klinikum Traunstein setzt bereits erfolgreich auf psychosoziale Unterstützung für Patienten und Angehörige. Mit dem Neubau der Intensivstation bietet sich nun die Möglichkeit, diese bewährten Maßnahmen gezielt zu erweitern – insbesondere durch den Einsatz von circadianem biodynamischem Licht über einem Teil der Intensivbetten. Ziel des Projekts ist die bedarfsgerechte Ausweitung multiprofessioneller, non-pharmakologischer Behandlungsstrategien auf den Erwachsenen-Intensivstationen des Klinikums Traunstein.
Bei der Übergabe der Spende hebt Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender und Stifter der Eva Mayr-Stihl Stiftung die gesellschaftliche Relevanz des Projekts hervor: „Die Förderung dieses Projekts ist uns ein Anliegen, mit dem wir die Region, in der ich geboren wurde, gerne unterstützen. Wir stehen für medizinische Innovation, die sowohl den Patienten sowie auch dem Intensivpersonal zugutekommt. Damit wollen wir auch Zeichen für eine zukunftsfähige hochwertige Versorgung setzen. Im Idealfall findet sowas dann auch in anderen Regionen Nachahmer.“
Siegfried Walch (MdB) dankt Robert Mayr für die Verbundenheit: „Es ist ein Segen, dass Sie unsere gemeinsame Heimat so im Blick haben. Da entsteht immer wieder etwas Besonderes für die Menschen, das Land und unsere Traditionen. Und dafür kann ich Ihnen nicht genug danken. Vergelt’s Gott.“ Josef Konhäuser, gewählter stellvertretender Landrat des Landkreises Traunstein, würdigt das Engagement: „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und ganz besonders in kritischen Lebenssituationen kann die Versorgung nicht gut genug sein. Ein besonderer Dank daher an Robert Mayr und die Eva Mayr-Stihl Stiftung, die uns dabei hilft, die schon sehr gute Versorgung immer weiter zu entwickeln.“
Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Südostbayern, betont wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Stiftung ist und wieviel Sinnvolles daraus immer wieder hervorgeht: „Wir sind der Stiftung sehr dankbar für diese wiederholt sehr großzügige Unterstützung. Damit können wir wegweisende Ansätze in der Intensivversorgung nachhaltig absichern und weiterentwickeln. Das kommt unseren Patienten zugute und auch unseren Mitarbeitern – und genau das ist unser Anliegen. Dank Ihrer Förderungen können wir hier viel ermöglichen.“
Der Ärztliche Leiter des Klinikums Traunstein, PD Dr. Tom-Philipp Zucker, stimmt zu und erklärt die Bedeutung nicht-medikamentöser Strategien: „Die Anwendung von nicht-pharmakologischen Behandlungsstrategien bei Delir werden in den Leitlinien empfohlen und auch der Einsatz von circadianem Licht kann dazu beitragen. Idealerweise lässt sich damit auch eine schnellere funktionelle Erholung beobachten. Berichten aus anderen Kliniken zu Folge konnte mit der Installation von entsprechenden Lichtdecken eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation beobachtet werden. Besonders dankbar sind wir auch für die Förderung des psychologischen Dienstes über weitere drei Jahre. Das hat bereits vielen Menschen sehr geholfen.“
16.07.2025 - Fachklinik Berchtesgaden
Fachklinik Berchtesgaden zählt zu den besten Kliniken für geriatrische Erkrankungen
„stern“-Liste der besten Rehakliniken Deutschlands 2025/2026 bestätigt exzellente Versorgung der Patienten
Die Fachklinik Berchtesgaden wurde in der aktuellen, nicht durchnummerierten Liste des Magazins „stern“ als eine der besten Rehakliniken Deutschlands 2025/2026 ausgezeichnet – und zwar im Fachbereich Geriatrische Erkrankungen. Die renommierte Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen Datenerhebung in Zusammenarbeit mit dem Institut MINQ (Munich Inquire Media) und würdigt herausragende medizinische Qualität, Patientenzufriedenheit und interdisziplinäre Versorgungskonzepte. mehr...
Bemerkenswert: Auch, wenn am Standort Berchtesgaden keine geriatrische Rehabilitation mehr angeboten wird, spiegelt die Auszeichnung die hohe Expertise des Hauses in der akutgeriatrischen Behandlung älterer Patientinnen und Patienten wider. Denn die Abteilung für Akutgeriatrie wurde im vergangenen Jahr gezielt ausgebaut und weiterentwickelt.
„Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, freut sich Philipp Hämmerle, Vorstand der Kliniken Südostbayern und strategisch verantwortlich für den Standort Berchtesgaden. „Sie zeigt: Auch nach der Umstrukturierung bleibt die Behandlung geriatrischer Erkrankungen in Berchtesgaden ausgezeichnet – im wahrsten Sinne des Wortes.“
Die Akutgeriatrie in der Fachklinik Berchtesgaden betreut jährlich viele ältere Menschen, die aufgrund ihrer Mehrfacherkrankungen, altersbedingter Einschränkungen und Sturzfolgen der besonderen medizinischen und therapeutischen Aufmerksamkeit bedürfen. Im Fokus stehen nicht nur die akute medizinische Versorgung, sondern auch frühzeitige Mobilisierung, soziale Begleitung und die nachhaltigen Behandlungsziele – immer mit Blick auf Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alter.
Mit der anerkannten medizinischen Expertise, dem engagierten Pflege- und Therapeutenteam sowie der herausragenden Lage im Berchtesgadener Land ist die Klinik ein bedeutender Gesundheitsstandort in der Region – und nun auch offiziell unter Deutschlands Besten gelistet.
14.07.2025 - Klinikum Traunstein
Wenn das Ich verschwindet – Demenz im Visier
zum Welttag des Gehirns

1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz, Tendenz steigend. Was ist heute möglich – medizinisch, pharmakologisch? Zum Welttag des Gehirns am 22. Juli werfen wir mit Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie der Kliniken Südostbayern, einen Blick auf eine Krankheit, die sich bislang nicht heilen lässt, aber immer besser verstanden und behandelt werden kann. mehr...
Demenz ist Verschwinden auf Raten
Sie kommt leise. Kein Knall, kein Schmerz, nur Verlegenheit: „Wo habe ich nur die Schlüssel hingelegt?“ Ein Name fällt nicht ein, später findet man den Weg nach Hause nicht mehr. Was viele für altersbedingte Schusseligkeit halten, entpuppt sich manchmal als das erste leise Anklopfen der Demenz. Eine Krankheit, die nicht tötet – aber das Ich ausradiert. Prof. Dr. Thorleif Etgen ordnet ein: „Demenz ist ein Oberbegriff. Gemeint sind Krankheitsprozesse, die mit einem zunehmenden Verlust geistiger Fähigkeiten einhergehen – allen voran das Gedächtnis, aber auch Sprache, Orientierung und Urteilsvermögen. Die häufigste Form ist Alzheimer. Es folgen vaskuläre Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz und frontotemporale Demenz. Gemeinsam ist ihnen: Nervenzellen sterben, synaptische Verbindungen zerfallen, das Gehirn schrumpft.“ Irreversibel – so das medizinische Urteil bisher.
Diagnose: Bildgebung und Analysen
In der modernen Diagnostik setzt die Medizin neben Anamnese und neuropsychologische Tests auf Labor und bildgebende Verfahren. Prof. Dr. Etgen erklärt: „Wir im Klinikum Traunstein setzen bevorzugt die Kernspintomographie (MRT) ein, die ohne Röntgenstrahlen arbeitet, sondern Magnetfelder und Radiowellen nutzt. Sie liefert detaillierte Bilder des Gehirns und zeigt besonders gut feine Veränderungen – etwa den Verlust von Hirnsubstanz in bestimmten Regionen (z. B. im Hippocampus bei Alzheimer). Auch Mikroblutungen oder entzündliche Prozesse lassen sich gut erkennen. Neben Blutuntersuchungen erfolgen Analysen des Nervenwassers (Liquor), die inzwischen zusammen mit den anderen Untersuchungen oft in einem frühen Stadium eine Diagnose erlauben.“
Altbewährtes und Neues in der medikamentösen Therapie
Die medikamentöse Therapie ist ein Feld mit Licht und Schatten. Seit zwei Jahrzehnten stehen vier zugelassene Wirkstoffe zur Verfügung: drei Acetylcholinesterase-Hemmer (Donepezil, Rivastigmin, Galantamin) und ein NMDA-Rezeptor-Antagonist (Memantin). Sie wirken nicht heilend, doch sie können in frühen bis mittleren Stadien die Symptome verzögern. Prof. Dr. Etgen berichtet von neuesten Entwicklungen: „Seit April 2025 ist in der EU ein neues Medikament zugelassen: Der Wirkstoff Lecanemab ist für die Behandlung von Alzheimer-Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder frühen Demenzstadien mit nachgewiesener Amyloid-Pathologie bestimmt und wird als intravenöse Infusion alle zwei Wochen verabreicht. Studien zeigen: Lecanemab greift als erstes Medikament in die Pathophysiologie der Alzheimer-Krankheit ein und verlangsamt das Fortschreiten. Allerdings kann diese Therapie mit Nebenwirkungen, wie infusionsbedingten Reaktionen, Kopfschmerzen und Gehirnschwellungen, behaftet sein. Ob und zu welchen Bedingungen die Zulassung in Deutschland erfolgen wird, ist derzeit noch ungeklärt.“
Ein Leben lang – beeinflussbare Risikofaktoren
In ihrem aktuellen Update von 2024 identifiziert die „Lancet“ Kommission die 14 folgenden beeinflussbaren Risikofaktoren für Demenz: geringe Ausbildung, Hörstörungen, erhöhtes LDL-Cholesterin, Depression, Schädelhirntrauma, körperliche Inaktivität, Diabetes mellitus, Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, Alkoholkonsum, soziale Isolierung, Luftverschmutzung und Sehstörungen. Die Kommission empfiehlt eine entsprechende Steuerung und Vorgehensweise, denn durch die Reduzierung dieser Faktoren könnte ggf. die Zahl der Demenzerkrankungen fast halbiert werden. Prof. Dr. Etgen bestätigt: „Auch wir in der Neurologie am Klinikum Traunstein weisen auf die Bedeutung dieser Faktoren hin.“
Nach der Diagnose – lokale Strukturen nutzen!
Er erläutert die Vorgehensweise: „Nach der Diagnose, die unseren Patienten im Idealfall zusammen mit Angehörigen erläutert wird, ist es wichtig, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Neben der Optimierung der oben erwähnten Risikofaktoren empfehlen wir die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit lokalen Hilfsangeboten (z.B. Pflegestützpunkt, Caritas, DRK, VDK, etc.) und Fachgesellschaften (z.B. Alzheimer Gesellschaft Südostbayern). Wir engagieren uns mit vielen Helfer*innen in der ‚Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz im Landkreis Traunstein‘.“ Weitere Themen umfassen die Anregung einer Vorsorgeplanung, Beantragung eines Pflegegrades, häusliche Hilfsmittel, Klärung der Fahrtauglichkeit, etc. Nicht vergessen werden darf die Unterstützung für Angehörige, um eine Überforderung rechtzeitig durch Entlastungsangebote zu vermeiden.
Forschung: Ein Rennen gegen die Zeit
Weltweit wird intensiv geforscht: Über 140 Wirkstoffe befinden sich derzeit in klinischer Prüfung. Darunter: Immuntherapien, Enzymhemmer, Gentherapieansätze. Doch der Weg von der Petrischale zum Patientenbett ist lang – und gepflastert mit Rückschlägen. Viele Studien scheitern, manche nach Milliardeninvestitionen. Doch der Fortschritt ist da: Die Pathomechanismen werden klarer, die Zielstrukturen präziser. Noch ist Demenz ist nicht heilbar, doch die Therapien werden zielgerichteter. Prof. Dr. Etgen resümiert: „Frühe Diagnostik, symptomlindernde Medikamente und begleitende Maßnahmen bilden ein Dreiklang, der das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen kann. Wer heute mit Demenz lebt, lebt anders als noch vor zwanzig Jahren. Das ist noch kein Triumph über die Krankheit. Aber ein vielversprechender Fortschritt.“
11.07.2025 - Klinikum Traunstein
„Ich hatte so viel Glück“
Ein besonders schwerer Schlaganfall, eine sofortige Therapie mit großer Expertise und ein Patient, der heute wieder sein Leben ganz normal lebt
Ein Schlaganfall aus heiterem Himmel am Karfreitag-Nachmittag bringt das Leben des 64-jährigen Josef H. aus Trostberg beinahe zum Stillstand. Doch dank der sofortigen Behandlung durch das spezialisierte Team der Überregionalen Stroke Unit im Klinikum Traunstein (Chefarzt Prof. Dr. Thorleif Etgen) ist heute fast alles wieder wie vorher. Ein Bericht über Minuten, die über Leben und Gesundheit entscheiden – und ein Appell, sie nicht zu verschenken. mehr...
Ein Karfreitag, der alles veränderte
Es war ein gemütlicher Feiertagsausflug, wie ihn viele Paare verbringen: Josef H., ganz kurz vor der Rente – seinen Ausstand im Betrieb hat er schon gegeben – sitzt mit seiner Frau Angela und einem befreundeten Ehepaar in einem Restaurant in Seeon. Fischessen, gute Gespräche, ein Bier. „Plötzlich fing er an, wirr zu sprechen und er lallte“, erinnert sich seine Ehefrau Angela H. „Ich fragte mich noch: Hat er vielleicht zu viel getrunken?“ Doch die Freundin winkt ab – ein einziges Bier. Dann kippt Josef zur Seite, langsam, aber unaufhaltsam. Angela H. reagiert instinktiv: „Ich wusste, er darf nicht umkippen. Ich habe ihn gehalten, beruhigt, versucht, dass er gerade sitzt. Ich wusste sofort: jetzt pressiert es, das sieht aus wie ein Schlaganfall.“ Was Josef H. selbst davon noch weiß? „Ich war irgendwie benommen. Ich dachte mir noch: Was redet die da? Mir geht’s doch gut.“
Was folgt, ist die perfekte Rettungskette: Die Freundin setzt sofort den Notruf 112 ab mit der Information, dass es sich wahrscheinlich um einen Schlaganfall handelt, der Rettungswagen trifft nur wenige Minuten später ein. Um 15:45 Uhr beginnt für den 64jährigen der Kampf gegen die Zeit – und gegen die Aussicht auf ein Leben mit schwersten Behinderungen.
Sofortige intensive Behandlung
Um 16:11 Uhr erreichte der Rettungswagen die Klinik. Josef H. weiß ab jetzt nur noch Sekunden-Bruchstücke: „Blaulicht, ein Rollstuhl, die Notärztin, ein Schild mit dem Namen ‚Schwester Anna‘ – wie meine Tochter. Eine unwirkliche Situation.“
Priv.-Doz. Dr. Philip Hölter, Leitender Oberarzt der Neuroradiologie am Klinikum Traunstein und zertifizierter Schlaganfallexperte, erklärt den Ernst der Lage: „Herr H. hatte einen sogenannten Tandemverschluss, also einem Verschluss der Halsschlagader und der mittleren hirnversorgenden Arterie. Das bedeutet, seine rechte Gehirnhälfte war nahezu komplett von der Blutversorgung abgeschnitten. Das sind die großen, schlimmen Schlaganfälle. Zur Erklärung: Mit jeder Minute ohne Behandlung sterben etwa zwei Millionen Nervenzellen ab. Zwar können manche Gefäße auch bis zu 24 Stunden später noch minimal-invasiv geöffnet werden, doch die Gefahr bleibender Schäden steigt stark. Pro Stunde Verzögerung sinkt die Chance auf eine selbstständige Genesung um rund 20 Prozent. Deshalb gilt: ‚Time is brain‘ – Zeit ist Gehirn!“
Wie ein Schweizer Uhrwerk
Im Klinikum Traunstein greifen alle Abläufe wie ein präzises Uhrwerk ineinander – ein medizinisches Meisterstück, selbst an Feiertagen. Priv.-Doz. Dr. Hölter erinnert sich: „Herr H. war schwer betroffen: Er konnte die linke Körperseite nicht bewegen, der Mundwinkel hing, und er hatte starke Sprachstörungen.“ Deshalb ist der sogenannte FAST-Test so wichtig, erklärt Priv.-Doz. Dr. Hölter: „FAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit). Damit erkennt man schnell einen Schlaganfall und weiß: Keine Zeit verlieren!“
Bereits während der CT-Untersuchung erhält der Patient eine sogenannte Lysetherapie: Ein Medikament soll das Blutgerinnsel im Gehirn zumindest teilweise auflösen. Direkt im Anschluss folgt der nächste entscheidende Schritt – die minimal-invasive, mechanische Entfernung des Gerinnsels an der Angiografieanlage, die sogenannte Thrombektomie.
Enge Zusammenarbeit für einen komplexen Eingriff
Priv.-Doz. Dr. Hölter führt die interventionelle Therapie persönlich durch: „Der Eingriff war besonders anspruchsvoll: Die Halsschlagader war am Eingang stark verengt – das machte es schwierig, überhaupt bis zum Gefäßverschluss vorzudringen. Dennoch gelang es, das Blutgerinnsel sowohl aus der rechten Halsschlagader als auch aus der mittleren Hirnarterie mit speziellen Absaugkathetern zu entfernen.“ Doch damit war es nicht getan: Die verengte Halsschlagader musste zusätzlich mit einer Gefäßstütze, einem sogenannten Stent, offengehalten werden – sonst hätte sie sich erneut verschlossen.
„Eine solche Operation ist Millimeterarbeit, fordert höchste Konzentration und jahrelange Erfahrung, um die Spezialkatheter und den Stent an die exakten Positionen zu platzieren, ohne dabei Gefäße verletzen“ so Priv.-Doz. Dr. Hölter weiter, „Die mechanische Entfernung von Blutgerinnseln, zusammen mit der medikamentösen Therapie, ist heute der Goldstandard in der Schlaganfallbehandlung. Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie, der Anästhesie sowie mit speziell geschultem radiologischem Fachpersonal ist. Nur so gelingen komplexe Eingriffe wie dieser.“
Gute Betreuung für Patient und Angehörige
Sechs Tage bleibt Josef H. in der Klinik – einen Tag auf der Intensivstation, vier auf der Stroke Unit und einen auf der Normalstation. Noch am Tag der Einlieferung wird Josef H. bereits wieder extubiert. „Ich wusste gar nicht, dass ich einen Schlaganfall hatte. Als ich auf der Intensivstation wach wurde, dachte ich: Wo bin ich eigentlich?“ Die Erinnerung ist bruchstückhaft, doch das Gefühl von Sicherheit ist präsent: „Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt.“
Seine Ehefrau Angela erinnert sich an die emotionale Achterbahnfahrt. „Ich fragte mich: Wie geht es weiter mit ihm – und mit unserem Leben?“ Die ganze Familie ist ins Krankenhaus gekommen. Schon während Josef H. behandelt wird, kommt eine Neurologin zur Familie und gibt ihr den entscheidenden Halt: „Es sieht sehr gut aus. Er hat sehr gute Chancen.“ Dieser Satz schenkt ihr und der ganzen Familie Zuversicht.
Schnell wieder auf den Beinen
Heute, nur zwei Monate später, kann Josef H. wieder alles machen wie zuvor und sein Leben ohne bleibende Einschränkungen leben: „Ich kann wieder Auto fahren, ins Fitnessstudio gehen, schwimmen. Beim Gewichtheben merke ich nur, dass die linke Seite noch etwas schwächer ist. Beim Schwimmen habe ich einen leichten Drall nach rechts. Aber das ist alles.“ Die Ehefrau ergänzt: „Das nennt man wohl Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau.“ Einen Satz sagt Josef H. mehrmals: „Ich hatte so viel Glück.“
Der Vorfall war ein Weckruf: „Ich war sportlich, habe auf Ernährung geachtet, nie gedacht, dass mich so etwas betreffen könnte. Jetzt nehme ich lediglich ASS, Statine und Blutdrucksenker. Und ich rauche nicht mehr.“ Der implantierte Stent wird regelmäßig kontrolliert – momentan vierteljährlich, später halbjährlich. „So gut wie bei Herrn H. verläuft die Genesung bei einem Tandemverschluss leider nicht immer“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Hölter. „Selbst bei einem erfolgreichen Eingriff sind die Aussichten schlechter als bei einem “einfachen“ Gefäßverschluss. Das war schon ein besonderer Fall. Das Wichtigste für Josef H. ist jetzt: dranbleiben und regelmäßig zur Kontrolle gehen.“
„Lassen Sie sich durchchecken!“
Josef H. ist dankbar – vor allem seiner Frau, aber auch dem gesamten Team am Karfreitag, der Notärztin und dem Klinikpersonal. „Ohne sie wäre ich heute nicht mehr ich.“ Seine Botschaft ist klar: „Ich kann nur jedem raten: Lasst euch durchchecken. Ich hätte nie geglaubt, dass mich das mal betrifft – aber es kann jeden treffen, auch wenn man sich gesund fühlt.“
Auch Priv.-Doz. Dr. Philip Hölter formuliert einen Appell: „Achten Sie auf Warnzeichen. Nutzen Sie den FAST-Test. Und zögern Sie nicht, sofort den Notruf zu wählen. Denn bei einem Schlaganfall zählt jede Minute!“
Stroke Units in Traunstein und in Bad Reichenhall
Das Klinikum Traunstein ist eine von nur 25 Partnerkliniken im Schlaganfallnetzwerk TEMPiS und zählt zu nur zwei Standorten im gesamten südostbayerischen Raum, die für Thrombektomien zertifiziert sind. Es verfügt zwischen München und Salzburg über die einzige „Überregionale „Stroke Unit“, in der das gesamte Spektrum moderner Schlaganfalltherapien rund um die Uhr verfügbar ist. Davon profitieren auch die Bewohner angrenzender Landkreise, und hier besonders die Patientinnen und Patienten aus dem Berchtesgadener Land: Die telemedizinische, vernetzte Stroke Unit der Kreisklinik Bad Reichenhall kooperiert sehr eng mit der im Klinikum Traunstein. „Solche Einrichtungen wie die unsere sind hochspezialisiert“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Philip Hölter. „Wir verfügen über eine engmaschige Zusammenarbeit zwischen Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie und weiteren Fachdisziplinen. Gerade in ländlichen Regionen ist es entscheidend, dass hochspezialisierte Schlaganfallversorgung unmittelbar verfügbar ist – und genau das leisten wir hier: modernste Stroke-Kompetenz auf universitärem Niveau mitten im Chiemgau, ohne lange Wege nach München, Passau oder Regensburg.“
FAST-Test – So erkennen Sie einen Schlaganfall:
- Face – Hängt ein Mundwinkel schief?
- Arms – Können beide Arme gehoben werden?
- Speech – Ist die Sprache verwaschen oder unverständlich?
- Time – Keine Zeit verlieren! Sofort 112 wählen!
10.07.2025 - Klinikum Traunstein
Millimeterarbeit im Kopf – Mit Hightech gegen Hirntumoren
Eine Technik, die Strukturen im Gehirn zeigt

In der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein ist die Zukunft schon Realität. Dank einer Hightech-Kombination aus modernster Neuronavigation und intraoperativem Hochleistungsultraschall gelingt es Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger und seinem Team, Hirntumoren präziser, schneller und sicherer zu entfernen als je zuvor. mehr...
Das Gehirn – kein anderes Organ ist so empfindlich, so komplex – und so schwer zugänglich. Wer hier operiert, arbeitet zwischen lebenswichtigen Strukturen. Jeder Millimeter zählt und jeder Fehler hat fatale Auswirkungen. Umso wichtiger ist, was Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger, Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein, mit sachlicher Begeisterung beschreibt: „Stellen Sie sich unser Neuronavigationssystem vor wie ein Navi fürs Gehirn – nur viel präziser. Und jetzt haben wir zusätzlich ein spezielles Ultraschallgerät, das direkt an die Neuronavigation angebunden ist. Das erlaubt uns eine hochauflösende, intraoperative Bildgebung in Echtzeit. Diese Kombination aus Neuronavigation und Ultraschall ist eine absolute Besonderheit – über so eine High-End-Ausstattung verfügen wirklich nur wenige Kliniken in Deutschland – darauf sind wir schon ein bisschen stolz.“
Tatsächlich ermöglicht es das System, krankhafte Veränderungen wie Tumoren während einer Operation exakt zu lokalisieren – in dreidimensionalen Bildern und mit einer Genauigkeit, die vor wenigen Jahren noch undenkbar war. „Es zeigt uns nicht nur, wo sich der Tumor befindet, sondern auch, welche gesunden Strukturen wir unbedingt schonen müssen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Rachinger.
Mehr Sicherheit, weniger Belastung
Der Nutzen für die Patienten ist konkreter und spürbarer als jede Statistik: „Wir können sicherer operieren, mit kleinerem Zugang, kürzerer OP-Zeit und geringerem Infektionsrisiko“, sagt Priv.-Doz. Dr. Rachinger. „Und wir wissen am Ende der Operation, ob wir wirklich alles krankhafte Gewebe entfernt konnten.“
Ein Vorteil, der nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zählt: Wer weniger belastet wird, erholt sich schneller. Wer nicht bangen muss, ob der Tumor vollständig entfernt wurde, kann ruhiger schlafen. Für Priv.-Doz. Dr. Rachinger ist das ein zentrales Anliegen: „Es ist immer ein Spagat: möglichst viel Tumor entfernen – aber möglichst wenig gesundes Gewebe verletzen. Mit dieser Technik gelingt uns dieser Balanceakt jetzt besser als je zuvor.“
Technologie trifft langjährige Expertise
Priv.-Doz. Dr. Rachinger ist keiner, der sich leicht beeindrucken lässt. Zu lange ist er schon im Fach und arbeitet auch schon lange hauptsächlich im Bereich der Gehirntumoren. Wer ihm zuhört, merkt schnell: Technik ist für ihn kein Selbstzweck. Sie ist Werkzeug und Verpflichtung, das maximal Mögliche für die Patienten auszuschöpfen. Doch bei der Kombination von Neuronavigation und Ultraschall kommt auch bei ihm ein Hauch von Begeisterung durch. „Ich verfolge die Entwicklung seit ihren Anfängen – und habe sogar darüber promoviert“, sagt er. „Aber die Fortschritte sind enorm, auch in den letzten Jahren. Wir haben heute Möglichkeiten, von denen wir früher nur träumen konnten.“ Und er resümiert: „Das Wichtigste für mich dabei ist aber, dass ich heute präziser operieren kann als je zuvor – und damit bessere Ergebnisse für unsere Patientinnen und Patienten erziele.“
10.07.2025 - Kliniken Südostbayern
Initiative „Intensivhelden“ ins Leben gerufen
Selbsthilfegruppen für ehemalige Intensivpatienten und Angehörige starten in Traunstein

Mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung wurde im Selbsthilfezentrum Traunstein der AWO in Kooperation mit den Kliniken Südostbayern die neue Initiative „Intensivhelden“ ins Leben gerufen. Knapp 30 Teilnehmer darunter ehemalige Intensivpatienten, Angehörige sowie Mitarbeiter der Intensivstationen des Klinikums Traunstein kamen zusammen, um einen neuen Begegnungsraum zu schaffen. mehr...
Dazu gab es zunächst Impulsvorträge, die das Thema „Intensivstation“ aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten. Dabei wurde eines sehr deutlich: Die Erlebnisse auf einer Intensivstation hinterlassen ihre Spuren bei den Patientinnen, ihren Angehörigen, aber auch bei jenen, die dort arbeiten. Mit dabei auch der Chefarzt der Operativen Intensivstation und Ärztlicher Leiter am Klinikum Traunstein, Priv.-Doz. Dr. med. Tom-Philipp Zucker, der die Initiative unterstützt und Christina Hille, die Leiterin des Selbsthilfezentrums, wo die Räume und die Erfahrungen für die Selbsthilfearbeit zur Verfügung gestellt werden.
„Immer wieder erlebe ich, dass aus Sicht der Patienten die Intensivstation zunächst als sehr beängstigend erlebt wird,“ erklärt Oberarzt Holger Liermann in seinem eindrücklichen Beitrag. „Man wacht auf – umgeben von Maschinenmedizin. Es piepst, es blinkt, man versteht nichts. Aber man merkt: Es ist ernst. Ich liege auf der Intensivstation. Mein Leben ist in Gefahr.“ Dann schildert der Oberarzt seine Perspektive der Intensivstation, das gleiche Umfeld, aber aus seiner professionellen Sicht: „Für uns ist die Intensivstation hingegen ein Ort der Geborgenheit . Besonders wenn wir Patienten in Notfallsituationen von anderen Stationen oder von zu Hause holen, sind wir froh, wenn wir mit ihnen unseren sicheren Hafen, die Intensivstation, erreicht haben. Hier haben wir alles, hier können wir bestmöglich helfen. Natürlich begleiten wir hier auch Leid. Manche Menschen bleiben lange, manche versterben. Dann sorgen wir dafür, dass sie keine Schmerzen haben und keine Atemnot. Wir kümmern uns. Das ist unsere Aufgabe und für mich ist es auch eine Erfüllung. Ich arbeite gerne auf der Intensivstation.“ Er betont noch, wie sehr ihn das „stille Heldentum“ der Patienten und ihrer Angehörigen beeindruckt: „Was diese Menschen leisten, wird oft nicht gesehen. Wir aber sehen es. Diese Selbsthilfegruppe ist eine wunderbare Idee. Endlich entsteht ein Raum, in dem all diese Erfahrungen Platz haben und gewürdigt werden.“
Froska Ivic, die Intensivpflegekraft berichtete, wie viel es ihr bedeutet, wenn ehemalige Patienten sie auf der Straße erkennen: „Wenn sie sich an mich erinnern, dann zeigt es mir, dass meine Pflege Spuren hinterlässt. Das stärkt mich für den Alltag.“
Die Initiatorin der Selbsthilfegruppen, Gisela Otrzonsek, vom psychologischen Dienst, der auf den Intensivstationen im Klinikum Traunstein von der Eva Mayr-Stihl Stiftung ermöglicht wird, beschrieb die Intensivstation als einen Ort der Extreme: „Nirgendwo ist das Leben so verdichtet, so nah, so intensiv wie auf einer Intensivstation. Hier erlebt man in kurzer Zeit eine unglaubliche Vielfalt an Persönlichem und an Persönlichkeiten. Mein Traum war es immer, dass all das in einer Selbsthilfegruppe Raum finden darf. Ihre Kollegin fügt hinzu, dass die Intensivstation ein Ort voller Emotionen und Geschichten ist und wünscht sich, dass auch diese in den Selbsthilfegruppen ihren Raum finden dürfen, voller Wärme, Verständnis und Willkommen-Sein. Mit den ‚Intensivhelden‘ geht dieser Traum für die beiden in Erfüllung. Die Erfahrungen aus der Selbsthilfegruppe dürfen auch an das Klinikteam kommuniziert werden, so kann ein fruchtvoller Austausch entstehen, in dem man voneinander lernen kann.
Zwei Gruppen – ein Ziel: Miteinander verarbeiten
Die neue Selbsthilfegruppe „Intensivhelden“ richtet sich in getrennten Gruppen an ehemalige Patienten und an Angehörige. Ziel ist der offene, ehrliche und stützende Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. „Nur wer selbst betroffen war, kann eine solche Gruppe leiten,“ betont Christina Hille, vom Selbsthilfezentrum der AWO – die geschulte und erfahrene Sozialpädagogin und ihr Team helfen zu Beginn beim Aufbau. Danach leitet und trifft sich die Gruppe selbstständig.
Möglich ist, was guttut: Gesprächsabende, Vorträge mit Experten, gemeinsame Ausflüge oder das Kennenlernen von Entspannungsmethoden wie Qi Gong, Feldenkrais oder Meditation. Die Gruppen finden monatlich statt – vor Ort im AWO-Selbsthilfezentrum Traunstein, aber auch virtuell über eine datensichere Plattform kann man teilnehmen. Die Gruppen sind offen für Betroffene aus ganz Deutschland. Denn es gibt noch sehr wenig dieser Angebote. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Betroffenen sind eingeladen und herzlich willkommen.
Termine:
- Patientengruppe: ab 05. August,
jeden 1. Dienstag im Monat, 18 bis 20 Uhr - Angehörigengruppe: ab 12. August
jeden 2. Dienstag im Monat, 18 bis 20 Uhr
Anmeldung und Informationen:
0861-209764 -23 oder -25 oder
07.07.2025 - Kliniken Südostbayern
Kliniken Südostbayern schließen 2. Überwachungsaudit für Energiemanagement erfolgreich ab

Die Kliniken Südostbayern (KSOB) haben das 2. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 50001:2018 im Bereich Energiemanagement erfolgreich absolviert. Das Audit, das vom 23. bis 24. Juni 2025 durchgeführt wurde, bestätigte der Klinikgruppe das bestmögliche Ergebnis: einen uneingeschränkten Auditbericht ohne Abweichungen. „Wir freuen uns über dieses starke Ergebnis, das uns nicht nur in unserer strategischen Ausrichtung, sondern auch im alltäglichen Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bestätigt“, erklärt KSOB-Vorstand Philipp Hämmerle. mehr...
Ziel des Überwachungsaudits war es, die Einhaltung der Richtlinien des Energiemanagementsystems sowie die kontinuierliche Verbesserung energiebezogener Prozesse zu überprüfen. Das Ergebnis zeigt deutlich: Die KSOB erfüllen sämtliche Anforderungen der Norm in vollem Umfang. Besonders positiv hervorgehoben wurden von den externen Auditoren unter anderem die fortschreitende Digitalisierung, der Ausbau der Zählerinfrastruktur sowie die Einführung eines CAFM-Systems (Computer Aided Facility Management).
„Die Organisation ist in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sehr gut aufgestellt“, heißt es im Prüfbericht. Das hohe Maß an Kommunikation zwischen operativer Ebene und Standortleitungen wurde ebenfalls lobend erwähnt, ebenso wie das umfassende Bewusstsein für Themen der Energieeffizienz im gesamten Klinikverbund.
Digitalisierung als Schlüsselfaktor
Ein zentraler Bestandteil der erfolgreichen Auditierung war die Einführung und Nutzung des CAFM-Systems zur digitalen Erfassung, Messung und Auswertung aller relevanten Verbrauchsdaten. In der Klinik Traunstein ist das System bereits vollständig in Betrieb; die Anbindung weiterer Standorte wie Trostberg ist bereits erfolgt oder in Vorbereitung. Parallel dazu wurde auch die Zählerstruktur in verschiedenen Bereichen weiter ausgebaut.
Energieeffizienz trotz wirtschaftlicher Herausforderungen
Trotz der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage im Gesundheitswesen investiert die KSOB kontinuierlich in energieeffiziente Technologien. Dazu zählen neue Brenneranlagen, der Austausch veralteter Pumpensysteme, energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden sowie moderne Gebäudeleittechnik (GLT). Zur strukturierten Datenanalyse kommt das System „SIEMENS Xcelerator“ zum Einsatz.
Nachhaltige Versorgung über den Klinikverbund hinaus
Ein weiteres Beispiel für nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist die Versorgung der neuen Kindertagesstätte in Trostberg, betrieben durch die Stadt Trostberg, mit Wärmeenergie aus der Pelletheizung des benachbarten Mitarbeiterwohnheims. Hierbei wird etwa ein Drittel der Wärme als sogenannte Drittmenge weitergeleitet.
Anerkennung für systematische Umsetzung
Das Auditteam bestätigte der Klinikgruppe, dass sämtliche relevanten Aspekte wie Zielsetzungen, Prozessstruktur, Ressourcenmanagement, Messung und Analyse sowie die kontinuierliche Verbesserung professionell umgesetzt werden. Die Audits erfolgten durch Vor-Ort-Begehungen und Stichprobeneinsichten in dokumentierte Informationen.
05.07.2025 - Klinikum Traunstein
Wenn Eltern mit ihrem Baby an ihre Grenzen kommen
Über Belastungen offen sprechen hilft
Wir alle kennen die Bilder von glücklich strahlenden Eltern mit einem zufriedenen Baby – aber das klappt nicht immer so. Wenn das Kind unaufhörlich schreit, nicht schläft oder sich nur schwer beruhigen lässt, geraten Eltern, Pflegeeltern oder andere nahe Bezugspersonen manchmal an ihre Grenzen. mehr...
Die Zeit mit einem Baby kann mehr als erwartet herausfordernd sein. Mitunter erleben Eltern das Leben in der Familie fast nur noch als Belastung oder der Kontakt zum Baby fühlt sich nicht wie erhofft an, macht keine Freude, vielleicht sogar Stress – lauter Dinge, über die Eltern im Alltag oft nicht reden. Die Babyambulanz des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) bietet seit über 25 Jahren frühzeitige Unterstützung. Hier dürfen Eltern all das offen aussprechen und erleben dies häufig als große Entlastung.
Im Gespräch erzählen Dr. Anette Hasse-Wittmer, Leiterin des SPZ, und die leitende Psychologin der Babyambulanz, Renate Schlüsselberger über ihre Arbeit, wann Eltern kommen sollten – und warum jede Familie ihre eigenen Bedürfnisse hat.
Frau Dr. Hasse-Wittmer, Frau Schlüsselberger, die Babyambulanz gibt es mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten. Wie kam es zu diesem besonderen Angebot?
Dr. Anette Hasse-Wittmer: Die Babyambulanz wurde 1998 gegründet, um Familien in belastenden Situationen rund um die frühe Kindheit gezielt zu unterstützen. Über die Jahre haben wir gesehen, dass es eine immense Erleichterung für Eltern sein kann, aussprechen zu dürfen, dass die Situation mit einem Baby nicht immer einfach ist. Die Gründe, warum Eltern sich an uns wenden, sind vielfältig:
Manche sind unglaublich erschöpft, weil ihr Kind bereits über lange Zeit nur schwer in den Schlaf findet, sehr häufig aufwacht und viele Beruhigungshilfen braucht. Andere Kinder schreien über Stunden hinweg, lassen sich kaum beruhigen und zeigen häufig unzufriedenes Verhalten. Und wieder andere haben Probleme beim Stillen, beim Füttern oder beim Essen.
Neben den Themenbereichen Schreien, Schlafen und Füttern sind wir aber Anlaufstelle für alle Familien, in denen offene Fragen oder Unsicherheiten da sind im Umgang mit dem Kind, mit schwierig erlebtem kindlichem Verhalten, oder wenn ein Kind viele Ängste entwickelt hat oder Aggressionen zeigt und Eltern unsicher sind, wie sie damit umgehen sollen.
Renate Schlüsselberger: Unsere Babyambulanz ist eine Anlaufstelle für Familien aus den umliegenden Landkreisen. Das zeigt: Der Bedarf ist da – und er steigt, gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Unsicherheit, Leistungsdrucks und sozialer Vergleiche. Viele Eltern sind überrascht, dass sie sich in einer Situation wiederfinden, in der es ihnen nicht ausreichend gelingt, ihr Kind zu beruhigen oder zu füttern oder zum Schlafen zu bringen - Dinge, die man vielleicht für selbstverständlich hält. Umso größer sind Verzweiflung und Hilflosigkeit der Eltern. Häufig ist auch ein Gefühl von Scham oder gar Schuld damit verbunden. Quälende Fragen wie „Was machen wir bzw. ich falsch?“ oder „Warum ist es bei den anderen nicht so?“ können auftauchen.
Wann sollten Eltern mit ihrem Kind zu Ihnen kommen?
Schlüsselberger: Sobald Eltern das Gefühl haben: „Es ist zu viel.“ Das bedeutet, das persönliche Erleben von Belastung ist entscheidend. Eltern kommen im besten Fall bereits genau an diesem Punkt zu uns.
Dr. Hasse-Wittmer: Das subjektive Erleben von Überforderung oder Unsicherheit reicht aus. Wenn Eltern merken, dass das Schreien sie emotional auslaugt, wenn sie sich fragen, ob sie etwas falsch machen oder einfach niemand da ist, der hilft – dann sollten sie zu uns kommen. Aus unserer Sicht gibt es kein „zu früh“, kein „nicht schlimm genug“.
Wie läuft der Erstkontakt ab und wie geht es weiter?
Schlüsselberger: Der erste Ansprechpartner auf dem Weg in die Babyambulanz ist die Kinderärztin bzw. der Kinderarzt des Kindes. In der Praxis wird der Bedarf für eine Überweisung ans SPZ in unsere Babyambulanz besprochen. Wir richten uns an Eltern von Kindern von 0 bis 3 Jahren. Für die Eltern bieten wir täglich eine Telefonsprechstunde von 8.30 – 9.00 Uhr an. Hier können sie ihr Anliegen schildern und gegebenenfalls findet bereits eine erste Beratung statt. Wir bemühen uns, möglichst rasch einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren.
Im Erstgespräch nehmen wir uns ausreichend Zeit, um die individuelle Situation einer Familie möglichst gut zu erfassen. So können wir die unterschiedlichen Aspekte, die in einer schwierigen Situation wirken, gemeinsam analysieren und überlegen, welche Ansatzpunkte sinnvoll sind.
Je nach Situation bitten wir die Eltern, einen Fragebogen auszufüllen oder ein Verhaltenstagebuch zu einer bestimmten Fragestellung zu führen. Manchmal ist nämlich die genaue Beobachtung von bestimmten Situationen und Verhaltensweisen aufschlussreich und es gelingt uns leichter, eine für die Familie passende Interventionsmöglichkeit zu finden.
Die Behandlungsdauer ist sehr unterschiedlich. Manchmal reichen wenige Sitzungen aus, um zu einer wesentlichen familiären Entlastung und Veränderung der Situation beizutragen, manchmal braucht es einen längeren Behandlungszeitraum.
Unserer Erfahrung nach erfordern sowohl die Vielfalt der Kinder ebenso wie die Vielfalt der Eltern einen individuellen Zugang. Nichtsdestotrotz haben sich bestimmte Vorgehensweisen bei vielen Kindern als erfolgreicher als andere erwiesen und dieses Erfahrungswissen bieten wir natürlich allen Eltern an.
Welche Symptome sehen Sie am häufigsten in der Babyambulanz?
Dr. Hasse-Wittmer: Das Spektrum reicht von exzessivem Schreien über Einschlafprobleme bis zu sogenannten „schlechten Essern“. Eine gründliche Abklärung möglicher körperlicher Ursachen ist wichtig, um die richtigen Weichen hinsichtlich der Behandlung zu stellen.
Die Kinder, die bei uns vorgestellt werden, können sich oft nur schwer regulieren. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Regulationsschwierigkeiten oder Anpassungsschwierigkeiten des Kindes. Studien zeigen, dass jedes 4. - 5. gesund geborene Kind Probleme in einem dieser Bereiche hat. Da es also doch relativ viele Kinder und ihre Familien betrifft, sehen wir uns in der Region als wichtiges therapeutisches Angebot für Eltern in schwierigen Situationen mit sehr jungen Kindern und als Ergänzung zu anderen Angeboten, die z.B. auf die Nachsorge bei risiko- oder frühgeborenen Kindern fokussieren.
Die Babysprechstunde ist ein wichtiges präventives Angebot, denn je früher eine Unterstützung erfolgt, desto eher besteht die Chance, dauerhaft ungünstige Entwicklungen von Kindern zu verhindern und eine positive Veränderung zu bewirken.
Schlüsselberger: Häufig sehen wir zudem eine hohe psychische Belastung der Eltern. Über die Zeit hinweg können sich recht ungünstige Gewohnheiten und Dynamiken innerhalb einer Familie etablieren. Oft entwickelt sich über lange Zeiträume ein immer größer werdendes Schlafdefizit mit zunehmender Hilflosigkeit.
D. h. die Eltern, die zu uns kommen, erleben in der Regel eine hohe Belastung und einen hohen Druck. Sie haben meist schon Vieles ohne Erfolg ausprobiert. Hinzu kommen noch gut gemeinte Tipps von Großeltern, Freunden aber auch sozialen Medien. Jedes Mal, wenn was ausprobiert worden ist und nicht klappt, kommt eine neue Frustration hinzu.
Was ist in Ihren Augen „normal“ – und wo beginnt das Problem?
Schlüsselberger: Diese Frage beschäftigt viele Eltern, auch weil der Vergleich heute allgegenwärtig ist – durch soziale Medien, Ratgeberliteratur, Eltern-Kind-Gruppen. Auch die Frage, warum bekomme ich das nicht hin, rührt von den immer sonnigen Bildern, die in den Medien vermittelt werden. Die Realität ist häufig anders. Nicht jedes Kind schläft durch. Nicht jedes Stillen klappt problemlos. Ist die persönliche bzw. familiäre Belastungsgrenze erreicht, fängt es an, problematisch zu werden und der Leidensdruck nimmt zu.
Wie helfen Sie konkret?
Schlüsselberger: Zum einen durch Gespräche. Wir nehmen uns Zeit, hören zu, erklären, was hinter den Verhaltensweisen stecken kann – und entlasten dadurch. Zu Beginn geht es bei deutlicher elterlicher Erschöpfung darum, körperliche und psychische Entlastung zu finden, das bedeutet konkret, wie kann das eigene Schlafdefizit reduziert werden und wer kann in der Zwischenzeit für das Kind da sein. Entwicklungspsychologische Beratung unterstützt die Eltern, ihr Kind in seiner individuellen Entwicklung besser zu verstehen. Hier geht es darum, darüber zu beraten, was zu einem bestimmten Entwicklungsstand des Kindes zu erwarten ist, wo Eltern ihr Kind möglicherweise überfordern oder was eine Weiterentwicklung des Kindes erschwert, weil sie ihrem Kind etwas nicht zutrauen und es unterfordern.
Darüber hinaus setzen wir auch videobasierte Therapie ein: Wir filmen kurze Sequenzen aus dem Alltag, schauen sie gemeinsam mit den Eltern an. So lassen sich Dynamiken sichtbar machen und auch erkennen, wie Kind und Elternteil aufeinander reagieren. Das gemeinsame Ansehen von Videosequenzen bietet den Eltern die Möglichkeit, ihr Kind mit Abstand und aus anderer Perspektive zu beobachten. Das unterstützt sie dabei, die Signale ihres Babys zu lesen. Umgekehrt können wir das Kind in der vertrauten Interaktion mit den Eltern beobachten und besser kennenlernen.
Weiter bieten wir psychotherapeutische Gespräche für die Eltern an und helfen bei Bedarf, ein geeignetes erwachsenentherapeutisches Angebot zu finden.
Häufig schleichen sich während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt depressive Entwicklungen ein, diese erschweren die Eltern-Kind-Interaktion und belasten häufig die Paarbeziehung. Auch hier unterstützen wir mit Blick auf das Kind.
Wir haben kein Patentrezept, sondern suchen zusammen mit den Eltern hilfreiche Wege bzw. passende Schritte für Eltern und Kind, die eine Veränderung ermöglichen. Wichtig ist uns, dass die Eltern das gemeinsam erarbeitete Vorgehen mittragen und sich dabei wohl fühlen.
Was raten Sie Eltern zum Schluss?
Schlüsselberger: Vertrauen Sie Ihrem Gefühl – und holen Sie sich früh (!) Hilfe.
30.06.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Geburtenzahlen an der Kreisklinik Bad Reichenhall deutlich über dem Zielwert
Kliniken Südostbayern erreichen wichtige Fördervoraussetzung

Gute Nachrichten für die Kliniken Südostbayern (KSOB): Wie das Bayerische Landesamt für Statistik jetzt bekanntgegeben hat, kamen im Jahr 2024 im Landkreis Berchtesgadener Land insgesamt 790 Kinder zur Welt. Davon erblickten 443 Neugeborene in der Kreisklinik Bad Reichenhall das Licht der Welt. Das entspricht einem Anteil von 56,08 Prozent – und damit einer klaren Überschreitung des angestrebten Zielwerts von 50 Prozent. mehr...
Die Zielmarke ist keineswegs symbolischer Natur: Sie stellt eine entscheidende Voraussetzung dar, um eine umfassende finanzielle Förderung (Defizitausgleich) durch den Freistaat Bayern zu erhalten. Mit der aktuellen Geburtenquote erfüllt die Kreisklinik Bad Reichenhall somit nicht nur das zentrale Förderkriterium, sondern bestätigt auch ihre Bedeutung in der regionalen Geburtshilfeversorgung.
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der werdenden Eltern in unsere Klinik“, betont Philipp Hämmerle, Vorstand der Kliniken Südostbayern und strategisch für die KSOB-Standorte im Landkreis Berchtesgadener Land verantwortlich. „Die Überschreitung des 50-Prozent-Ziels ist nicht nur eine statistische Größe – sie ist Ausdruck der hohen Qualität, Sicherheit und Menschlichkeit, mit der unsere Geburtsstation in Bad Reichenhall arbeitet.“
„Die klare Zielwertüberschreitung ist ein deutliches Signal für die Bedeutung unserer Geburtshilfe im Berchtesgadener Land. Wir haben im vergangenen Jahr auch auf politischer Ebene immer wieder betont, wie entscheidend ihr Erhalt für den Landkreis ist. Die aktuellen Zahlen geben uns in dieser Überzeugung recht“, bekräftigt Landrat Bernhard Kern. „In der vom Landkreis gemeinsam mit Partnern des Netzwerks der Gesundheitsregionplus initiierten Online-Umfrage haben uns auch die jungen Mütter bestätigt: Hebammen, Ärzte und Pflegepersonal leisten großartige Arbeit und schaffen ein sicheres und familiäres Umfeld während der Geburt.“
Kern rückt zudem die Bedeutung des guten Zusammenwirkens zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamts sowie weiterer Bereiche des Landratsamts, der KSOB und verschiedenen Gesundheitsberufsträgern in den Fokus: „Ich bin sehr dankbar dafür, wie engagiert und umsichtig die Akteure aller betroffenen Berufs- und Interessengruppen in einem Netzwerk aktiv geworden sind, um gemeinsam ganz konkrete Ergebnisse und Verbesserungen für die Menschen in unserem Landkreis zu erzielen.“
Deutliche Steigerung trotz bundesweitem Rückgang
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr: 2023 wurden 431 Kinder in der Kreisklinik Bad Reichenhall geboren. Mit 443 Geburten im Jahr 2024 bedeutet das eine Steigerung von 2,8 Prozent – und das entgegen dem bundesweiten Trend sinkender Geburtenzahlen. Die positive Entwicklung spiegelt den Erfolg vielfältiger Maßnahmen wider, die in den vergangenen Monaten in der Geburtshilfe ergriffen wurden – von der Stärkung interdisziplinärer Teams bis hin zum Ausbau der familienfreundlichen Beratungsangebote im Bereich der Hebammenversorgung. Über die im vergangenen Jahr gestartete Kampagne „Born im BGL“ konnten diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit zusätzlich beworben werden.
Trend setzt sich auch 2025 fort
Und auch für das laufende Jahr 2025 zeichnen sich erfreuliche Tendenzen ab: In den beiden Geburtsstationen der KSOB in Bad Reichenhall und Traunstein steigen die Geburtenzahlen weiterhin an. „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass unsere geburtshilflichen Angebote in der Region angenommen werden – das ist ein starkes Signal an unsere Mitarbeitenden und an die Bevölkerung im Berchtesgadener Land“, so KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. „Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich engagiert und einfühlsam zur Welt kommen helfen.“
Da durch die Unterstützung aller Beteiligten die für eine Förderung erforderliche Geburtenquote in Bad Reichenhall 2024 erfüllt wurde, können die Kliniken Südostbayern nun beim Landkreis Berchtesgadener Land den Antrag auf Gewährung eines Defizitausgleichs für die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Bad Reichenhall 2024 stellen. Der Landkreis wird dann bis zu einer Million Euro des Defizites aus Landkreismitteln übernehmen und gleichzeitig bei der Regierung von Oberfranken hierfür eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern beantragen. Durch die zu erwartende Förderung des Freistaates Bayern in Höhe von 85 Prozent des vom Landkreis übernommenen Defizitausgleichs verbleibt am Ende beim Landkreis ein Kostenanteil von bis zu 150.000 Euro.
28.06.2025 - Klinikum Traunstein
Eine Sekunde, ein Fehler – und nichts ist mehr wie vorher
Über den schmalen Grat zwischen der Freiheit auf zwei Rädern und einer lebensverändernden Katastrophe

Wirbelsäulenverletzungen nach Motorradunfällen gehören zu den dramatischsten Herausforderungen der Unfallchirurgie. Im Interview spricht Prof. Dr. Kolja Gelse, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie am Klinikum Traunstein, über schwerstverletzte Patienten, Sekundenentscheidungen im OP und die erneute Zertifizierung als Wirbelsäulenspezialzentrum. Ein Gespräch über Präzision, Teamgeist und Verantwortung. mehr...
Herr Prof. Dr. Gelse, was ist das besondere Risiko bei Motorradunfällen für die Wirbelsäule?
Motorradfahrer sind im Vergleich zu Autofahrern schlichtweg ungeschützt. Selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten wirken enorme Kräfte auf den Körper – insbesondere auf die Wirbelsäule. Ein Sturz über den Lenker, ein Aufprall mit Verwindung oder ein Schleudern über den Asphalt kann zu Kompressions- und Distraktionsverletzungen führen. Das Resultat: Brüche der Wirbelkörper, Zerreißung der stabilisierenden Bandstrukturen, oder in schweren Fällen die Gefahr kompletter Querschnittslähmungen. Und dann zählt nur eines: binnen Sekunden müssen Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel kann eine Fraktur der Halswirbelsäule – etwa nach einem Hochrasanztrauma – zu irreversiblen Schäden führen, und nur eine in kürzester Zeit eingeleitete hochpräzise Therapiemaßnahme kann mitunter schwere bleibende Schäden abwenden oder mindern.
Wie häufig sehen Sie solche Fälle im Klinikum Traunstein?
Motorradunfälle sind im Chiemgau leider keine Seltenheit, nicht zuletzt durch die reizvollen Landstraßen und das hohe Verkehrsaufkommen während der Sommersaison. Unsere Lage im Voralpenland, nahe der Deutschen Alpenstraße, zieht viele Motorradfahrer an. Entsprechend hoch ist die Zahl der Unfälle, viele davon sind Polytraumata, also Mehrfachverletzungen, bei denen die Wirbelsäule eine zentrale Rolle spielt – und wir von der unfallchirurgischen Abteilung am Klinikum sind rund um die Uhr darauf vorbereitet. Als Standort des Rettungshubschraubers „Christoph 14“ sind wir im südostbayerischen Raum die primäre Anlaufstelle. Wir sind keine Universitätsklinik – aber wir bieten eine entsprechende Qualität mit höchstem medizinischem Standard. Wir vereinen die Schlagkraft und Expertise eines Maximalversorgers mit der Nähe eines örtlichen Krankenhauses. Für Patienten bedeutet das: kurze Wege, unkomplizierte Kommunikation und Versorgung auf höchstem Niveau.
Das Wirbelsäulenspezialzentrum des Klinikums wurde im ersten Quartal erneut zertifiziert. Was bedeutet das konkret?
Neben der seit Jahren bestehenden Zertifizierung als Überregionales Traumazentrum der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für die Versorgung schwerstverletzter Patienten, haben wir im März zusammen mit der Abteilung für Neurochirurgie erneut die Rezertifizierung als „Wirbelsäulenspezialzentrum“ der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft erfolgreich abgeschlossen. Dieser Qualitätsnachweis bestätigt unsere 24/7-Verfügbarkeit spezialisierter Expertise auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie, hochmoderne Ausstattung und klar definierte Prozesse. Unsere Patienten profitieren natürlich auch von der Interdisziplinarität, d. h. der Verfügbarkeit von Neurochirurgen, Anästhesisten, Radiologen, Intensivmedizinern und natürlich auch speziell geschultem Pflegepersonal rund um die Uhr.
Was passiert, wenn ein Patient mit akuten Unfallverletzungen bei Ihnen eintrifft?
Wir haben klare, standardisierte Abläufe: Ein Schwerstverletzter mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung durchläuft ein definiertes Polytrauma-Management – inklusive CT, neurologischer Untersuchung und entsprechender Lagerung. Ist eine Operation notwendig, halten wir stets einen Notfall-OP inklusive Team bereit. Dort führen wir je nach Situation z. B. minimalinvasive Stabilisationen mit Schrauben-Stab-Systemen durch oder – bei komplexeren Verletzungen – auch offene Eingriffe mit Entlastung des Rückenmarks. Durch 3-D-Bildgebung, intraoperative Navigation und moderne Implantat-Systeme sind heute viele Eingriffe möglich, die vor ein paar Jahren noch nicht denkbar waren. Aber Technik allein rettet niemanden. Es ist oft ein enges Zusammenspiel mit anderen Abteilungen, wie zum Beispiel mit meinem Kollegen Priv.-Doz Dr. Jens Rachinger, dem Chefarzt der Neurochirurgie. Anschließend übernimmt unsere Intensivstation die lückenlose Überwachung, da sind besonders auch die Pflegekräfte zu nennen, die selbst nachts um drei hellwach und für den Patienten da sind. Im weiteren Verlauf beginnen wir frühzeitig mit der Mobilisation durch unsere Physiotherapeuten. Parallel dazu kümmert sich unser Sozialdienst um die weiteren Rehabilitationsmaßnahmen. Unser Anspruch ist es, nicht nur zu retten, sondern auch Perspektiven zu geben und Lebensqualität zu erhalten.
Zum Schluss: Würden Sie sagen, Motorradfahrer sollten sich besser schützen – oder gar verzichten?
Ich möchte kein Moralapostel sein. Motorradfahren hat seine Faszination, das verstehe ich. Aber ich appelliere an die Vernunft: angepasste Geschwindigkeit, hochwertige Schutzkleidung, Training, kein Alkohol, keine Selbstüberschätzung. Und: stets das Bewusstsein, dass selbst die kleinste Unkonzentriertheit und der kleinste Fehler enorme Folgen haben kann.
27.06.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Der Mensch im Mittelpunkt
Auszeichnung des Magazins „stern“ für die Unfallchirurgie/Orthopädische Chirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall

In einem von Umbrüchen geprägten Gesundheitswesen ist für Patientinnen und Patienten die Orientierung mitunter schwierig. Und wer als Klinik in diesem Dickicht bestehen will, braucht nicht nur Kompetenz, sondern auch Nähe und Charakter. Die Unfallchirurgie / Orthopädische Chirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall hat beides und wird dafür belohnt mit dem verdienten Einzug in die stern Klinikliste 2025/26. mehr...
„Unsere Stärke liegt in der Präzision. Und: Wir sind nah am Menschen. Das können große Maximalversorger oft nicht leisten.“, sagt Dr. Florian Zoffl, Leitender Arzt der Abteilung Unfallchirurgie /Orthopädische Chirurgie. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Unfallchirurgie. Seine Philosophie: klare Diagnostik, konsequente Therapie, und das alles auf Augenhöhe mit dem Patienten.
Das Magazin „stern“ hat gemeinsam mit dem unabhängigen Rechercheinstitut MINQ zum vierten Mal die besten Krankenhäuser Deutschlands ermittelt. Ausgezeichnet wurde die Kreisklinik Bad Reichenhall für ihre herausragenden Leistungen in der Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Hervorgehoben werden in der nicht nummerierten Liste neben der medizinischen Expertise auch der gute Pflegestandard und die hohe Patientenzufriedenheit in der Kreisklinik.
Das MINQ-Institut bezieht in die Bewertung harte Daten wie Fallzahlen, Komplikationsraten und Personalausstattung ein – aber auch die Empfehlungen von Fachärzten, Zuweisern und Patienten. In all diesen Bereichen überzeugte die Kreisklinik Bad Reichenhall auf ganzer Linie. Die stern-Liste, die am 28. Juni im Sonderheft „Gute Kliniken für mich“ erscheint, benennt die Top 100 der Kliniken in Deutschland – und Bad Reichenhall ist eine davon.
„Eine solche Auszeichnung fällt nicht vom Himmel. Es ist eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Aber vor allem eine Bestätigung für unser Team. Chirurgie ist nie Einzelleistung. Es ist Präzision, Teamgeist und Haltung. Wir freuen uns über den Titel – aber wichtiger ist, was wir heute und morgen für unsere Patientinnen und Patienten tun können“, so Dr. Zoffl.
26.06.2025 - Kliniken Südostbayern
Mit Herz und Hightech
Eröffnung der Praxis für Gastroenterologie im Fachärztezentrum der Kliniken Südostbayern
In Traunstein eröffnete die neue Praxis für Gastroenterologie des Fachärztezentrums am Klinikum Traunstein. Die Praxis punktet mit modernster Ausstattung, enger Anbindung an die Innere Medizin der Kliniken Südostbayern und Dr. Robert Keilmann als vertrautem, langjährigem Partner – ein echter Gewinn für Patientinnen und Patienten in der Region. Mit seinem eingespielten Team bietet die Praxis jedem Patienten ein individuelles diagnostisches und therapeutisches Konzept zu Fragen der Gastroenterologie.
20.06.2025 - Kliniken Südostbayern
InnKlinikum und KSOB schaffen ein einzigartiges Versorgungsmodell für psychische Gesundheit
Dr. Stefan Rieger übernimmt die Leitung der ersten klinikverbundübergreifenden Abteilung für Medizinische Psychologie

Dr. Stefan Rieger, bislang Leiter des Fachbereichs Medizinische Psychologie am InnKlinikum Altötting und Mühldorf, übernimmt die Leitung der neuen klinikverbundübergreifenden Abteilung „Medizinische Psychologie“ im InnKlinikum und bei den Kliniken Südostbayern (KSOB). Die Abteilung umfasst rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs Standorten in vier Landkreisen und deckt das gesamte Bedarfsspektrum an Psychologie, Psychotherapie, Neuropsychologie und Psychoonkologie ab. mehr...
„Die Schaffung des gemeinsamen Fachbereiches ist ein bedeutender Schritt für die psychologische Versorgung in den beiden Klinikverbünden“, betont Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender des InnKlinikum. „Dass wir zusammen mit den KSOB diese Vision gemeinsam umsetzen, unterstreicht unseren Anspruch, die Patientenversorgung in Südostbayern ganzheitlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die psychologische Betreuung unserer Mitarbeiter weiter zu verbessern.“
Mit der neuen Struktur nehmen das InnKlinikum und die KSOB eine Vorreiterrolle bei den regionalen Kliniken ein.
„Wir bündeln Kräfte und Know-how, um die psychische Versorgung auf eine neue Ebene zu heben“, sagt Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der KSOB. „Die enge Vernetzung mit dem InnKlinikum eröffnet uns nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Patienten und Mitarbeiter, sondern auch für die Weiterentwicklung der Spezialisten, die in diesem Feld tätig sind.“
„Mir ist es wichtig, Synergien zu nutzen und auszubauen und damit den zunehmenden psychischen Begleiterkrankungen von Patienten, die eigentlich aus ganz anderen Gründen ins Krankenhaus kommen, gerecht zu werden“, erklärt Dr. Stefan Rieger. „Ein besonderer Fokus liegt auf der Psychoonkologie, die sich mit den psychischen Auswirkungen einer Krebserkrankung beschäftigt. Sie wird durch den demografischen Wandel immer bedeutsamer. Die psychologische Betreuung und Krisenintervention bei Krebspatienten ist eine wesentliche Aufgabe, der wir uns mit hoher fachlicher Kompetenz widmen.“
Mit der gemeinsamen Abteilung setzen das InnKlinikum und die KSOB ein Zeichen für die psychische Gesundheit: multiprofessionell, vernetzt, menschlich – und regional verwurzelt.
Dr. Stefan Rieger (49 Jahre), ist gebürtiger Eggenfeldener und dort auch aufgewachsen. Seine akademischen Ausbildungen in Psychotherapie, Psychoonkologie und Klinischer Psychologie absolvierte er in München und Regensburg, die Promotion folgte in München mit psychoanalytischem Thema. Seit 2008 ist er am InnKlinikum als Klinikpsychologe angestellt. 2012 begann Dr. Stefan Rieger mit dem Aufbau eines psychologischen Konsiliardienstes mit dem Ziel, Klinikärzte anderer Fachrichtungen bei der psychologischen Betreuung ihrer Patienten zu unterstützen. Das Angebot wurde zunächst in den Kliniken in Altötting und Burghausen eingerichtet, mit der Fusion 2020 aufs gesamte InnKlinikum ausgeweitet und nun auch in den KSOB etabliert.
11.06.2025 - Klinikum Traunstein
„Mein Leben geht weiter!“
Der lange Weg von Bettina Seifert aus Anger
Das ist die Geschichte von Bettina Seifert aus Anger, die zum dritten Mal Hirntumoren operieren lassen musste – und im Klinikum Traunstein mit dem Neurochirurgen Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger endlich den richtigen Arzt und Operateur gefunden hat. mehr...
Im Januar 2019 bemerkt Bettina Seifert, dass sie Schwierigkeiten hat, das Gleichgewicht zu halten und auf einem Bein zu stehen. Aber sie denkt sich nichts dabei, ein Schwindeltest zeigt nur leichte Auffälligkeiten. Sie fährt in den Urlaub, doch dort verschlimmern sich die Gleichgewichtsstörungen so stark, dass sie kaum mehr geradeaus gehen kann. Außerdem ändert sich ihr Geschmackssinn radikal: „Salziges hat geschmeckt als würde ich pures Salz essen, und Süßes, als äße ich puren Zucker.“ Das alles macht ihr Angst. Zurück in ihrem damaligen Wohnort München wird in einer großen Münchener Klinik Anfang März ein MRT durchgeführt: Diagnose Meningeom im Kleinhirnbrückenwinkel links mit einem Durchmesser von 4,2 cm, das definitiv operiert werden muss. Meningeome sind zumeist langsam wachsende Tumoren, die von den Hirnhäuten ausgehen und ab einer gewissen Größe das Gehirn komprimieren. Sie machen bei ca. 8 Neuerkrankungen/Jahr/100.000 Einwohner rund 35 % der Tumore des zentralen Nervensystems aus.
Das Meningeom wird in München operiert
Bis zum Operationstermin am 27. März 2019 verschlimmert sich ihr Zustand. Sie erinnert sich: „Ich konnte kaum noch das Gleichgewicht halten und kaum noch etwas essen, auch Wasser schmeckte nach purem Eisen. Dadurch verlor ich innerhalb kürzester Zeit massiv an Gewicht. Ich bin 1,80 m groß und brachte nur noch 52 kg auf die Waage.“ Daher muss in der Klinik zunächst mit Infusionen dafür gesorgt werden, dass ihr Körper eine Operation überhaupt aushält. Nach dem fast siebenstündigen Eingriff sagt der Operateur, dass das Meningeom sehr nah am Hör- und im Gesichtsnerv lag und er daher nicht alles entfernen konnte. Seine gute Nachricht ist, dass das Meningeom gutartig ist, WHO Grad 1. Trotz allem ist Bettina Seifert erleichtert. Nach dem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt geht die gebürtige Stuttgarterin in die Reha, sie kommt dort zu Kräften, die Gleichgewichtsstörungen werden besser und auch der Geschmackssinn normalisiert sich, doch sie entwickelt extreme Schlafstörungen. Sie bleibt mit MRT-Terminen alle 6 Monate in der Überwachung – und hat immer Angst, dass da wieder etwas sein könnte. Ihre berufliche Tätigkeit fällt ihr durch diese quälenden Ängste zunehmend schwerer, sie verkürzt ihre Arbeitszeit.
Bettina Seifert wechselt ins Klinikum Traunstein
Beim Kontrolltermin in München im Dezember 2022 bestätigen sich ihre schlimmsten Befürchtungen: das operierte Meningeom ist wieder leicht gewachsen und muss behandelt werden. In der Zeit zieht sie von München nach Anger, um dem Stress der Großstadt zu entfliehen. Darum geht sie für die weitere Behandlung ins Klinikum Traunstein. Dr. Wolfgang Weiss, Oberarzt der Strahlentherapie, führt im März 2023 mit seinem Team die Behandlung durch: Strahlentherapie mit fast 30 Sitzungen. Das nächste turnusgemäße MRT soll zeigen, inwieweit der Tumor auf die Therapie angesprochen hat – und er kann Entwarnung geben, die Größe des Tumors hat sich nicht verändert. Aber Bettina Seiferts bohrende Ängste wachsen, ob sich eventuell neue Meningeome gebildet haben könnten.
Ein neues Tumorgeschehen
Und wieder erweisen sich ihre Ängste als berechtigt: Beim Kontroll-MRT im August 2024 im Klinikum Traunstein wird festgestellt, dass der bereits bestrahlte erste Tumor in der Größe gleichgeblieben ist, sich aber ein neues Meningeom in der gleichen Hirnregion gebildet hat. Auf einen Rat eines Bekannten hin, mit dem sie zusammen bei der Tafel in Teisendorf ehrenamtlich Dienst tut und der seinerseits schon die besten Erfahrungen mit dem Operateur gemacht hatte, vereinbart sie einen Termin mit dem Chefarzt der Neurochirurgischen Abteilung im Klinikum Traunstein, Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger: „Dieses neue Tumorgeschehen lag an der Basis der hinteren Schädelgrube neben dem Hinterhauptsloch und damit nicht so kritisch an Gesichts- und Hörnerv wie das erste Meningeom von Frau Seifert. Doch durch das rasante Wachstum dieses neuen Tumors war eine zeitnahe Behandlung erforderlich.“ Bettina Seiferts zunehmende Angstzustände drehen sich darum, dass sie nach einer Operation vielleicht nicht mehr aufwacht, die Schlafstörungen werden immer extremer.
Was ihr ungemein hilft ist, dass PD Dr. Rachinger sich sehr viel Zeit für sie nimmt und ihr alles genau erklärt. Sie fühlt sich gut aufgehoben. Und er ist ehrlich zu ihr: „Aufgrund der vorherigen Operation war die Situation bei Frau Seifert etwas erschwert durch die Narbenbildung.“ Im September 2024 führt der erfahrene Neurochirurg die Operation durch: Alles verläuft gut, bereits nach einer Woche kann sie die Klinik verlassen. Die Einstufung des Tumors ist wieder: gutartig, WHO Grad 1. Allerdings wird von den Pathologen des Hirntumorreferenzzentrums in Bonn schon eine erhöhte Wachstumsaktivität des Tumors gesehen, die ihn in die Nähe eines WHO Grad 2 rückt.
Der alte Tumor ist wieder aktiv
Die niederschmetternden Nachrichten für die 59-Jährige reißen nicht ab: Am 17. Januar 2025 hat sie den nächsten MRT-Kontrolltermin im Klinikum Traunstein. PD Dr. Rachinger muss ihr beim Besprechungstermin sagen, dass das erste, bereits im März 2019 in München operierte und im März 2023 bestrahlte Meningeom wieder aktiv ist. Er erklärt ihr, warum eine Operation unerlässlich ist: „Das Meningeom im Kleinhirnbrückenwinkel zeigte rasches Wachstum. Dadurch war es sehr wahrscheinlich, dass dieser Tumor unbehandelt in naher Zukunft Ausfälle betreffend das Gefühl und die Bewegung der linken Gesichtshälfte sowie das Gehör und die Augenbewegung verursacht hätte. Auch eine Gangstörung und eine Lähmung der rechten Körperhälfte können durch so einen Tumor entstehen.“
Wieder unendliche Angst, und die Symptome verstärken sich innerhalb kürzester Zeit: „Während ich auf die Operation am 2. April 2025 wartete, begannen Taubheitsgefühle auf der linken Zungenhälfte und der linken Seite meines Gesichts im Mundbereich, im Nasenbereich und unter dem linken Auge. Ich musste mich damit auseinandersetzen, dass eine dritte Operation in meinem Kopf bevorstand. Und zwar ganz nah an Hör- und Gesichtsnerven; das hat mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen.“
Eine hochkomplizierte Operation mit gutem Ausgang
Bei dieser, auch für langjährig erfahrene Operateure, sehr kritischen und hochkomplizierten Operation wurden die Nervenfunktionen mittels eines sogenannten elektrophysiologischen Monitorings überwacht. PD Dr. Rachinger erläutert: „Dabei werden z.B. die elektrischen Phänomene, die bei der Weiterleitung eines akustischen Reizes über das Ohr und den Hörnerven zum Hirnstamm entstehen, aufgezeichnet. So kann ich als Operateur erkennen, wenn eine Schädigung des Hörnervens droht. Über Elektroden in der Gesichtsmuskulatur kann man hingegen Informationen über den Zustand des Nervus facialis, der für die Bewegung des Gesichtes zuständig ist, erhalten. Auch hilft eine Stimulationselektrode, welche in das Operationsgebiet neben dem Hirnstamm eingebracht werden kann, bei der Identifikation des Nervens und seiner Abgrenzung zum Tumor hin. Die Chancen für eine maximale Tumorentfernung unter Erhaltung der Funktionsfähigkeit der nervalen Strukturen werden durch diese aufwändige Technik nachweislich erhöht. So konnte bei Frau Seifert nun auch ein großer Teil des Kleinhirnzeltes, des Tentoriums, von welchem der Tumor ausging, mit entfernt werden, was die Gefahr einer neuerlichen Tumorentstehung stark reduziert.“
Nach der neunstündigen Operation wacht Bettina Seifert auf: Sie hat keinerlei Beeinträchtigung des Hörnervs oder des Gesichtsnervs. Auch das Kontroll-MRT zeigt, dass alles sehr positiv ist. Sie sagt: „Ich bin Herrn PD Dr. Rachinger unendlich dankbar, dass er alles komplett entfernt hat und dass alles so gut ausgegangen ist. Wichtig war für mich außerdem, dass er immer offen und ausführlich mit mir gesprochen hat, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben.“ PD Dr. Rachinger erläutert: „Letztlich erwartungsgemäß wurde der Tumor durch das Hirntumorreferenzzentrum nun als WHO Grad 2 eingestuft. Frau Seifert hat weitere, allerdings unkritischere Meningeome, darum muss sie weiterhin alle drei bis sechs Monate zum MRT kommen, wir wollen das engmaschig überwachen.“
In guten Händen
Bettina Seifert darf das Klinikum Traunstein bereits nach einer Woche wieder verlassen und im Mai 2025 in eine Reha-Klinik gehen: „Meine Ängste sind nach wie vor groß. Ich wache nachts schweißgebadet auf und habe Konzentrationsstörungen. Allerdings fällt es mir leichter als früher, mich nicht davon überwältigen zu lassen und es geht mir allgemein sehr gut. Ich weiß, dass ich bei Herrn PD Dr. Rachinger und in der Neurochirurgischen Abteilung des Klinikums Traunstein in sehr guten Händen bin. Auch der menschliche Aspekt dort ist wunderbar. Jeder hat ein freundliches Wort, und man fühlt sich wirklich gut aufgehoben. Ich bin mir sicher, hier war und bin ich richtig.“
05.06.2025 - Kliniken Südostbayern
Regionale Spezialversorgung bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen im Kindesalter ist unverzichtbar
Kliniken Südostbayern stärken Versorgung durch Spezialisierung und High-End-Medizintechnik
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa steigt seit Jahrzehnten weltweit – ein Trend, der auch in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land spürbar ist. Immer häufiger werden junge Patientinnen und Patienten mit den oft spät erkannten Erkrankungen behandelt. Eine regionale, spezialisierte Versorgung ist daher für betroffene Familien von zentraler Bedeutung. mehr...
Ein bewegender Fall: Lukas' Geschichte
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der neunjährige Lukas (Name geändert): Er ist autistisch, spricht nicht und ist sensibel gegenüber Veränderungen und Berührungen – über ein halbes Jahr litt er unter Beschwerden, bis in der Kindergastroenterologie der Kliniken Südostbayern die richtige Diagnose gestellt wurde: Colitis ulcerosa, eine chronische Entzündung der Schleimhaut im Dickdarm, die in seinem Fall einen besonders schweren Verlauf nahm. Die Behandlung war herausfordernd: Lukas verweigerte jegliche orale Medikation, sodass eine dauerhafte Therapie über eine Ernährungssonde notwendig wurde, die durch die Bauchdecke direkt in den Magen führte. Vertrauen fasste er ausschließlich zum spezialisierten Team vor Ort – nur hier ließ er medizinische Maßnahmen zu. Ein Wechsel in eine fremde Umgebung hätte ihn überfordert und die Therapie gefährdet.
Die Familie ist ohnehin stark belastet: Neben Lukas versorgen die Eltern auch ein weiteres chronisch krankes Kind. Lange Anfahrtswege oder Klinikwechsel wären für sie kaum zu bewältigen.
„Nähe, Vertrauen, Kontinuität – das ist unverzichtbar“
„Fälle wie dieser zeigen, dass medizinische Kompetenz immer Hand in Hand gehen muss mit sozialer und psychischer Betreuung“, betont Prof. Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin an den Kliniken Südostbayern, und ergänzt, “gerade bei komplexen chronischen Erkrankungen braucht es Nähe, feste Bezugspersonen und ein eingespieltes Team. Eine Verlagerung der Behandlung an weit entfernte Zentren würde nicht nur die Therapie gefährden, sondern auch die Familien emotional und organisatorisch stark belasten.“
Früherkennung und Spezialisierung als Schlüssel
Dr. Margit Schmid, Kindergastroenterologin am Klinikum Traunstein, erklärt: „Diese Erkrankungen verlaufen schubweise und können unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen führen – von Darmdurchbrüchen über Stenosen bis zu Fisteln oder Abszessen. Die Kinder gedeihen schlecht und bleiben in ihrer Entwicklung zurück.“
In der Region übernehmen derzeit ausschließlich Dr. Margit Schmid und ihre Kollegin Hanni Chucholl die spezialisierte Betreuung. „Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist für uns essenziell“, sagt Chucholl. „Sie erkennen erste Warnzeichen und schaffen die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. Aber bei komplexen Fällen braucht es spezialisierte Teams mit Erfahrung und entsprechender technischer Ausstattung möglichst wohnortnah.“
Investition in die Zukunft der regionalen Versorgung
Die Kindergastroenterologie der Kliniken Südostbayern wurde kürzlich mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gefördert. „Dank der Unterstützung konnten wir High-End-Endoskope anschaffen, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten sind“, erklärt Prof. Dr. Wolf. „Diese moderne Ausstattung ermöglicht präzisere Diagnosen und schonendere Eingriffe – und schließt eine wichtige Versorgungslücke vor Ort.“
03.06.2025 - Kliniken Südostbayern
Einführungstag KSOB
Einführungstag neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bildungszentrum
Neue Kolleginnen und Kollegen aus den vier Standorten der Kliniken Südostbayern wurden zum gemeinsamen Einführungstag im Bildungszentrum in Traunstein eingeladen.
Die ersten Tage im neuen Unternehmen sind besondere Momente und prägend – umso wichtiger ist ein guter Start. Der Einführungstag soll den neuen Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen ein Gefühl von Zugehörigkeit bieten mit der Möglichkeit, sich schon ein bisschen kennenzulernen, untereinander austauschen und zu vernetzen mehr...
Vorstand Philipp Hämmerle begrüßte die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich und stellte das Unternehmen mit seinen Standorten sowie den Lean Hospital Ansatz vor. Im Anschluss gab Dr. Stefan Paech Einblick in das medizinische Konzept. Weitere Informationen aus den Bereichen Pflege, Qualität, Governance und Nachhaltigkeit, Personal und Bildung, Betriebsmedizin sowie Digitalisierung und Innovation folgten in der Agenda. Ebenso wurden die Basiskenntnisse der Hygiene vermittelt.
Wir begrüßen alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals ganz herzlich im Team der KSOB und wünschen ihnen einen guten Start sowie eine erfolgreiche Einarbeitung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
30.05.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Zwerchfellbruch: Wenn der Magen aus der Reihe tanzt
Ein Interview mit Dr. Thomas E. Langwieler, Chefarzt Allgemeinchirurgie Kreisklinik Bad Reichenhall

Druck hinter dem Brustbein, saurer Geschmack im Mund oder Heiserkeit am Morgen – was viele als harmloses Sodbrennen abtun, kann ein Hinweis auf einen Zwerchfellbruch sein. Wenn sich Magenanteile in den Brustkorb verlagern, geraten Säure und Luft in Bewegung – und das kann ernsthafte Beschwerden verursachen. Dr. Thomas E. Langwieler, Chefarzt der Allgemeinchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, erklärt im Interview, wie es zu der oft unterschätzten Erkrankung kommt, warum sie so vielfältige Symptome verursacht – und wann eine Operation nötig wird. mehr...
Was passiert bei einem Zwerchfellbruch?
Dr. Langwieler: Kurz gesagt: Normalerweise verläuft die Speiseröhre durch das Zwerchfell in den Magen. Bei einer sogenannten Zwerchfellhernie, also einem Bruch des Zwerchfells, verlagert sich der untere Teil der Speiseröhre und manchmal auch der obere Teil des Magens in den Brustkorb. Das kann zu Sodbrennen, Schmerzen hinter dem Brustbein, Heiserkeit oder Aufstoßen führen. In schweren Fällen drücken Luftansammlungen im Magen sogar auf das Herz. Die Beschwerden sind vielfältig und reichen von saurem Aufstoßen bis zum Gefühl, dass Speisen wieder hochlaufen.
Wie – oder warum – passiert so etwas? Und wem passiert das hauptsächlich?
Ein Zwerchfellbruch kann durch genetische Veranlagung oder starkes Übergewicht entstehen, es sind aber auch schlanke Menschen betroffen. Entscheidend ist der dauerhafte Druck auf den Durchtritt der Speiseröhre durch das Zwerchfell – ein Bereich, der sich bei jedem Atemzug bewegt. Je stärker die Bauchdecke arbeitet, desto größer ist die Belastung.
Viele kennen das Gefühl von Sodbrennen. Gibt es einen Punkt, an dem man unbedingt zum Arzt gehen sollte?
Wer regelmäßig unter Sodbrennen leidet, sollte das ärztlich abklären lassen, es gibt dafür klare medizinische Leitlinien. Man führt dann eine Magenspiegelung durch, die erste Behandlung erfolgt meist mit Säureblockern (kurz PPI) über sechs bis acht Wochen. Viele Patienten sind danach beschwerdefrei, andere brauchen die Medikamente dauerhaft. Das ist jedoch nicht unproblematisch, da die Magensäure auch Keime abtötet, die wir über Nahrung aufnehmen – ihr Fehlen kann das Infektionsrisiko erhöhen.
Wie wird ein Zwerchfellbruch behandelt?
Zunächst ist eine aussagekräftige Spiegelung von Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm wichtig. Dabei beurteilt der Endoskopiker zum Beispiel, ob es im unteren Bereich der Speiseröhre Reizungen oder Entzündungen gibt – sogenannte Refluxzonen, oder ob eine Zwerchfellhernie vorliegt. In schwereren Fällen können sich sogenannte Barrett-Zungen bilden, wenn die Speiseröhre dauerhaft mit Magensäure in Kontakt kommt. Diese müssen regelmäßig überwacht werden, da sie langfristig entarten und ein Barrett-Karzinom, eine Form von Speiseröhrenkrebs, entstehen kann. Wenn sich diese Veränderungen einmal gebildet haben, bilden sie sich in der Regel nicht vollständig zurück – auch nicht nach einer Refluxoperation. Sie müssen weiter beobachtet werden.
Was folgt nach der Endoskopie?
Es folgt eine Druckmessung der Speiseröhre (Ösophagus-Manometrie), um deren Beweglichkeit und die Funktion des Schließmuskels zu prüfen. Ist dieser dauerhaft geöffnet, fließt Säure zurück. Dazu erfolgt die pH-Metrie, die Aussagen darüber erlaubt, ob es sich um sauren oder galligen Reflux handelt und wie oft es in 24 Stunden zu Refluxepisoden kommt. Bei nachgewiesenem Reflux wird der Zwerchfell-Durchtritt operativ verengt und eine Magenmanschette um die Speiseröhre gelegt, um den Rückfluss zu stoppen.
Das heißt, an einer Operation führt kein Weg vorbei?
Es gab Versuche endoskopisch zu behandeln, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Bei größeren Zwerchfellhernien, bei denen weite Teile des Magens in den Brustkorb verlagert sind, ist die Operation oft unausweichlich. Patienten, die zu uns kommen, haben meist eine lange Leidensgeschichte und haben auch bereits alles versucht: keine Mahlzeiten nach 18 Uhr, Verzicht auf Alkohol oder Schokolade und weil sie nachts sonst starke Beschwerden haben, schlafen sie mit erhöhtem Oberkörper. Trotzdem kommen sie nicht ohne hochdosierte Säureblocker zurecht.
Wie aufwendig ist die Operation für den Patienten?
Der Eingriff dauert etwa 45 bis 60 Minuten und erfolgt über fünf kleine Schnitte. Nach der OP kommen die Patienten auf die Normalstation und erhalten zunächst nur Flüssignahrung. Sie müssen auch ihr Essverhalten ändern – kleinere Mahlzeiten, fünf bis sieben Mal täglich. Wir beraten die Patienten diesbezüglich intensiv. Je nach Größe der Zwerchfelllücke setzen wir auch ein bioresorbierbares Netz ein, um das Gewebe zu stärken und ein Wiederauftreten zu vermeiden.
Das kann also wiederkommen?
Ja, natürlich. Das Zwerchfell ist ein Muskel und ständig in Bewegung. Wenn es sich nicht mehr bewegt, kommt es zu einer Einschränkung in der Atmung unter anderem mit Atemnot. Das muss man bedenken.
Kann man dem Ganzen auch vorbeugen?
Einem Zwerchfellbruch kann man genauso wenig vorbeugen wie einem Leistenbruch. Man sollte aber versuchen, ein normales Körpergewicht zu halten. Es gibt physiotherapeutische Übungen, die angeblich helfen sollen, aber ich kann nichts zur Wirksamkeit sagen.
Die Kreisklinik Bad Reichenhall ist zertifiziertes Kompetenzzentrum der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Deutschen Herniengesellschaft. Dr. Thomas E. Langwieler gehört seit vier Jahren in Folge laut „FOCUS Gesundheit“ zu den Top-Medizinern Deutschlands für Hernien- und Refluxerkrankungen.
28.05.2024 - Traunstein
Pflege zum Anfassen – junge Perspektiven, echte Einblicke!
Tag der Pflege am Annette-Kolb-Gymnasium
Wie begeistert man junge Menschen für einen der wichtigsten Berufe unserer Gesellschaft? Das Annette-Kolb-Gymnasium (AKG) in Traunstein hat mit einem preisgekrönten Projekt eine Antwort geliefert – und wir durften mitgestalten!
Beim „Tag der Pflege“ bekamen 90 Schüler praxisnahe Einblicke in den Klinikalltag: Von Gips anlegen in der Notaufnahme, Reanimation für Kinder und Erwachsene an Simulationspuppen, Versorgung von Neugeborenen in der Pädiatrie – konnten sie sogar ein Perspektivwechsel mit Rollstuhl-Rally und Demenz-Parcours absolvieren. mehr...
Die Idee dazu entstand im Rahmen des YES! – Young Economic Solutions-Wettbewerbs, bei dem die AKG-Schüler im Bundesfinale den zweiten Platz belegten. In ihrer Freizeit entwickelten sie mit ihrer Lehrkraft und mit Unterstützung der Kliniken Südostbayern und der Caritas Traunstein kreative Lösungen, wie Pflege attraktiver werden .
Danke an alle engagierten Auszubildenden, die mit der Caritas Traunstein acht kreative Stationen auf die Beine gestellt haben – ihr habt Fachwissen geteilt, Klischees aufgelöst und neue Perspektiven eröffnet!
26.05.2025 - Kreisklinik Trostberg
Die Schilddrüse – Dirigent im Hormonorchester
Ein Gespräch zum Welt-Schilddrüsentag

Die Schilddrüse ist ein kleines schmetterlingsförmiges Organ unterhalb des Kehlkopfes und spielt eine zentrale Rolle in unserem Körper. Sie produziert die Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), die nahezu alle Körperfunktionen beeinflussen – vom Stoffwechsel über das Herz-Kreislauf-System bis hin zur geistigen Entwicklung. Zum Welt-Schilddrüsentag am 25. Mai haben wir mit Dr. Joachim Deuble, Chefarzt des Schilddrüsenzentrums an der Kreisklinik Trostberg, gesprochen, warum die Schilddrüse für unseren Körper so wichtig ist. mehr...
Herr Dr. Deuble, welche Auswirkungen hat es denn, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und wer ist besonders betroffen?
Eine Unterfunktion (Hypothyreose) führt zu Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme und Kälteempfindlichkeit. Eine Überfunktion (Hyperthyreose) kann Herzrasen, Gewichtsverlust und Nervosität verursachen. Beide Zustände beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Betroffen sind meist Frauen, und hier ältere Personen. Außerdem sollten Personen mit familiärer Vorbelastung auf die beschriebenen Symptome achten und regelmäßige Kontrollen durchführen lassen. Etwa jeder vierte Deutsche leidet an einer Schilddrüsenfunktionsstörung, es ist also kein Randphänomen. Besonders in Jodmangelgebieten wie Bayern sind Erkrankungen wie der Kropf (Struma) verbreitet.
Wie wird eine Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert?
Zunächst steht das Gespräch mit dem Patienten im Vordergrund. Hier fragt der Arzt oder die Ärztin gezielt nach Symptomen wie Müdigkeit, Nervosität, Gewichtsveränderungen oder Schlafproblemen. Auch familiäre Vorbelastungen werden berücksichtigt. Es folgt die körperliche Untersuchung, bei der der Hals abgetastet wird. Dabei kann der Arzt oder die Ärztin Knoten, Vergrößerungen oder Verhärtungen erkennen. Besonders wichtig ist die Blutuntersuchung: Gemessen werden die Schilddrüsenhormone T3 und T4 sowie das Steuerhormon TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon). Diese Werte geben präzise Auskunft über die Funktion des Organs. Ein hochauflösender Ultraschall liefert zusätzlich Informationen über die Größe, Struktur und Beschaffenheit der Schilddrüse. So lassen sich Knoten, Zysten oder entzündliche Veränderungen frühzeitig erkennen. In speziellen Fällen – etwa bei unklaren Knoten – wird eine Feinnadelpunktion durchgeführt. Dabei entnimmt der Arzt unter Ultraschallkontrolle Zellmaterial aus dem verdächtigen Bereich, das anschließend zytologisch untersucht wird.
Wenn der Verdacht auf eine Überfunktion besteht, kann eine Szintigrafie folgen – eine nuklearmedizinische Untersuchung, die zwischen heißen (aktiven) und kalten (inaktiven) Knoten unterscheidet. Diese Unterscheidung ist essenziell für die weitere Therapieplanung.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Die Behandlung richtet sich nach Art und Ausprägung der Erkrankung. Liegt eine Unterfunktion vor, wird meist das fehlende Hormon Levothyroxin lebenslang ersetzt. Diese Therapie ist gut verträglich, die Dosis wird individuell angepasst und regelmäßig kontrolliert. Bei einer Überfunktion kommen zunächst Thyreostatika zum Einsatz – Medikamente, die die Hormonproduktion bremsen. Wenn diese nicht ausreichend wirken oder Nebenwirkungen verursachen, gibt es zwei gut eingeführte Therapien: die Radiojodtherapie und die Operation.
Die operative Therapie ist besonders dann angezeigt, wenn sich große Knoten, ein auffälliger Ultraschallbefund oder ein Krebsverdacht zeigen, ebenso bei stark vergrößerter Schilddrüse mit Schluck- oder Atembeschwerden. Auch wenn kalte Knoten entarten könnten, wird zur Operation geraten. Bei uns in der Kreisklinik Trostberg erfolgt der Eingriff meist als sogenannte Schilddrüsenresektion. Je nach Befund wird entweder ein Teil der Schilddrüse entfernt (subtotale Resektion) oder die gesamte Schilddrüse (Totale Thyreoidektomie). Die Operation dauert in der Regel ein bis zwei Stunden und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Wichtig ist die Spezialisierung: Wir haben in unserer Klinik erfahrene Endokrine Chirurgen, so dass die Operation nach höchsten Sicherheitsstandards erfolgt. Während des Eingriffs wird der Stimmbandnerv mittels Neuromonitoring überwacht – das minimiert das Risiko einer Stimmbandlähmung erheblich. Auch die Nebenschilddrüsen, die den Kalziumhaushalt steuern, werden mittels Autofluoreszens-Scan sichtbar gemacht und sorgfältig geschont. Nach der Operation bleiben die Patienten meist zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Bei kompletter Entfernung der Schilddrüse ist eine lebenslange Hormontherapie erforderlich, die aber in der Regel gut eingestellt werden kann. Ein operativer Eingriff an der Schilddrüse ist heute ein sicherer Routineeingriff – vorausgesetzt, er wird in einem Schilddrüsenzentrum, wie bei uns an der Kreisklinik Trostberg, durchgeführt.
Wie kann man Schilddrüsenerkrankungen vorbeugen?
Eine ausreichende Jodzufuhr ist entscheidend. Dies kann durch den Verzehr von jodiertem Salz, Seefisch und Milchprodukten erreicht werden. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist: Achten Sie auf Ihren Körper und nehmen Sie Veränderungen ernst. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann viele Beschwerden verhindern.
22.05.2025 - Kreisklinik Trostberg
Telefonaktion „Schmerz lass nach…“
Am 3. Juni mit Richard Strauss, dem Leitenden Arzt der Multimodalen Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg im Rahmen des deutschlandweiten „Aktionstags gegen den Schmerz“

In einer Telefonaktion am 3. Juni von 9 Uhr bis 10.30 Uhr gibt er Anruferinnen und Anrufern die Möglichkeit, Fragen zu ihren Schmerzen und den Problemen damit zu stellen. Die Telefonnummer ist 08621 87-1290. Die Aktion ist eingebettet in den deutschlandweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“, der am darauffolgenden Tag stattfindet. mehr...
Richard Strauss, Leitender Arzt der Multimodalen Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg ist ein erfahrener Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, und ist Experte für interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie.
Die multimodale Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg kombiniert medizinische, physiotherapeutische und psychologische Maßnahmen. Ziel ist es, nicht nur die Schmerzursache zu behandeln, sondern auch den Umgang der Patientinnen und Patienten mit dem Schmerz zu verbessern. Das interdisziplinäre Team aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen, Therapeutinnen und Pflegekräften arbeitet dabei eng zusammen. Jeder Behandlungsplan wird individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt. Regelmäßige Gespräche, Bewegungstherapien und Entspannungsverfahren ergänzen die medikamentöse Behandlung. So wird eine nachhaltige Schmerzlinderung und eine Steigerung der Lebensqualität angestrebt.
20.05.2025 - Klinikum Traunstein
Pflege braucht Perspektiven
Ein Jahr nach Dienstantritt zieht die neue Pflegeleitung am Klinikum Traunstein Bilanz und blickt nach vorn.

Nach mehreren Jahren in leitender Funktion, unter anderem als Bereichsleiter der Chirurgie am KSOB-Standort Trostberg sowie zuletzt als Pflegedienstleitung und Mitglied der Klinikleitung an der Schön Klinik Vogtareuth, kehrte Johannes Schreiber im April 2024 an seine alte Wirkungsstätte zurück – diesmal in neuer Rolle: als Gesamtverantwortlicher für Pflege- und Funktionsdienste am Klinikum Traunstein. Heute, ein Jahr später, zieht er Bilanz und blickt zugleich nach vorne mit einem klaren Ziel: Pflege zukunftsfest aufzustellen. mehr...
Parallel beendete er im Oktober 2024 erfolgreich das berufsbegleitende Studium „Unternehmensführung für Gesundheitsberufe“ an der Technischen Hochschule Rosenheim.
Ein Gespräch mit Johannes Schreiber, Pflegeleitung und Mitglied der Klinikleitung am Klinikum Traunstein über Rückkehr, Reform und gelebte Verantwortung.
Sie haben einst Ihre Ausbildung an den Kliniken Südostbayern gemacht – und sind nach vielen Jahren als Führungskraft zurückgekehrt. Was hat Sie gereizt, die Pflegeleitung in diesen herausfordernden Zeiten zu übernehmen?
Herr Schreiber: Es war tatsächlich ein Stück weit wie Heimkommen – nicht nur geografisch, sondern auch emotional. Die Kliniken Südostbayern haben mich geprägt. Hier habe ich gelernt, was gute Pflege bedeutet. Die Möglichkeit, genau an diesem Ort etwas zu bewegen, hat mich sofort begeistert.
Natürlich ist die Lage herausfordernd: steigende Anforderungen an die Pflege, der demografische Wandel und die bevorstehende Krankenhausreform – das sind große Themen. Aber gerade deshalb war für mich klar: Ich will hier gestalten. Die Pflege hat enorme Potenziale, und ich möchte dazu beitragen, dass diese gesehen werden. Pflegekräfte verdienen Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten – und Rahmenbedingungen, die gutes Arbeiten möglich machen.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt und was konnten Sie bereits umsetzen?
Herr Schreiber: Ich bin mit drei klaren Schwerpunkten gestartet: Erstens, die Personalsituation zu stabilisieren. Zweitens, die Führungsstrukturen innerhalb der Pflege zu stärken. Und drittens, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern.
Wir haben inzwischen viele offene Stellen besetzen können – durch gezieltes Recruiting und eine strukturierte Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen. Die Fluktuation ist deutlich zurückgegangen.
Unsere Führungskräfte sind heute enger in strategische Prozesse eingebunden. Das hat nicht nur die Führungsqualität gestärkt, sondern auch die Identifikation mit den Zielen der Kliniken Südostbayern verbessert. Und: Die Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten ist spürbar enger geworden – das ist für eine wirklich patientenzentrierte Versorgung unerlässlich.
Was sind derzeit die größten Herausforderungen und wie begegnen Sie diesen?
Herr Schreiber: Die größte Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel – er ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt den Alltag. Gleichzeitig erleben wir einen Generationenwechsel in der Pflege. Junge Kolleginnen und Kollegen haben andere Erwartungen an Führung, Kommunikation und Arbeitskultur.
Wir reagieren mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, gezielter Förderung und einem kulturellen Wandel: weg von starren Hierarchien, hin zu mehr Mitgestaltung und echter Wertschätzung. Auch investieren wir konsequent in Aus- und Weiterbildung – und entwickeln Führungskräfte aus den eigenen Reihen. Denn wer Entwicklungsmöglichkeiten hat, bleibt nicht nur länger, sondern bringt auch neue Impulse mit.
Welche strukturellen oder kulturellen Veränderungen haben Sie angestoßen?
Herr Schreiber: Ein zentraler Schritt war die Neuaufstellung der Führungsebene. Wir haben unser Führungsteam neu besetzt, Rollen klar definiert und Verantwortlichkeiten geschärft. Das hat Entscheidungswege verkürzt und die Steuerung deutlich verbessert – sowohl strategisch als auch operativ.
Wichtig war uns auch, eine Kultur des Dialogs zu fördern. Wir haben gezielt Räume für Austausch geschaffen, eine positive Fehlerkultur etabliert und eine offene Feedbackkultur gestärkt. Veränderung gelingt nur, wenn Menschen sich einbringen und sich in ihren Rollen gesehen und gehört fühlen. Wir sehen dies an den KSOB auch als wichtiges Zukunftsbild – als unsere „Perspektive 2030+“.
Wie motivieren Sie Ihr Team gerade auch in belastenden Zeiten?
Herr Schreiber: Indem ich präsent bin. Ich suche aktiv das Gespräch, nehme Stimmungen auf und erkenne früh, wo es Bedarf für Unterstützung gibt. Gerade in stressigen Phasen ist es wichtig, dass Führung nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Wertschätzung ist für mich keine einmalige Geste. Sie zeigt sich im Alltag – durch ehrliches Interesse, durch persönliche Rückmeldungen und durch klare Anerkennung für das, was geleistet wird. So entsteht Zusammenhalt.
20.05.2025 - Kliniken Südostbayern
Die KSOB auf der Seniorenmesse
Messe mit rund 3500 Gästen, etwa 120 Ausstellern und rund 70 Fachvorträgen
Zum vierten Mal öffnete im Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein die vom VdK organisierte Seniorenmesse „60 aufwärts“ ihre Türen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Bereichen Gesundheit und Soziales. Nicht nur Senioren über 60 Jahren nutzten die vielfältigen Angebote und informierten sich.
Die Kliniken Südostbayern AG war wieder mit dabei und präsentierten dieses Mal die Akutgeriatrie der Kreisklinik Trostberg sowie das Onkologische Zentrum, die mit Informationsständen und Fachvorträgen vor Ort waren. Auch der Verein „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“ stellte interessante Angebote und wertvolle Informationen zur Verfügung. mehr...
In den Vortragsräumen gab es z.B. Ausführungen der Kriminalpolizeiinspektion
Traunstein über Trick-, Legenden- und Callcenterbetrug sowie zahlreiche Vorträge zu medizinischen Themen. Ein Höhepunkt im Vortragsprogramm war die „tierische Sprechstunde“ mit den ausgebildeten Therapiehunden Carlo und
Oskar von Dr. Tanja Weidlich. Die Hunde haben sehr viele positive Effekte
auf die Patienten in der Geriatrie in Trostberg.
In ganz Oberbayern gebe es „nichts Vergleichbares zur Traunsteiner Seniorenmesse“, so der VdK-Ehrenkreisvorsitzende Rudi Göbel.
18.05.2025 - Kliniken Südostbayern
„Azubi-Alarm“ gibt Einblicke in die Pflegeausbildung – direkt aus Schule und Klinik.
Neues Format liefert persönliche Einblicke in den Ausbildungsalltag

Amelie und Hannah sind keine Influencerinnen im klassischen Sinne. Doch seit Kurzem stehen sie regelmäßig vor der Kamera. Sie zeigen wie die Ausbildung auf Station, im Klassenzimmer oder bei Projekten abläuft. Mit dem neuen Format „Azubi-Alarm“ haben die angehenden Pflegefachkräfte, die zurzeit im 2. Ausbildungsjahr sind, ein neues Instagram-Format mit entwickelt. mehr...
Regelmäßig zeigen die beiden, was es heißt, Pflegefachkraft zu werden – mit allem, was dazugehört. Von der Frühschicht auf der Kinderintensivstation über Theorieunterricht bis hin zu Momenten, in denen medizinisches Wissen, abgefragt wird.
„Wir wollen zeigen, wie vielseitig die Ausbildung ist – und dass Pflege weit mehr bedeutet als Blutdruck messen“, sagt Hannah. Ihre Kollegin Amelie ergänzt: „Viele wissen gar nicht, wie spannend und anspruchsvoll unser Beruf ist. Wir hoffen, dass wir mit unseren Einblicken vielleicht den ein oder anderen motivieren können, eine Ausbildung in der Pflege zu starten.“
Der Instagram-Kanal der Kliniken Südostbayern richtet sich mit dem neuen Format gezielt an junge Menschen, die einen Beruf mit Sinn suchen – und auch an deren Eltern, die oft wichtige Berater bei der Berufswahl sind.
14.05.2025 - Kliniken Südostbayern
Team der Kliniken Südostbayern sammelt Spenden für Kinder in Nairobi
Mit einer Spendenaktion hat das Team der Frauenheilkunde an den Kliniken Südostbayern ein Zeichen für globale Solidarität gesetzt: 350 Euro konnten kürzlich an die Organisation „One-for-One“ übergeben werden. Die Freude bei der Spendenübergabe war groß – nicht zuletzt, weil die Gründerin des Vereins, Marion Daxer, selbst Ärztin an der Klinik ist. mehr...
„One-for-One“ unterstützt Kinder und Jugendliche in zwei Slums der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Der Fokus liegt auf Bildung, da sie der Schlüssel aus der Armut ist. Mit Hilfe von Spenden finanziert der Verein die Schulgebühren für derzeit 120 Kinder – inklusive Schulmaterial und Ausstattung. Seit Februar hat der Verein zudem eine kleine Bibliothek eröffnet. Hier können die Kinder täglich lernen, Hausaufgaben machen, bekommen Nachhilfe und dürfen auch einfach mal spielen. Am Wochenende wird vor der Bibliothek Porridge verteilt.
08.05.2025
Der stille Risikofaktor - Warum Bluthochdruck Herz und Nieren gefährdet
Ein Interview mit unseren Experten

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, still und gefährlich. Rund 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen – viele, ohne es zu wissen. Wir sprechen mit zwei Chefärzten der Kliniken Südostbayern: Prof. Dr. Carsten Böger, Hypertensiologe der Deutschen Hochdruckliga und der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie ESH und Chefarzt der Nephrologie, Diabetologie und Rheumatologie und Ärztlicher Leiter am KfH Nierenzentrum Traunstein sowie Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie, über Symptome, Wirkung und Heilung einer Krankheit, die selten wehtut – aber oft tötet. mehr...
Herr Prof. Dr. Böger, beginnen wir mit der Frage, die sich viele stellen: Woran merkt man, dass man Bluthochdruck hat?
Böger: Das ist genau das Tückische – man merkt es oft nicht. Hypertonie verläuft meist asymptomatisch, besonders am Anfang. Es gibt keine eindeutigen Signale. Viele erfahren von ihrer Erkrankung erst, wenn das Herz bereits leidet – oder schlimmer: wenn ein Schlaganfall oder Herzinfarkt eintritt.
Also ein „leiser Killer“, wie man so oft liest, Herr Prof. Dr. Lehrke?
Lehrke: Ganz genau. Bluthochdruck schädigt auf Dauer die Gefäße. Er lässt die Wände der Arterien dicker werden, fördert Arteriosklerose, verengt den Blutfluss – mit gravierenden Folgen. Er ist der größte Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und sogar Demenz. Und das Schlimmste: Man kann jahrelang damit leben – ohne es zu wissen.
Welche Symptome sollten denn Leserinnen und Leser ernst nehmen?
Lehrke: Bei sehr hohen Werten: Kopfschmerzen am Morgen, Schwindel, Nervosität, Schlafstörungen, Ohrensausen. Manchmal Herzklopfen. Aber das ist selten eindeutig. Viele merken es erst, wenn bereits Folgekrankheiten auftreten.
Böger: Da kommt dann mein Fachgebiet ins Spiel: die Nieren. Die feinen Gefäße der Nieren verschliessen sich durch Bluthochdruck, so dass die Nieren nach und nach ihre Filterfunktion verlieren. Das merkt man meist erst, wenn es zu spät ist und man Dialyse benötigt. Soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen.
Was passiert im Körper, wenn der Blutdruck zu hoch ist?
Lehrke: Der Druck in den Gefäßen steigt – bildlich gesprochen wie in einem zu stark aufgepumpten Fahrradreifen. Das Herz muss härter arbeiten, die Gefäßwände verdicken, werden unelastisch. Das erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche. Und: Der hohe Druck schädigt die inneren Organe.
Böger: Und irgendwann entwickelt sich das zu einer chronischen Nierenschwäche – und dann wird’s ernst: Die Patientinnen und Patienten müssen zur Dialyse.
Was sagen denn die Zahlen?
Lehrke: Laut Deutscher Hochdruckliga sterben jedes Jahr rund 350.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Bluthochdrucks. Das ist mehr als an Krebs – und trotzdem wird Hypertonie unterschätzt.
Wie kommt es überhaupt zu Bluthochdruck?
Böger: In 90 bis 95 Prozent der Fälle sprechen wir von primärer Hypertonie – also ohne klare Ursache. In den anderen 5-10 Prozent sind häufig vorbestehende chronische Nierenerkrankungen die Verursacher der Hypertonie verantwortlich, selten sind es Störungen der Hormone, die den Blutdruck steuern. Bei Vorliegen von Bluthochdruck muss daher unbedingt eine auch bestehende chronische Nierenerkrankung ausgeshclossen werden. Eine Abklärung hierfür erfolgt wo nötig auf Zuweisung der hausärztlichen Praxis in eine Spezialsprechstunde wie am KfH Nierenzentrum Traunstein. Aber: Lebensstil spielt eine riesige Rolle. Übergewicht, zu viel Salz, Alkohol, Bewegungsmangel, Stress. Der Blutdruck ist ein Spiegel unseres Lebenswandels, aber auch der Gene. Es gibt eine familiäre Häufung – wer Eltern mit hohem Blutdruck hat oder übergewichtig ist, sollte besonders achtsam sein.
Ab wann gilt Blutdruck als zu hoch?
Lehrke: Die Schwelle liegt bei 140 zu 90 mmHg in wiederholten Messungen, nicht nur einmal in der Arztpraxis. Wichtig: die Messung muss richtig durchgeführt werden (Mittelwert aus 2-3 Messungen nach 5 Minuten Ruhe). Alles darüber erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich.
Böger: Wichtig ist nicht nur die Schwelle, oberhalb der man von Bluthochdruck spricht, sondern auch das Ziel, wo man mit einer Behandlung hinmöchte. Dieses Ziel legen die hausärztliche Praxis gemeinsam mit den „Organspezialisten“ (Nephrologie, Kardiologie) fest. Für Diabetiker oder Menschen mit Nierenerkrankungen gilt zum Beispiel 120-130 mmHg systolisch als Ziel. Bei der Einstellung der Therapie auf diese Ziele ist es aber wichtig, die Verträglichkeit im Blick zu haben.
Wie oft sollte man seinen Blutdruck messen?
Lehrke: Einmal jährlich – mindestens. Ab 40 am besten halbjährlich, und bei bekannten Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes oder familiärer Vorbelastung sogar vierteljährlich. Idealerweise auch zuhause mit einem validierten Gerät.
Und wenn er zu hoch ist?
Böger: Dann ist die Änderung des Lebensstils die erste Maßnahme: weniger Salz, mehr Bewegung, einige Kilogramm weniger – und der Blutdruck sinkt oft deutlich. Abnehmen kann man übrigens manchmal einfach schon durch Umstellen von kohlenhydratreichen Getränken (Limo, Fruchtsächte, Bier) auf Wasser. Reicht die Lebensstilveränderung nicht, helfen Medikamente. ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker, Kalziumanantagonisten, spezielle Wassertabletten (thiazidähnliche Diuretika), usw. – die Palette ist groß. In fast allen Patientinnen und Patienten lässt sich der Blutdruck gut einstellen. Wichtig ist: dauerhaft einnehmen. Bluthochdruck ist keine Grippe, die irgendwann ausgeheilt ist.
Ist Heilung möglich?
Lehrke: Man kann Bluthochdruck in vielen Fällen gut einstellen – sogar ganz ohne Medikamente, wenn man früh genug gegensteuert. Aber „heilbar“ ist er in dem Sinne eher nicht. Wer einmal Bluthochdruck hat, bleibt sein Leben gefährdet. Aber: Man kann ihn in Schach halten. Und zwar sehr effektiv – wenn man mitmacht. Patienten, die ihren Lebensstil ändern und ihre Medikamente zuverlässig nehmen, leben deutlich länger und besser.
Gibt es neue Entwicklungen in der Therapie?
Böger: Ja, spannend ist die sogenannte renale Denervation – ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem überaktive Nerven in den Nierenarterien verödet werden. Allerdings ist diese Therapie nicht unumstritten, weshalb sie nur für die sehr wenigen Patienten in Frage kommt, bei denen die Medikamente nicht helfen.
Lehrke: Und in der Diagnostik wird die Langzeitmessung immer wichtiger – also 24-Stunden-Blutdruckprofile, um die „weiße-Kittel-Hypertonie“, also den Bluthochdruck in der Arztpraxis, zu entlarven und den echten Wert zu ermitteln.
Was raten Sie abschließend?
Lehrke: Nehmen Sie Bluthochdruck ernst. Messen Sie ihn regelmäßig. Reden Sie mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Und leben Sie so, dass Ihr Herz auch in zwanzig Jahren noch gerne schlägt.
Böger: Und schützen Sie Ihre Nieren! Denn wenn die versagen, wird alles andere kompliziert. Hypertonie ist kein Schicksal – es ist eine Frage der Aufmerksamkeit und Konsequenz.
TELEFON-HOTLINE am WELTHYPERTONIE-TAG:
Prof. Dr. med. Carsten Böger steht am 15.5.2025 von 16-18 Uhr am Info-Telefon der Deutschen Hochdruckliga als Experte für Ihre Fragen zur Verfügung. Rufen Sie gerne an unter 0800 – 090 92 90
So halten Sie Ihren Blutdruck gesund
- Normalgewicht anstreben
- Täglich bewegen – 30 Minuten sind ein guter Wert
- Weniger Salz (max. 5 g/Tag)
- Alkohol reduzieren
- Stress abbauen
- Nicht rauchen
- Blutdruck, richtig gemessen, regelmäßig kontrollieren
02.05.2025
Chronische Wunden am Bein
Ursachenbekämpfung statt nur Verbände

Chronische Wunden am Bein bestehen oft über Monate – manchmal sogar Jahre. Moderne Wundauflagen allein reichen selten aus. Was wirklich hilft, ist der Blick auf die Ursachen, erklärt Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie und endovaskulären Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall und Klinikum Traunstein. mehr...
Insbesondere bei älteren Menschen oder Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Durchblutungsstörungen sind chronische Beinwunden ein zunehmendes Gesundheitsproblem. Trotz moderner Wundauflagen und engagierter Versorgung heilen sie häufig nur sehr langsam oder gar nicht ab. Für die Betroffenen sind die körperlichen und seelischen Belastungen enorm – von Schmerzen über Bewegungseinschränkungen bis hin zur sozialen Isolation. Auch für das medizinische System sind solche langwierigen Verläufe eine Herausforderung: Hoher Versorgungsaufwand, steigende Kosten, Frustration bei Patienten und Behandelnden.
Wundpflege ist kein Dauerzustand
„Leider sehen wir es viel zu oft, dass chronische Wunden Monate oder noch länger einfach nur verwaltet werden: Jemand kommt drei Mal die Woche, macht einen Verband, aber das eigentliche Ziel, nämlich die komplette Abheilung, gerät aus dem Fokus“, erklärt Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Der Grund dafür liegt häufig in einem weit verbreiteten Reflex: Statt nach dem „Warum“ zu fragen, wird sofort über die passende Wundauflage nachgedacht.
„Doch das ist der dritte Schritt. Der erste Schritt muss immer die Ursachensuche sein, dann kommt die Ursachenbekämpfung“, so Dr. Kiechle. In rund 80 Prozent der Fälle steckt hinter der chronischen Wunde ein Gefäßproblem. Am häufigsten liegt eine venöse Ursache vor. „Krampfadern, wiederholte Venenthrombosen – sie sorgen dafür, der Blutabfluss aus dem Bein gestört ist. Die Haut verändert sich, wird bräunlich, verhärtet, und irgendwann bricht sie auf,“ beschreibt der Gefäßspezialist.
Doch auch arterielle Durchblutungsstörungen – etwa durch Arteriosklerose – sind verantwortlich. „Wenn zu wenig sauerstoffreiches Blut in den Fuß gelangt, kann das Gewebe absterben und nicht mehr heilen. Und dann hilft auch die beste Wundauflage nichts.“
Auch Lymphabfluss-Störungen, diabetische Nervenschäden oder eine chronische Druckeinwirkung – etwa durch ungeeignetes Schuhwerk oder Fehlstellungen – können das Wundmilieu erheblich beeinträchtigen. Hinzu kommen Knochenentzündungen, Wassereinlagerungen, hartnäckige bakterielle Besiedelungen oder spezielle Hauterkrankungen. „Das alles sind ernstzunehmende Faktoren, die oft übersehen werden, obwohl sie gezielt behandelt werden müssten“, so Dr. Kiechle.
Der Weg zur Heilung: Ursachen erkennen, gezielt handeln
Dr. Kiechle und sein Team setzen deshalb im Klinikum Traunstein und in der Kreisklinik Bad Reichenhall auf ein strukturiertes Vorgehen. „In der Regel nehmen wir betroffene Patienten stationär auf. Zuerst wird ein Gefäßultraschall durchgeführt, um den Zustand von Venen und Arterien genau zu beurteilen, häufig folgen dann weiterführende Gefäßdarstellungen und gegebenenfalls andere Untersuchungen. Wir schauen uns die Tiefe der Wunde an, analysieren den Bakterienbefall und prüfen, ob der zum Beispiel Knochen mitbetroffen ist.“ Zentral sei sehr oft das sogenannte Débridement – das operative Anfrischen der Wunde. „Chronische Wundbeläge müssen entfernt werden, das kann eine Wundauflage meist nicht alleine leisten. Nur durch eine gründliche Vorbereitung der Wundfläche kann eine Heilung überhaupt erst in Gang kommen.“ Im Anschluss folgt immer eine individuell abgestimmte Therapie. Ist der Blutfluss gestört, muss er wiederhergestellt werden – etwa durch eine Gefäß-Operation, Stenteinlage in Schlagadern oder bei Venenproblemen durch eine Kompressionstherapie. Liegt eine bakterielle Entzündung vor, ist möglicherweise eine antibiotische Behandlung nötig. Auch orthopädische Maßnahmen oder die Behandlung von Grunderkrankungen wie Diabetes gehören dazu. „Oft braucht es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Fachrichtungen, um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen.“
Eine Wunde ist ein Warnzeichen
„Wir verwenden natürlich auch moderne Wundauflagen, häufig bei der stationären Behandlung etwa sogenannte Vakuumverbände“ betont Dr. Kiechle. „Aber die Vorstellung, dass diese alleine das Problem lösen, ist gefährlich. Das ist so, als würde man bei chronischen Kopfschmerzen langfristig Tabletten geben, ohne zu prüfen, ob nicht etwa gar ein Hirntumor dahintersteckt.“ Chronische Wunden brauchen Geduld, interdisziplinäres Denken und eine klare Strategie. „Eine Wunde, die nicht heilt, ist immer ein Warnzeichen. Sie ist kein Normalzustand – und muss ernst genommen werden.“ Der Appell des Mediziners: „Wer unter einer chronischen Wunde leidet, sollte sich nicht mit der reinen Wundpflege zufriedengeben. Fragen Sie nach dem Warum. Und lassen Sie die Gefäße überprüfen – nur so hat die Wunde überhaupt eine Chance, zu heilen.“
17.04.2025 - Klinikum Traunstein
19. Chiemgauer Krebskongress: Austausch auf höchstem Niveau
Der 19. Chiemgauer Krebskongress setzte erneut ein starkes Zeichen für fachlichen Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Onkologie. Am 11. April fanden sich rund 140 Teilnehmende aus Medizin, Fachpflege und Wissenschaft im Kulturforum Klosterkirche in Traunstein ein, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Krebstherapie zu informieren, zu diskutieren und sich auszutauschen. mehr...
Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Thomas Kubin, Sprecher des zertifizierten Onkologischen Zentrums Traunstein, Leiter des Schwerpunkts Lymphome und Leukämien und Chefarzt Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Traunstein, der auch über Berichte und Neuerungen weltweit rund um den Weltkrebstag informierte. Demnach rechne die WHO bis zum Jahr 2050 mit einem Anstieg der Krebsfälle weltweit um über 70%. Umso wichtiger müssten hier die Bemühungen um Krebsfrüherkennung und Verhaltensregeln für die Krebsvermeidung werden, erklärte Dr. Kubin eindringlich.
Die Vorträge bewegten sich durchweg auf höchstem fachlichen Niveau – viele davon wurden von den erfahrenen Expertinnen und Experten des Onkologischen Zentrums am Klinikum Traunstein selbst gehalten, beispielsweise zu neuen Erkenntnissen und Behandlungsmethoden bei Endometriumkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Nierenzellkarzinom und Magenkarzinom. In einem hochkarätigen Gastvortrag referierte Prof. Dr. Christina Rieger (LMU Klinikum Großhadern/Germering, Vorsitzende der AG-Infekt der DGHO und Leitlinienautorin) über Abwehrschwäche und Impfstrategien bei onkologischen Patientinnen und Patienten.
Leistungsstarke onkologische Versorgung in der Region
Dr. Stefan Paech, Medizinischer Leiter Verbund Kliniken Südostbayern, berichtete über die künftige onkologische Versorgung in der Region und zog aufgrund des leistungsstarken Onkologischen Zentrums ein positives Fazit für die Patientinnen und Patienten aus den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein. Prof. Dr. Christian F. Jurowich, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Traunstein und am InnKlinikum Altötting/Mühldorf, erläuterte in seinem Beitrag fünf aktuelle Fragen zur chirurgischen Therapie des Magenkarzinoms. Die standortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Klinikverbünden war dann auch Thema des Vortrags von Dr. Lutz Woldrich, Leitender Oberarzt Thoraxchirurgie, Klinikum Traunstein und Sektionsleiter Thoraxchirurgie InnKlinikum Mühldorf.
Die Veranstaltung bot nicht nur wissenschaftlichen Input, sondern auch genug Raum für persönlichen Austausch. In den Pausen und im Anschluss an das Programm wurde intensiv genetzwerkt – eine Gelegenheit, die von vielen Teilnehmenden geschätzt wurde, denn mit seinem abwechslungsreichen Programm, dem angenehmen Ambiente und der Möglichkeit zur Vernetzung bleibt der Chiemgauer Krebskongress eine Institution in der medizinischen Fortbildungslandschaft Südostbayerns.
16.04.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall/ Fachklinik Berchtesgaden
Schnell wieder auf die Beine kommen
Alterstraumazentrum in der Fachklinik Berchtesgaden/ Kreisklinik Bad Reichenhall erneut zertifiziert

Ein Zentrum für Sicherheit im Alter: Das gemeinsame Alterstraumazentrum der Fachklinik Berchtesgaden und der Unfallchirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall bietet umfassende Früh-Rehamaßnahmen an, von denen ältere Patientinnen und Patienten, meist nach Stürzen, profitieren – mit dem Ziel, ihre Selbstständigkeit wiederherzustellen. Das Zentrum wurde 2019 anerkannt und im Januar 2025 erneut zertifiziert. In diesem Zeitraum konnten mehr als 1.500 Patienten altersgerecht behandelt werden. mehr...
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Stürze und damit verbundene Verletzungen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, setzt das Alterstraumazentrum auf eine umfassende, interdisziplinäre Versorgung – und wurde im Januar 2025 erneut zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität der Sofort-Rehamaßnahmen für ältere Patienten.
"Unser Ziel ist es, die Alltagsfähigkeit unserer Patienten so gut wie möglich wiederherzustellen", erklärt Dr. Jitka Ptacek, Leitende Ärztin Akutgeriatrie am KSOB-Standort Berchtesgaden. "Wir wollen Pflegebedürftigkeit verhindern und den Betroffenen wieder ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen."
Enge Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Bad Reichenhall
Die enge Zusammenarbeit mit der Unfallchirurgie in der Kreisklinik Bad Reichenhall spielt dabei eine wichtige Rolle. Dort werden die notwendigen Operationen in der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie durchgeführt – unter der Leitung des neuen Leitenden Arztes Dr. Florian Zoffl; der Koordinator des Alterstraumazentrums ist der Reichenhaller Oberarzt Dr. Michael de Jesus Pereira. "Wir Geriater aus der Fachklinik Berchtesgaden sind oft schon vor der Operation involviert", berichtet Dr. Ptacek, "Wir passen die Medikation an und schaffen so optimale Vorbedingungen für die Operation und planen die anschließende Früh-Rehabilitation der Patientinnen und Patienten bei uns in Berchtesgaden. Hier werden sie von einem Team (Ärzte, Pflege, Ergo- und Physiotherapeuten, Sozialpädagogin, gegebenenfalls von auch Logopäden, Psychologin und Diätassistentin) umfassend betreut. Wichtig für die Betroffenen ist, dass alles für sie organisiert wird, sie brauchen sich nicht nochmals um den Therapieplatz kümmern."
Die Patienten brauchen sich nicht kümmern
Nach dem Eingriff oder Einleitung der konservativen Therapie in Bad Reichenhall folgt der direkte Transfer in die Fachklinik Berchtesgaden, wo das Team der Alterstraumatologie die Frührehabilitation übernimmt. Zwei Mal pro Woche unterstützt Dr. Pereira die Visiten in Berchtesgaden, während Dr. Ptacek dreimal wöchentlich gemeinsam mit den Stationsärzten an den Patientenvisiten in der Kreisklinik Bad Reichenhall teilnimmt.
Von den Leistungen des Zentrums profitieren Patienten ab 70 Jahren, die nach Stürzen oder Unfällen aufgrund altersbedingter Einschränkungen mehr Zeit für die Rekonvaleszenz und intensive, individuell angepasste Therapien benötigen, um wieder gesund zu werden. Diese Therapien erfolgen ausschließlich in Einzelbetreuung, um den spezifischen Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht zu werden.
Besonderen Wert legt das Zentrum auf die Behandlung und Prävention von Osteoporose, einer häufigen Ursache für Knochenbrüche im Alter. "Wir wollen nicht nur die aktuellen Verletzungen heilen, sondern wenn möglich auch das Risiko für zukünftige Stürze minimieren", betont Dr. Ptacek. Für Ältere und ihre Angehörigen ist das Alterstraumazentrum damit eine verlässliche Anlaufstelle in gesundheitlich und seelisch herausfordernden Zeiten.
14.04.2025 - Klinikum Traunstein
Wenn der Teddy krank ist
Teddyklinik zeigt Kindergartenkindern, dass sie keine Angst vor dem Krankenhaus haben müssen
Am Klinikum Traunstein herrscht lebhafter Andrang. Rund 140 Kinder aus sechs Kindergärten der Region besuchten zusammen mit ihren Kuscheltieren die liebevoll gestaltete Teddyklinik der Kinderstation am Klinikum Traunstein. Ziel der Aktion war es, den kleinen Besuchern altersgemäß die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen und ihnen zugleich erste Einblicke in medizinische Abläufe und Berufe zu ermöglichen. mehr...
„Wir wollen den Kindern spielerisch zeigen, wie Untersuchungen funktionieren, wie Röntgenbilder entstehen oder wie man richtig verbindet, damit sie die Angst vor einem Klinikbesuch verlieren“, erklärt die gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenschwester Julia Schimpfhauser, die auf der Kinderstation am Klinikum Traunstein arbeitet und Initiatorin der Aktion ist, die sie gemeinsam mit Gabi Ramstötter und vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen umgesetzt hat. Unterstützt wurde sie dabei auch von Nico Hanny, dem Gründer des Teddybärkrankenhauses Rosenheim. Der Mediziner hat neben wertvollen Tipps auch Equipment zur Verfügung gestellt, ein selbstgebasteltes MRT und einen Overhead-Projektor, mit dem die Röntgenbilder gezeigt wurden.
Die Kindergartenkinder konnten mit ihren verletzten Kuscheltieren den gesamten Krankenhausablauf durchlaufen – von der Patientenaufnahme über die Behandlung bis hin zur Apotheke, wo süße Medikamente warteten. Besonders aufregend war der Blick in einen echten Rettungswagen des BRK und die hautnahe Begegnung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14. Benjamin Rosnitschek, Kindergartenleitung St. Josef in Traunstein, war begeistert: „Ein sehr spannendes Projekt, das den Kindern großen Spaß gemacht hat. Für unsere Gruppe, die aktuell das Thema Berufe behandelt, passt das perfekt. Hier erleben die Kinder hautnah, welch spannende Berufsfelder ein Krankenhaus bietet.“
Dabei war die Liste der Erkrankungen der Kuscheltiere lang und fantasievoll: Einhörner mit verschluckten Legosteinen, Teddys mit Knochenbrüchen nach Dachstürzen und Plüschtierpatienten, die dringend ins MRT mussten. „Für unsere Auszubildenden und Praktikanten ist das ebenfalls eine wertvolle Erfahrung. Sie lernen so, wie man Kindern Ängste vor Untersuchungen nimmt“, erklärt Julia Schimpfhauser.
Mit dabei auch die Hoffnung, dass viele der kleinen Besucher ihre Scheu vor medizinischen Einrichtungen verlieren und vielleicht sogar eines Tages selbst in der Pflege oder Medizin arbeiten wollen.
12.04.2025 - Klinikum Traunstein
Schmerzen beim Gehen? Es könnten die Gefäße sein
Über die unterschätzte Gefahr der Schaufensterkrankheit

Viele Menschen halten Schmerzen beim Gehen für ein Altersphänomen – ein Irrtum, der gefährlich werden kann. Dr. Volker Kiechle, Chefarzt Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie an den Kliniken Südostbayern, erklärt anlässlich des Deutschen Venentags am 12. April, wie die sogenannte „Schaufensterkrankheit“ entsteht, wo die Ursachen liegen können und welche modernen Therapien helfen. mehr...
Herr Dr. Kiechle, warum ist die Schaufensterkrankheit mehr als nur ein harmloses Altersleiden?
Weil sie Ausdruck einer ernsthaften Gefäßerkrankung sein kann – der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, kurz: pAVK. Das äußerst sich zunächst mit Schmerzen bei Belastung – typischerweise erst nach einer gewissen symptomfreien Gehstrecke, meist in der Wade, seltener im Oberschenkel oder Gesäß. Wer stehen bleibt, merkt: Der Schmerz lässt nach. Viele Betroffene verharren dann scheinbar interessiert vor einem Schaufenster, denn nach dem Stehenbleiben kommt es in der Regel zu einer raschen Besserung – daher der Begriff „Schaufensterkrankheit“. Die Betroffenen berichten typischerweise über einen sehr schmerzhaften, meist einseitigen Wadenkrampf. Zusätzlich weist das Vorliegen einer Durchblutungsstörung der Beine auch auf mögliche Gefäßveränderungen der Herzkranzarterien oder der Hirnarterien hin, ist also ein wichtiger Marker für eine allgemeine Arteriosklerose.
Was verursacht diese Gefäßverengungen?
Hinter den Gehschmerzen steckt eine arterielle Durchblutungsstörung des Beines. Die Arterien (Schlagadern) des Beckens, der Leiste und der Knieregion sind hauptverantwortlich für die Blutversorgung der Muskulatur der unteren Extremität. Durch Ablagerungen an den Innenwänden dieser Arterien (sog. Arteriosklerose) können sich Engstellen oder Verschlüsse bilden, die allmählich zu einer Verminderung der Durchblutung führen. Die verursachenden Faktoren sind bekannt: Rauchen, Bluthochdruck, zu hohe Cholesterinwerte, Diabetes. Wer keine dieser Faktoren aufweist, hat ein geringeres Risiko. Aber die Realität ist: Die meisten Patientinnen und Patienten bringen gleich mehrere dieser Belastungen mit.
Wie stellen Sie die Diagnose?
Zur Diagnosestellung wichtig – und um andere Ursachen auszuschließen – ist neben der genauen Patientenbefragung das Tasten der Pulse an den Beinen. Fehlt etwa der Puls in der Leiste, deutet dies auf eine Engstelle der Beckenarterie hin. Dann folgt die Duplexsonografie – ein Gefäßultraschall, mit dem wir völlig nebenwirkungsfrei die gesamte Blutversorgung vom Bauch bis zum Unterschenkel darstellen können. Engstellen, Verschlüsse, Verkalkungen – alles wird sichtbar. Am häufigsten sehen wir Engstellen und Verschlüsse der Leisten- oder Oberschenkelarterie, was dann eben zur Minderdurchblutung der Unterschenkel- und insbesondere der Wadenmuskulatur führt, wodurch die geschilderten Beschwerden entstehen. Wichtig ist, dass die Diagnose „pAVK“ richtig gestellt wird und nicht etwa, bei ähnlicher Symptomatik, eine vermeintliche Erkrankung der Lendenwirbelsäule vermutet wird.
Was passiert dann?
Sollte sich zum Beispiel im Gefäßultraschall eine Engstelle der Oberschenkelarterie erkennen lassen, wäre als ideale Behandlung die Ballonaufdehnung dieser Stelle, ggf. mit zusätzlicher Einbringung einer Gefäßstütze (Stent), zu empfehlen. Dabei handelt es sich um ein häufiges und sicheres Verfahren, was meist über eine Punktion der Leistenarterie in lokaler Betäubung durchgeführt wird und mit einem kurzen stationären gefäßchirurgischen Aufenthalt von zwei Tagen verbunden ist. Es ist auch möglich, mit dieser Methode komplett verschlossene Arterienabschnitte wieder zu rekanalisieren. Ein vielversprechendes neueres Verfahren ist daneben etwa die sogenannte Lithoplastie. Dabei können mit einem entsprechenden Ballon einengende Kalkablagerungen zertrümmert werden. Damit lässt sich eine offene Operation vermeiden.
Was ist, wenn längere Abschnitte einer Blutbahn verschlossen sind?
Bei langstreckigen Verschlüssen hilft oft nur eine offene Operation. Derartige ausgedehnte Befunde werden dann zunächst noch mittels Kernspin oder Computertomografie verifiziert. Dann legen wir einen Bypass – zum Beispiel von der Leistenschlagader zur Kniearterie. Dies bedeutet, man leitet das Blut, z.B. von der Leistenschlagader ausgehend, vorbei an einer langstreckig verschlossenen Oberschenkelschlagader zur Knie-Arterie. Dabei verwenden wir, wenn möglich, körpereigene Venen, alternativ mit gutem Erfolg auch Gefäßprothesen aus Kunststoff. Der stationär-gefäßchirurgische Aufenthalt bei solchen Operationen beträgt ca. eine Woche. Aber das Entscheidende ist: Der Patient gewinnt Lebensqualität zurück. Viele können wieder schmerzfrei gehen, zum Teil auch wieder lange Strecken. Dennoch ist eine dauerhafte medikamentöse Begleittherapie erforderlich, die auf die Eindämmung der Arteriosklerose abzielt, in erster Linie Blutverdünner (z. B. ASS) und Cholesterinsenker. Selbstverständlich sollte der Nikotinkonsum eingestellt und eine ausgewogene Ernährung angestrebt werden. Nicht zu vernachlässigen ist bei ausgeprägter arterieller Durchblutungsstörung auch eine Abklärung des Herzens, da die Arteriosklerose, wie erwähnt, nicht nur die Becken- oder Beinarterien betreffen kann, sondern auch die Herzkranzarterien. Das sollten die Betroffenen in einer kardiologischen Praxis abklären lassen.
Was passiert, wenn man zu lange wartet?
Meist sind die Eingriffe, die wegen der Schaufensterkrankheit durchgeführt werden, gut planbar und nicht dringlich. Sollten infolge der schlechten Durchblutung jedoch bereits Fußschmerzen in Ruhe, z.B. nachts, oder offene Stellen am Fuß vorhanden sein, drohen ernsthafte Komplikationen: Dann sind eine sofortige stationäre gefäßchirurgische Diagnostik und zeitnahe Therapie wichtig. Die Gefäßmedizin kann heute viel. Man muss ihr nur rechtzeitig eine Chance geben.
11.04.2025 - Kliniken Südostbayern
Geschlechterrollen? Da pfeifen wir drauf.
Spannende Einblicke beim bundesweiten Girls‘ und Boys‘ Day

Beim bundesweiten Girls‘ und Boys‘ Day bekamen Jungen und Mädchen spannende Einblicke in die Welt unserer Kliniken Südostbayern.
An unseren Standorten in Traunstein und Trostberg lernten sie die Grundlagen der Reanimation kennen, trainierten wie man sich bei Notsituationen verhält und besichtigten die Notaufnahme und Intensivstation am Klinikum Traunstein. An der Kreisklinik Trostberg erkundeten die Jungs den OP-Bereich und trainierten mit unseren Physiotherapeuten verschiedene Übungen. mehr...
In Bad Reichenhall schnupperten Mädchen in unsere Klinik-Küche und bereiteten direkt ein komplettes Menü zu: Frische Kürbiscremesuppe, leckere Spaghetti mit Berner Sauce und als süßen Abschluss Pfannkuchen mit fruchtiger Beerensauce. Die Begeisterung war so groß, dass sie zu Hause direkt weitermachen wollten!
Ein großes Dankeschön an alle Jungen und Mädchen – ihr habt gezeigt, dass Talent und Interesse keine Geschlechtergrenzen kennen. Wir freuen uns auf euch als zukünftige Kolleginnen und Kollegen.
11.04.2025 - Klinikum Traunstein
Diagnose Parkinson – und dann?
Die Neurologie am Klinikum Traunstein und das Netzwerk Parkinson begleiten Betroffene in jeder Phase

Rund 400.000 Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Parkinson – Tendenz steigend. Zum Welt-Parkinson-Tag am 11. April erklärt Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Traunstein im Interview, wie die Krankheit entsteht, worauf Betroffene achten sollten – und wie die Neurologie am Klinikum Traunstein und das neu gegründete Parkinson-Netzwerk Südostbayern Patientinnen und Patienten helfen und sie unterstützen können. mehr...
Herr Prof. Dr. Etgen, Parkinson kennt man als die Krankheit des Zitterns. Was steckt medizinisch eigentlich dahinter und wer ist betroffen?
Die Parkinson-Krankheit ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Genauer gesagt betrifft sie die Nervenzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Dopamin ist wesentlich für die Steuerung unserer Bewegungen. Wenn diese Zellen absterben, kommt es zu den typischen Symptomen, wie Zittern, Muskelsteifheit oder verlangsamten Bewegungen. Die meisten Erkrankten sind über 60 Jahre alt, aber auch Jüngere können erkranken. Bei diesen spielen oft genetische Faktoren eine größere Rolle. Insgesamt gilt: Parkinson kann theoretisch jeden treffen, wobei Männer etwas häufiger erkranken als Frauen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Parkinson nach dem Einsatz von Pestiziden eine Berufskrankheit darstellen kann.
Was sind die ersten Warnzeichen, auf die man achten sollte?
Die Krankheit beginnt meist schleichend. Erste Anzeichen sind bestimmte Schlafstörungen oder ein Verlust des Geruchssinns, später treten einseitiges Zittern, kleinere Handschrift oder eine Verlangsamung der Bewegungen auf. Auch depressive Verstimmungen können frühe Hinweise sein. Wichtig ist: Wer solche Symptome bei sich bemerkt, sollte frühzeitig mit seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt sprechen.
Wie geht es dann weiter, wenn der Hausarzt einen Verdacht hat?
Dann ist eine fachärztliche Abklärung unerlässlich – in der Regel bei einer Neurologin oder einem Neurologen. Ist die Diagnose gesichert, kann im Gespräch geklärt werden, wie es weitergehen kann, denn es beginnt für die Betroffenen ein Weg, der gut begleitet werden muss. Viele Patientinnen und Patienten leiden auch an Depressionen, Ängsten oder sozialem Rückzug. In manchen Fällen kann auch eine stationäre neurologische Abklärung sinnvoll sein. Unsere Klinik für Neurologie hier in Traunstein bietet neben der Diagnostik auch individuelle Therapien an – für frühe Stadien ebenso wie bei fortgeschrittener Erkrankung. Mit unserer Parkinson-Komplexbehandlung versuchen wir, unseren Patienten auf vielen Ebenen zu helfen. Neben individueller sorgfältiger Anpassung der Medikation (ggf. auch mit einer Pumpentherapie) und unserem spezialisierten Therapeutenteam (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie), bieten wir auch Sozialberatung (Versorgung, Hilfsmittel, etc.) und psychiatrische Unterstützung an. Unser Ansatz ist ganzheitlich, wir sehen nicht nur das Zittern, sondern den ganzen Menschen – mit all seinen Sorgen, Bedürfnissen und Möglichkeiten. Wichtig dabei ist: Niemand wird allein gelassen – und dafür haben wir letztes Jahr im Mai auch das Parkinson-Netzwerk Südostbayern und dessen Angebote ins Leben gerufen.
Was war der Anlass, dieses Netzwerk zu gründen und wie funktioniert es?
Die Netzwerk-Idee stammt aus den Niederlanden und hat sich so bewährt, dass sie dort inzwischen flächendeckend eingesetzt und von den Kassen finanziert wird. Davon sind wir in Deutschland leider weit entfernt. Inzwischen wurden 15 solche Netzwerke in Deutschland gegründet, in ganz Bayern sind wir das erste Parkinson-Netzwerk. Dabei ist gerade bei einer komplexen Erkrankung wie Parkinson eine enge regionale Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend. Mit dem Parkinson-Netzwerk wollen wir die Versorgung im Raum Traunstein, Berchtesgadener Land und den angrenzenden Regionen nachhaltig verbessern – und damit auch die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Unser Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Vernetzung und Kommunikation auf Augenhöhe. Beteiligt sind niedergelassene und Klinik-Ärztinnen und -Ärzte aus der Neurologie, Allgemeinmedizin, Geriatrie oder Inneren Medizin – aber auch Reha-Einrichtungen, Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten, Apotheken, Sanitätshäuser und auch das Landratsamt. Wir bilden ein Netz, das den Patienten auffängt – und gemeinsam betreut. Eine Aufgabe unseres Netzwerkes war die Gründung einer Parkinson-Selbsthilfegruppe. Dafür findet das Gründungstreffen am Donnerstag, den 24.04.2025, um 18:00 Uhr im Landratsamt Traunstein statt. Denn der Austausch mit anderen Betroffenen ist etwas, das oft zu kurz kommt, aber sehr entlastend sein kann.
Gibt es Hoffnung auf Heilung?
Heilung im klassischen Sinne gibt es leider noch nicht. Aber die Forschung macht Fortschritte, etwa bei medikamentösen Therapien oder neuen Ansätzen, wie dem so genannten „Hirnschrittmacher“, der sich allerdings nur für bestimmte Parkinsonkranke eignet. Wichtig ist: Parkinson ist behandelbar. Und: Parkinson ist kein Einzelschicksal – auch wenn es sich für viele Betroffene am Anfang so anfühlen mag. Unsere Botschaft lautet: Sie müssen diesen Weg nicht allein gehen, wir vom Klinikum Traunstein und die Beteiligten am Parkinson-Netzwerk Südostbayern bilden ein starkes Netz, das Sie auffängt.
Im Parkinson-Netzwerk Südostbayern engagieren sich niedergelassene und Klinik-Ärztinnen und -Ärzte aus der Neurologie, Allgemeinmedizin, Geriatrie oder Inneren Medizin – aber auch Reha-Einrichtungen, Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten, Apotheken, Sanitätshäuser und auch das Landratsamt.
Informationen zur Selbsthilfegruppe und allen Angeboten erhalten Betroffene im AWO Selbsthilfezentrum, Ansprechpartnerin Frau Brigitte Stief, Tel. 08684-9690089 E-Mail: .
Das Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe findet am Donnerstag, den 24.04.2025, um 18:00 Uhr im Landratsamt Traunstein statt.
10.04.2025 - Kliniken Südostbayern
Die Hygiene in den Kliniken Südostbayern ist ausgezeichnet
Aktion saubere Hände

Nach Bronze im vergangenen Jahr freuen sich die Kliniken Südostbayern nun über Silber. Die Kliniken beteiligten sich zum wiederholten Male an der bundesweiten „Aktion Saubere Hände“, initiiert von der Charité Berlin. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die auch belegt, wie sorgfältig bei uns mit dem wichtigen Thema Hygiene umgegangen wird“, so Priv.-Doz. Dr. Andrea Kropec-Hübner, die Leiterin der Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Das nach wie vor übergeordnete Ziel: Weiterhin das Bewusstsein für gezielte Händedesinfektion schärfen, um alle zu schützen. Für die Auszeichnung müssen Kliniken eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen, die vom bundesweiten Aktionsbündnis vorgegeben werden. mehr...
Selbst ausprobieren ist am 5. Mai möglich
Gerade mal 30 Sekunden dauert eine effektive Händedesinfektion. Das möchte das Hygiene-Team um Priv.-Doz. Dr. Hübner auch bei der diesjährigen Aktion zur guten Händedesinfektion allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch allen Patientinnen und Patienten und Gästen nahebringen. Dazu können alle wieder am Montag, 5. Mai 2025, von 10:00-14:00 Uhr im Eingangsbereich des Klinikums Traunstein selbst ausprobieren, wie gute Händehygiene geht. Die Fachleute zeigen dann, wo sich Bakterienreste am hartnäckigsten halten und wie man ihrer Herr wird.
In allen Standorten der Kliniken Südostbayern sind zahlreiche Spender installiert, damit auch die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit zur Händedesinfektion bekommen, wenn sie an den Desinfektionsspendern vorbeilaufen.
Hygiene wird geschult
„Um die Händedesinfektion täglich präsent zu halten, unternehmen wir an den Kliniken Südostbayern sehr viel“, betont Yvonne Mann, Leitende Hygienefachkraft der Kliniken. „Wir vom Infektionspräventionsteam führen in all unseren Häusern regelmäßige Fortbildungen zur Händedesinfektion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Dokumentation der korrekten Händedesinfektionen in allen patientennahen Bereichen durch. Die wichtigste Aufgabe ist und bleibt es, ein dauerhaftes Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Denn die Händehygiene dient sowohl dem Mitarbeiter- als auch dem Patientenschutz.“ Zur Qualitätssicherung wird der Verbrauch von Handdesinfektionsmittel pro Station, Abteilung und Einrichtung kontrolliert.
Priv.-Doz. Dr. Kropec-Hübner ergänzt: „Ein großes Lob möchte ich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen, die die Wichtigkeit der Händehygiene verinnerlicht haben. Sie werden mit dem Zertifikat für ihr tägliches und konsequentes Streben nach Hygiene im täglichen Berufsalltag ebenfalls belohnt."
07.04.2025 - Klinikum Traunstein
Schmerzen gehören halt dazu…
Zum Weltgesundheitstag am 7. April: Frauenleiden brauchen mehr Aufmerksamkeit

Während über Volkskrankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes, weltweit debattiert wird, bleiben viele Leiden, die ausschließlich Frauen betreffen, im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung. Besonders Endometriose ist ein Paradebeispiel dafür, wie weibliche Schmerzen in der Diskussion unterrepräsentiert sind. Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Traunstein und der Kreisklinik Bad Reichenhall fordert: „Mehr Aufmerksamkeit, mehr Empathie.“ mehr...
Endometriose ist eine Erkrankung, die jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter betrifft, und dennoch oft erst nach Jahren diagnostiziert wird. "Endometriose ist keine Randerscheinung – und trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung nahezu unsichtbar", sagt Prof. Dr. Schindlbeck. Für viele Frauen fühlt es sich nach wie vor an wie ein Privileg, das sie erst einfordern müssen. Die Krankheit ist chronisch: Dabei wächst Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter – etwa an Eierstöcken, Eileitern oder im Bauchraum. "Diese Herde reagieren auf den weiblichen Zyklus, können aber nicht abbluten. Das führt zu Zysten, Entzündungen und oft zu ausgeprägten Schmerzen", erklärt der erfahrene Gynäkologe.
Der Preis der Unsichtbarkeit
Viele Patientinnen erleben über Jahre diffuse Beschwerden: heftige Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Verdauungsprobleme, unerfüllter Kinderwunsch. Und immer wieder hören sie: Das ist eben so. „Es herrscht nach wie vor die Meinung, Periodenschmerzen seien einfach Teil des Frauseins", sagt Schindlbeck – und fügt hinzu: "Aber Schmerzen sind ein Warnsignal. Und niemand sollte lernen müssen, mit chronischem Schmerz zu leben." Die Folge: Viele Frauen erhalten erst nach sechs bis zehn Jahren eine Diagnose. Oft ist es der Wunsch nach einem Kind, der schließlich zur gynäkologischen Abklärung führt – und damit zur späten Erkenntnis.
"Wir sehen häufig Frauen, die eine jahrelange Leidensgeschichte mitbringen, bevor überhaupt der Verdacht auf Endometriose geäußert wird", berichtet Schindlbeck. Erst die gynäkologische Diagnostik bringt oft den Grund der Beschwerden ans Licht: Neben Ultraschalluntersuchungen oder einem MRT des Beckens wird dann meist eine Bauchspiegelung durchgeführt. An der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern führt sein Team solche Eingriffe 10 bis 15 Mal pro Woche durch. Doch bis es überhaupt so weit kommt, vergeht oft wertvolle Zeit – Zeit, in der die Erkrankung voranschreitet, zu Verwachsungen führen oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann.
Ein Symptom für ein strukturelles Versäumnis
Dass Endometriose so lange unerkannt bleibt, ist kein Zufall – sondern Symptom eines größeren Problems. Zwar gibt es Fortschritte: Hormone, Schmerzmittel, pflanzliche Präparate. Seit Oktober 2024 ist sogar ein neues Medikament zugelassen, das den Hormonhaushalt der Frau gezielt beeinflusst und damit das Wachstum der Endometrioseherde hemmt. "Dieses Mittel wirkt ähnlich wie die hormonelle Umstellung nach den Wechseljahren – allerdings ist es bislang nur für Patientinnen zugelassen, bei denen alle anderen Therapien versagt haben." erklärt Prof. Dr. Schindlbeck. Auch im Bereich Kinderwunsch macht er Hoffnung: "Selbst bei verschlossenen Eileitern lässt sich durch künstliche Befruchtung eine Schwangerschaft mit vergleichbaren Erfolgsraten erzielen wie bei Frauen ohne Endometriose."
Der Weltgesundheitstag als Weckruf
Trotzdem bleibt der grundlegende Missstand bestehen: Frauen erleben ihren Schmerz oft als individuelles Problem – dabei hat er gesellschaftliche Relevanz. Was ihnen fehlt, ist keine Belastbarkeit, sondern Sichtbarkeit. "Das Bild der Frau, die ihre Beschwerden, von Regelschmerzen bis zur Geburt, tapfer erträgt, ist medizinisch wie gesellschaftlich völlig überholt", so Schindlbeck. Doch nach wie vor werden chronische Schmerzen zu spät erkannt, Therapien zu spät begonnen, Lebensqualität zu spät verbessert. Im Jahr 2025 sollte klar sein: es ist höchste Zeit, das zu ändern.
"Mein Appell an alle Frauen: Gehen Sie regelmäßig zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Sprechen Sie Ihre Beschwerden offen an. Es ist Ihr Körper. Es ist Ihr Leben."
04.04.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Wenn der Bauch Alarm schlägt
KSOB-Expertenvortrag über Darmpolypen, Magengeschwüre und Vorsorge

Bauchbeschwerden gehören zu den häufigsten Gründen, weshalb Menschen einen Arzt aufsuchen. Nicht immer steckt etwas Harmloses dahinter - manche Erkrankungen entwickeln sich schleichend und bleiben lange unbemerkt. Hier setzt die Vorsorgeendoskopie an: Sie ermöglicht es, Veränderungen in Magen und Darm frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Im Gespräch mit PD Dr. Andrej Wagner, Chefarzt für Innere Medizin – Gastroenterologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall. mehr...
Ein Grund dafür, dass Darmpolypen lange unentdeckt bleiben können, ist, dass Patienten keine oder nur unspezifische Beschwerden haben. Sogar Magengeschwüre verursachen nicht immer typische Beschwerden. „Es gibt manchmal eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir bei der Endoskopie sehen - nämlich eine ernsthafte Erkrankung - und dem, was die Patienten spüren“, berichtet Dr. Wagner. Daher ist es wichtig zu wissen, in welchen Fällen eine Untersuchung notwendig sein kann.
Ein Magengeschwür entsteht, wenn die schützende Schleimhaut des Magens so stark entzündet ist, dass die darunterliegenden Magenwandschichten angegriffen werden. Typische Beschwerden sind bohrende Schmerzen im linksseitigen Oberbauch. „Im schlimmsten Fall entsteht ein Defekt bis hin zu einem Loch in der Magenwand“, so der Mediziner. Verursacher ist oft der Magenkeim Helicobacter pylori, der bei etwa einem Viertel der deutschen Bevölkerung nachweisbar ist. „Aber nicht jeder, der den Keim trägt, wird auch krank. Nur etwa 10 Prozent entwickeln tatsächlich ein Magengeschwür.“ Dass übermäßiger Kaffeekonsum zu Magengeschwüren führe, kann Dr. Wagner nur bedingt zustimmen. „Was aber wirklich schädigt, sind Alkohol und Rauchen. Diese Faktoren erhöhen das Risiko deutlich - genauso wie zunehmendes Alter und Einnahme bestimmter Schmerzmittel.“
Noch unscheinbarer verhalten sich Darmpolypen. Diese Schleimhautvorwölbungen im Dickdarm sind in den meisten Fällen harmlos, können sich jedoch zu bösartigen Tumoren entwickeln. „Darmkrebs macht erst Beschwerden, wenn er weit fortgeschritten ist“, warnt Dr. Wagner. Hier zeigt sich die große Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung.
Früherkennung kann Leben retten
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Viele Krebserkrankungen des Verdauungstrakts könnten verhindert werden, wenn regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen konsequenter wahrgenommen würden. Ab dem 50. Lebensjahr übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine Vorsorge-Darmspiegelung. Die Magenspiegelung gehört in Deutschland zwar nicht zu den regulären Vorsorgeuntersuchungen, wird aber empfohlen, wenn familiäre Vorbelastungen oder bestimmte Beschwerden vorliegen. „Blut im Stuhl, ungewollter Gewichtsverlust oder Schmerzen im Oberbauch, die sich nicht bessern – das sind Alarmsignale, die unbedingt abgeklärt werden sollten“, betont Dr. Wagner.
Trotzdem zögern viele Menschen, sich einer Endoskopie zu unterziehen. Ein gängiges Missverständnis besteht darin, dass ein gesunder Lebensstil allein vor schwerwiegenden Erkrankungen schützt. „Es gibt Menschen, die ihr Leben lang gesund gegessen, nie geraucht und keinen Alkohol getrunken haben und sportlich waren – und dennoch an Darmkrebs erkranken“, berichtet Dr. Wagner. Der Grund: Ohne Vorsorgeuntersuchung bleiben viele Veränderungen unentdeckt, bis es zu spät ist. Die Angst vor Unannehmlichkeiten oder Schmerzen bei der Untersuchung kann der Mediziner nehmen: „Dank moderner Sedierung verschlafen die meisten Patienten alles. Viele wachen auf und fragen, wann es endlich losgeht – dabei ist es längst vorbei.“
Die enge Zusammenarbeit der Fachdisziplinen
Dank moderner Technik ist die Gastroenterologie heute in der Lage, Veränderungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu klassifizieren. „Mit unseren Geräten können wir mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit bereits durch bloßes Hinschauen beurteilen, ob es sich um eine harmlose Veränderung oder ein ernstzunehmendes Geschwür handelt“, erklärt Dr. Wagner. In Zweifelsfällen werden Gewebeproben entnommen und weiter untersucht. Was passiert bei auffälligen Befunden? Hier kommt die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen ins Spiel. „In der Kreisklinik Bad Reichenhall arbeiten Gastroenterologen, Chirurgen, und Radiologen Hand in Hand“, erklärt Dr. Wagner. Dieses interdisziplinäre Konzept ermöglicht es, für jeden Patienten eine individuell abgestimmte Behandlung zu finden. Besonders bei fortgeschrittenen Erkrankungen oder komplizierten Befunden ist die Zusammenarbeit zwischen Innerer Medizin und Chirurgie essenziell. „Wenn wir endoskopisch Veränderungen entdecken, die nicht mehr endoskopisch entfernt werden können, ziehen wir direkt unsere chirurgischen Kollegen hinzu“, berichtet Dr. Wagner. Bei onkologischen Erkrankungen besteht direkte Kooperation mit dem Darmzentrum am Klinikum Traunstein.
24.03.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Wenn nicht erholsam Schlafen krank macht
Hilfe für Betroffene aus dem erneut zertifizierten Schlaflabor in Bad Reichenhall

Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, ohne es zu wissen. Sie fühlen sich tagsüber erschöpft, haben Konzentrationsprobleme oder sind gereizt – oft über Jahre hinweg. „Gestörter Schlaf bleibt häufig lange unentdeckt, kann aber ernste Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit haben“, erklärt Dr. Michaela Ritz, Oberärztin Pneumologie und Beatmungsmedizin und Leiterin des Schlaflabors an der Kreisklinik Bad Reichenhall. mehr...
Nächtliche Unruhe, Tagesmüdigkeit – auf diese Symptome sollten Sie achten
Nicht jeder, der schlecht schläft, benötigt eine Untersuchung, doch bestimmte Symptome sollten ernst genommen werden. Dazu gehören:
- Tagesmüdigkeit, trotz ausreichender Nachtruhe
- Atemaussetzer oder schwere Atmung im Schlaf
- Unruhige Beine (Restless-Legs-Syndrom)
- Schlaflosigkeit ohne erkennbare Ursache
- Schlafwandeln oder andere nächtliche Auffälligkeiten
- Plötzliche Einschlafattacken (Verdacht auf Narkolepsie)
„Unser Schlaflabor ist auf die Diagnose und Behandlung dieser Probleme spezialisiert“, so Dr. Ritz. „Wir können Betroffene dabei unterstützen, ihre Schlafqualität wiederherzustellen und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.“
Modernste Diagnostik im zertifizierten Schlaflabor
Das Schlaflabor in der Kreisklinik Bad Reichenhall ist erneut von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) bis Ende 2026 zertifiziert worden. Diese Zertifizierung beinhaltet auch, dass die Experten vor Ort modernste Technologien nutzen, um Schlafstörungen umfassend zu untersuchen. „Wir können nicht nur Atemprobleme im Schlaf messen, sondern auch Bewegungen, Gehirnströme und andere Parameter erfassen“, erläutert Dr. Ritz. Auch Patienten mit Schlafapnoe, also Atemaussetzern in der Nacht, erhalten hier im Schlaflabor eine präzise Einstellung ihrer CPAP- oder BiPAP-Geräte, die für eine gesunde Atmung im Schlaf sorgen.
Besser schlafen – besser leben
Die Ursachen von Schlafstörungen können vielfältig sein – von internistischen Erkrankungen über neurologische Probleme bis hin zu psychischen Belastungen. Deshalb arbeitet das Schlaflabor eng mit den Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammen, darunter Neurologie, Psychiatrie, HNO-Heilkunde oder der Zahnmedizin. „Weil wir unser gesamtes medizinisches Netzwerk in den Kliniken Südostbayern nutzen, können wir die bestmögliche Therapie für unsere Patienten finden“, betont Dr. Ritz.
18.03.2025 - Kreisklinik Trostberg
Aus dem Schmerz zurück ins Leben
Neuer Lebensmut nach Hilfe in der Multimodalen Schmerztherapie der Kreisklinik Trostberg

Früher war Helmut D. sehr sportlich – er hielt viel auf seine Fitness, schon in seiner Heimat in NRW. Aber im Alter von 15 Jahren fangen ständiges Nasenbluten, Schmerzen im Rücken und in der Schulter an – ohne Grund. Ab 1974 nimmt er Schmerzmittel. Immer mehr, immer höher dosiert, immer stärkere und rezeptpflichtige Medikamente. Einblutungen in Gelenken und Muskulatur, verursacht durch eine ererbte Hämophilie A, haben in fast allen Gelenken Arthrose zur Folge. mehr...
Die Schmerzen erträglicher machen über eine Dauer von 15 Jahren teilweise mehrere gleichzeitig applizierte Pflaster mit dem Wirkstoff Fentanyl 75 µg/h, ein Mittel mit einer 100-mal stärkeren Wirkung als Morphium.
Eigener Entzug endet in Suizidversuchen
Es ist nicht so, dass der 68-jährige sich früher nicht schon selbst auf Entzug gesetzt hätte – mit allen schlimmen Begleiterscheinungen: Er ist unruhig, die Knochen jucken im Körper, ihm ist immer übel bis hin zu stundenlangem Erbrechen. Und so beginnt Helmut D., sich selbst zu verletzen: „Ich habe mir immer wieder selbst Schmerzen zugefügt, um die Entzugserscheinungen auszuhalten. Der Entzug endete dann in Suizidversuchen, ich wurde dreimal von meiner Frau und meinem Sohn gerettet – von den Schmerzmitteln bin ich nicht runtergekommen.“ Auf richterlichen Beschluss wird Helmut D. in die geschlossene Abteilung eines Bezirksklinikums eingewiesen. Der einzige Halt sind seine Frau und sein Sohn. Mit 55 Jahren wird er frühverrentet, weil die Schmerzen seinen Tagesablauf bestimmen und ihm keiner helfen kann. Er erinnert sich: „Ich musste täglich 40 km zur Arbeit fahren und wusste nicht mehr, wie ich hingekommen war, weil ich Schmerzmittel wie Erdnüsse gegessen habe. Nach zwei Unfällen habe ich dann die Reißleine gezogen. Ich fahre seit Jahren nicht mehr selbst.“
Im Klinikum hört er von der Schmerztherapie in Trostberg
2019 ziehen die Eheleute D. in die Nähe von Ruhpolding, weil ihr Sohn dort aus beruflichen Gründen wohnt. Als Helmut D. an Pfingsten 2024 sich bei einem Sturz an der Wirbelsäule verletzt, wird er akut in das Klinikum Traunstein eingeliefert. Während seines Aufenthalts hört D. von Richard Strauss, dem Leitenden Arzt der Schmerztherapie der Kreisklinik Trostberg.
Wieder zuhause, nimmt Helmut D. Kontakt auf zu Richard Strauss. Der erfahrene Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, ist Experte für interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie und sorgt dafür, dass Helmut D. nach Trostberg kommt. Zu diesem Zeitpunkt nimmt D. noch immer Fentanyl 75 µg/h im Wechsel alle 3 Tage – und will endlich raus aus dem ewigen Kreislauf.
Völlig neue Perspektiven
In Trostberg macht D. im November 2024 neue Erfahrungen. Er weiß noch: „Ich wurde so gut aufgenommen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich von Anfang an super um mich gekümmert.“ Er ist in einer Gruppe zusammen mit sieben anderen Personen. Sie machen spezielle physiotherapeutische Übungen und haben psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche. Helmut D. hat die Gemeinschaft mit anderen gefallen: „Psychisch hat es mir sehr gutgetan, mich mit anderen Leuten auszutauschen, die ähnliche Probleme haben.“
Richard Strauss erinnert sich, wie sich der Gesundheitszustand von Helmut D. entwickelt: „Der gemeinsam formulierte Behandlungsauftrag und das Behandlungsziel des Patienten war die Opioid-Reduktion. Anfänglich zeigten sich definitiv die zu erwartenden Symptome, wie erhebliche innere Unruhe, starkes Schwitzen, Zunahme der Schlafstörungen, erhöhte Anspannung mit anfänglicher Schmerzverstärkung. Auch war Angst und Unsicherheit bei Helmut D. zu verspüren. Wir haben daher entzugslindernde Bedarfsmedikation kombiniert mit vorbeugender psychisch stabilisierender Medikation. Besonders durch multimodale, interdisziplinäre Behandlungen mit geschultem Fachpersonal und Painnurses konnte die Fentanyl-Wirkstoff-Dosierung schrittweise im Laufe des 16-tägigen Aufenthalts reduziert werden. Überraschend war, dass sich die befürchtete starke Schmerzzunahme im Verlauf nicht bestätigte, im Gegenteil. Eine gänzliche Reduktion war während seines Aufenthaltes nicht möglich. Die Entlassung erfolgte mit 25 µg/h Fentanyl-Wirkstoff.“ Herr D. erhält die Aufgabe, die Medikation zuhause unter ärztlicher Kontrolle abzusetzen. Über die Praxis für Schmerztherapie des Fachärztezentrums am Standort Trostberg kann Strauss Helmut D. weiterbehandeln.
Auch die Ehefrau von D. ist begeistert, um wie viel besser es ihrem Mann in der Schmerztherapie geht: „Mein Mann hatte sofort Vertrauen zu Herrn Strauss, da hat die Chemie zwischen den Beiden gestimmt. Und die Gemeinschaft mit den anderen Patienten und der multimodale Behandlungsansatz hat ihm geholfen.“ Für Helmut D. selbst ist die Reduktion von 75 µg auf nur noch 25 µg Fentanyl pro Tag ein durchschlagender Erfolg: „Dass ich mich bei Herrn Strauss wahrgenommen gefühlt habe, dass er meine Schmerzen ernst genommen hat – das alles hat mir die Stärke gegeben, die Dosis in so kurzer Zeit so stark zu verringern.“ Mitte November wird er entlassen.
Die Betreuung wird weitergeführt
Nach dem Klinikaufenthalt muss Helmut D. zuhause wieder allein klarkommen. Er versucht, täglich zumindest ein paar Schritte zu gehen und die erlernten Übungen zu absolvieren, um in Bewegung zu bleiben.
Umso wichtiger ist für ihn, dass er weiter durch Richard Strauss von der Kreisklinik Trostberg betreut wird. Er kommt mindestens alle drei Monate zu ihm in die Schmerzpraxis. Zusätzlich wird er dort zur Aufrechterhaltung des Problembewusstseins weiter ambulant therapeutisch betreut durch den Leitenden Arzt Marc-Oliver Stückrath und die Oberärztin Madelien Hell.
D. versucht die Schmerzmittel weiter zu reduzieren
Helmut D.s neuester Erfolg: Seit Anfang Februar 2025 ist er auf null Fentanyl, denn er macht nach der Therapie selbstständig, wenn auch unter Schwierigkeiten, weiter mit dem Abbau der Schmerzmittel, das berichtet er an Richard Strauss. Der ist begeistert und schreibt ihm: „Klasse! Ich bin stolz auf Sie!“ Helmut D. fühlt sich bestärkt: „Seit meinem Aufenthalt in Trostberg bin ich wieder zuversichtlicher. Ich bin so froh, einen Arzt gefunden zu haben, dem Menschlichkeit allen Patienten gegenüber wichtig ist und sich Zeit nimmt. Und dass ich jetzt nur noch bei akutem Bedarf Schmerzmittel benötige. Ich bleibe jedenfalls dran, weil ich mit Herrn Strauss weiterarbeiten möchte, denn er hat mir den Mut wieder gegeben, mich nicht aufzugeben. Das ist für Menschen wie mich, mit einer langen Schmerzgeschichte, Gold wert. Die Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg und Herr Strauss mit seinem Team haben mein Leben wieder etwas lebenswerter gemacht, das möchte ich allen Betroffenen mitteilen.“
13.03.2025
Auszeichnung für die individuelle Versorgung von Kindern mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) am Klinikum Traunstein erhält Zertifizierung

Das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) am Klinikum Traunstein hat das bundesweite Qualitätssiegel „Wegweisend für die Entwicklung von Kindern“ erhalten. Diese Zertifizierung der Dt. Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin bestätigt die hohe fachliche Qualität und interdisziplinäre Arbeit des SPZ-Teams und gilt als bedeutende Anerkennung für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexen Entwicklungs- und Gesundheitsproblemen. mehr...
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Dr. Anette Hasse-Wittmer, Leiterin des SPZ. „sie bestätigt, dass wir den Kindern und ihren Familien eine Versorgung auf höchstem Niveau bieten – individuell, umfassend und nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Wir sind erst das dritte von insgesamt 22 SPZs in Bayern, das diese Auszeichnung erhält, “ Das Qualitätssiegel ist zwei Jahre gültig und unterstreicht die hohe fachliche Kompetenz des SPZ-Teams.
Hohe Anforderungen besonders an das Team
Das Qualitätssiegel basiert auf den strukturellen Anforderungen, die in den Grundlagenpapieren der Bundesarbeitsgemeinschaft und der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin festgelegt wurden. Ein zentrales Kriterium ist die personelle Ausstattung: „Ein zertifiziertes SPZ muss über ein großes multiprofessionelles Team verfügen, denn charakteristisch für unser Vorgehen ist die fachübergreifende Arbeitsweise auf medizinischem, psychologischem und therapeutischem Gebiet, die für jedes Kind einen ganzheitlichen, interdisziplinären Blick auf seine Entwicklung ermöglicht“, erklärt Dr. Hasse-Wittmer.
Komplexe Krankheitsbilder erfordern ein vernetztes Vorgehen
Das SPZ Traunstein betreut Kinder und Jugendliche ab der Geburt bis zum 18. Lebensjahr, die unter frühkindlichen Entwicklungsstörungen, Erkrankungen, wie Epilepsie, chronischen (Kopf-) Schmerzen inklusive Long-COVID, Adipositas oder Diabetes, sowie sozio-emotionalen Problemen und Schulschwierigkeiten leiden.
Ein besonderes Merkmal der Arbeit ist der bio-psycho-soziale Ansatz. Dabei wird in Diagnostik und Therapie, neben den medizinischen Faktoren einer Erkrankung, ein besonderes Augenmerk auf familiäre und soziale Einflüsse gelegt, welche die Entwicklung des Kindes mit beeinflussen. „Unser Ziel ist es, die Familien zu unterstützen und für deren Kinder stets die bestmögliche Entwicklung und maximale Teilhabe in der Gruppe der Gleichaltrigen sowie in unserer Gesellschaft zu erreichen“, betont Dr. Hasse-Wittmer.
12.03.2025 - Kliniken Südostbayern
Pflege im Nationalsozialismus
Kooperation zwischen Dokumentation Obersalzberg und Kliniken Südostbayern AG

Der neu konzipierte Workshop „Zwischen Hilfe und Mord. Medizin und Pflege im Nationalsozialismus“ der Dokumentation Obersalzberg wird fester Bestandteil der Pflegeausbildung der Kliniken Südostbayern AG. mehr...
Die neu gestartete Kooperation zwischen der Dokumentation Obersalzberg und den Kliniken Südostbayern AG setzt ein starkes Zeichen für politische Bildung: Ab sofort ist im Curriculum der Pflegeausbildung an den Kliniken Südostbayern AG ein Workshoptag in der Dokumentation Obersalzberg fest verankert. Jeder Jahrgang soll sich künftig einmal während der Ausbildung intensiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Rolle der Pflege während dieser Zeit befassen.
„Wir freuen uns, dass wir künftig allen Ausbildungsklassen einen solchen Workshop ermöglichen können“ sagt Steffen Köhler Geschäftsbereichsleiter Personal und Bildung der Kliniken Südostbayern AG. „‘Geschichte verstehen, Demokratie stärken, Zukunft gestalten‘ – mit diesem Leitgedanken freuen wir uns auf die intensive Zusammenarbeit mit der Dokumentation Obersalzberg.“ Dr. Sven Keller, Fachlicher Leiter der Dokumentation, betont: „Die Medizinverbrechen der Nationalsozialisten zeigen, wohin die Unmenschlichkeit einer völkisch-biologistischen Ideologie führt. Die Geschichte berührt viele ethische Fragen, die sich auch der Medizin und der Krankenpflege der Gegenwart stellen. Ein Ort wie der Obersalzberg eignet sich besonders gut, sie mit Pflegeschülerinnen und -schülern zu diskutieren.“
Im neu konzipierten Workshop der Dokumentation Obersalzberg „Zwischen Hilfe und Mord: Medizin und Pflege im Nationalsozialismus“ setzen sich die Auszubildenden mit Antisemitismus, Rassismus, Menschenversuchen und dem Massenmord an Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen auseinander. Der aktuelle Bezug spielt dabei eine tragende Rolle; so werden Tendenzen, wie moderne „Eugenik“ oder die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen thematisiert.
Während der NS-Zeit waren die Pflege und die Medizin tief in die Verbrechen des Regimes verwickelt. Im Jahr 1939 beauftragte Hitler enge Vertraute, das sogenannte „Euthanasieprogramm“ zu planen; am Obersalzberg diskutierten sie wochenlang über diese Frage. Das Programm war der erste staatlich organisierte Massenmord der Nationalsozialisten, bei dem rund 300.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen getötet wurden.
Bereits die ersten zwei Pilot-Workshops im November und Dezember 2024 hinterließen einen bleibenden Eindruck bei den Auszubildenen. Die Klassen der Berufsfachschulen für Pflege beschäftigten sich nicht nur mit Inhalten der Dauerausstellung „Idyll und Verbrechen“ der Dokumentation Obersalzberg. Ebenfalls im Fokus des Bildungsformats stand die Reflexion der jungen Erwachsenen über die Verbreitung rechtsextremer Ideologien in der digitalen Welt. Die Stärkung demokratischer Werte sowie der Einsatz für Respekt, Vielfalt und Solidarität – gerade in der Pflege, wo der Umgang mit Menschen im Mittelpunkt steht – sind Schwerpunkte des neuen Bildungsformats.
Weitere Informationen zum Bildungsprogramm der Dokumentation Obersalzberg finden sich unter www.obersalzberg.de
Informationen zum Ausbildungsprogramm der Kliniken Südostbayern AG finden sich unter hier.
12.03.2025 - Klinikum Traunstein
Sind Ihre Nieren ok?
Motto des Welt-Nieren-Tages am 13. März 2025

Am 13. März 2025 steht der Welt-Nieren-Tag unter dem Motto „Sind Ihre Nieren ok?“. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Früherkennung chronischer Nierenerkrankungen (CKD) zu schärfen und präventive Maßnahmen zu fördern. Chronische Nierenerkrankungen bleiben oft lange unentdeckt, da Symptome erst in fortgeschrittenen Stadien auftreten. Dabei könnten frühzeitige Diagnosen das Fortschreiten der Erkrankung erheblich verlangsamen. Der Welt-Nieren-Tag 2025 ruft dazu auf, die „stillen Schaffer“ unseres Körpers nicht zu übersehen. Mit frühzeitiger Diagnose und Prävention können schwere Folgen wie Dialyse oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindert werden. mehr...
Die Rolle der hausärztlichen Betreuung
Hausärzte spielen eine Schlüsselrolle bei der Früherkennung von CKD. Die aktualisierte S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) sowie die Dt. Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) empfehlen regelmäßige Blut- und Urintests bei Risikogruppen, wie Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck oder familiärer Vorbelastung. Tests wie die Bestimmung des Kreatininwerts im Blut, des Albumins und Kreatinins im Urin sowie die Kontrolle des Blutdrucks liefern entscheidende Hinweise. „Die Früherkennung chronischer Nierenerkrankungen liegt uns Hausärztinnen und Hausärzten sehr am Herzen, damit wir dazu beitragen, dass Nierenkranke nicht zur Dialyse müssen“, so Eva Greipel, Vorsitzende des Traunsteiner Hausärztevereins.
Wann zum Nephrologen, dem Experten für Nierenerkrankungen?
Patienten sollten in eine spezialisierte nephrologische Sprechstunde überwiesen werden, wenn:
- Der Kreatininwert stark erhöht ist.
- Eine dauerhaft bestehende Proteinurie (Eiweiß im Urin) oder zu viel Albumin im Urin festgestellt werden.
- Spätestens wenn die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) unter 30 ml/min sinkt.
- Wenn der Blutdruck trotz aller Versuche nicht in den Zielbereich gesenkt werden kann. Dieser Zielbereich liegt in einem Korridor von 120-140 mmHg systolisch, wird aber individuell vom Spezialisten festgelegt.
- Wenn man nur eine Niere hat.
- Wenn wegen einer Harnabflussstörung eine urologische Betreuung erfolgt, sollte auch eine nephrologische Mitbetreuung erwogen werden.
- Komplexe Ursachen oder fortgeschrittene Stadien vorliegen.
Wenn in der Familie jemand nierenkrank oder gar dialysepflichtig ist, wird empfohlen, in der hausärztlichen Praxis Screening-Tests auf Nierenerkrankungen, wie Urinuntersuchung, Blutdruckmessung und Nierenultraschall durchführen zu lassen.
Vorsorge und Eigenverantwortung
„Eine Teilnahme der Bevölkerung an den Früherkennungsprogrammen in der hausärztlichen Praxis ist sehr wichtig, damit wir als Nephrologen in Zusammenarbeit mit Hausärzten und anderen Fachärzten rechtzeitig helfen können, Dialyse zu vermeiden“, so Prof. Dr. Carsten Böger, Chefarzt der Nephrologie am Klinikum Traunstein und Ärztlicher Leiter am KfH Nierenzentrum Traunstein.
Er ruft die Bevölkerung dazu auf, aktiv selbst zur Früherkennung beizutragen:
- Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wie den „Check-up 35“ in der hausärztlichen Praxis wahrnehmen.
- Auf Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht achten.
- Einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und Bewegung pflegen.
- Nierenschädigende Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclofenac oder Etoricoxib nur für kurze Dauer einnehmen
Hilfreich sind auch die Online-Risikorechner für Nierenversagen der DGfN sowie der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie (ISN)
Wie sieht die Versorgung für Nierenkranke in unserer Region aus?
In unserer Region wird die sektorübergreifende, also ambulante und stationäre Betreuung von Patienten mit Nierenerkrankungen auf hohem Niveau gelebt. So besteht eine vertrauensvolle Kooperation zwischen hausärztlichen Praxen in Stadt und Landkreis Traunstein und der Nierensprechstunde am KfH Nierenzentrum Traunstein. In dieser mit zahlreichen Nephrologinnen und Nephrologen besetzten Sprechstunde wird alles dafür getan, Dialyse zu vermeiden. „Wir nennen das die „Dialysevermeidungssprechstunde“, in der wir bei vielen Patienten schon die Dialyse abgewendet oder sehr lange verzögert haben“, so Prof. Dr. Böger. Ähnlich ist die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten in den Nachbarlandkreisen mit den dortigen Sprechstunden der nephrologischen Praxen.
Sollte eine stationäre Betreuung nötig werden, steht am Klinikum Traunstein die von der DGfN zertifizierte Nephrologische Schwerpunktklinik rund um die Uhr zur Verfügung, so dass die nahtlose Betreuung vor Ort möglich ist. Sie ist im Südostbayerischen Raum östlich von München die einzige Nierenklinik mit diesem hohen Qualitätsmaß und bietet das gesamte Spektrum nephrologischer Leistungen. Hier werden auf universitärem Niveau nephrologische Spezialleistungen erbracht, so dass Patienten in den südostbayerischen Landkreisen vor Ort bestens versorgt sind.
„Dialysevermeidung ist immer Teamwork. Hierbei arbeiten nicht nur Hausärzte und Nephrologen eng zusammen, sondern auch Diabetologen, Kardiologen und Urologen, die allesamt sehr gut in unserer Region vertreten sind“, so Eva Greipel und Prof. Dr. Carsten Böger.
07.03.2025 - Klinikum Traunstein
Vorsorge rettet Leben – auch das der Liebsten
Zum Darmkrebsmonat März: Die Geschichte des Ehepaars Marquardt über die Bedeutung von Darmkrebsfrüherkennung
Was wie eine Routinevorsorge begann, wird für das Ehepaar Marquardt zu einer lebensverändernden Erfahrung – und zu einem nachdrücklichen Appell für die Darmkrebsvorsorge. Alles beginnt mit Frau Marquardts Entscheidung, das Angebot zur Darmkrebsvorsorge ab 50 Jahren in ihrer hausärztlichen Praxis wahrzunehmen: Ein einfacher Stuhltest auf verborgenes Blut fällt auffällig aus – ein Alarmsignal, das dazu führt, dass sie zeitnah ins Klinikum Traunstein zur Darmspiegelung kommt. mehr...
Davor werden in einem Aufklärungsgespräch alle notwendigen Punkte besprochen. Auch mögliche Risiken, wie Vorerkrankungen oder die Einnahme von Medikamenten zur Blutverdünnung werden geprüft. "Die Abführmaßnahmen vorher waren das Unangenehmste an der ganzen Sache", erinnert sie sich, „Die eigentliche Untersuchung kriegt man ja durch die Schlafmittel gar nicht mit.“ Mehrere gutartige Polypen werden bei ihr entfernt, und der ärztliche Rat lautet: In drei Jahren zur Kontrolle wiederkommen.
Irrtum und bittere Wahrheit
Ihr Ehemann begleitet sie zum Aufklärungsgespräch. Auch er hat immer wieder Blut im Stuhl, schiebt dies aber auf Hämorrhoiden. Eine Koloskopie? „Ich habe keine Beschwerden, und Krebs gibt es in unserer Familie nicht“, meint er. Doch auf Anraten seiner Frau willigt er ein, ebenfalls eine Darmspiegelung machen zu lassen.
Was dann folgt, ist ein Schock: "Es war tatsächlich Darmkrebs", so Volker Marquardt. Der Hausarzt leitet sofort alle weiteren Maßnahmen ein und im Klinikum Traunstein werden eingehende Untersuchungen – Computertomografie, Kernspintomografie und Endosonografie – durchgeführt. Die bringen eine vergleichsweise gute Nachricht: Der Tumor ist auf die Schleimhaut des Enddarms begrenzt, das umgebende Gewebe, Lymphknoten oder andere Organe sind nicht betroffen. "Glück im Unglück", fasst Marquardt zusammen. „Gerade noch rechtzeitig erwischt.“
Kooperation und High-Tech
Im Klinikum Traunstein wird sein Fall in der interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt, in der wöchentlich alle Fälle besprochen werden: Radiologen, Onkologen, Chirurgen und weitere Fachleute besprechen seinen Fall. Der Konsens der Expertinnen und Experten lautet: Eine direkte Operation ohne vorherige Chemo- oder Strahlentherapie sei die beste Wahl. "So viel wie nötig, so wenig wie möglich, das ist der Grundsatz jeder Behandlung." betont Dr. Björn Lewerenz, Chefarzt Innere Medizin/Gastroenterologie am Klinikum Traunstein.
Die Operation selbst wird kurze Zeit danach robotisch assistiert mit dem DaVinci-System durchgeführt. Der Leitende Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. André Prock erläutert: „Gerade beim männlichen Becken zeigt sich durch die Hilfe des Roboters eine deutliche Erleichterung für nervenschonende und trotzdem ausgedehnte Operationen zur Erzielung eines möglichst weitgehenden Heilerfolgs bei Patienten mit Enddarmkrebs.“ Nur vorübergehend erhält Volker Marquardt einen künstlichen Darmausgang, damit die Darmenden des Dickdarms in Ruhe ohne die Belastung durch Stuhl heilen können. "Die Anleitung zur Stoma-Versorgung war sehr hilfreich", berichtet Marquardt. Auch wird für ihn der Kontakt zum Sozialdienst hergestellt, da aufgrund der Tumorerkrankung zum Beispiel ein Antrag auf Schwerbehinderung gestellt werden kann. Nach etwas mehr als einer Woche ist er wieder auf den Beinen und kann die Klinik verlassen.
Alles fast wie vorher
Drei Monate später folgt die zweite Operation: Der Darmausgang wird erfolgreich zurückverlegt und der natürliche Darmausgang ist wiederhergestellt. "Alles fast wie vorher", freut sich Volker Marquardt. Nun geht er regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen, um Rückfälle frühzeitig zu erkennen. In seinem Tumor-Nachsorgekalender werden die anstehenden Untersuchungen in den nächsten fünf Jahren dokumentiert.
Appell für die Darmkrebsvorsorge
Heute weiß Volker Marquardt: "Ohne meine Frau wäre der Krebs wohl zu spät entdeckt worden, das kann man wirklich verhindern." Ein Appell, den auch Chefarzt Dr. Björn Lewerenz teilt: "Darmkrebs ist heilbar – wenn er früh erkannt wird. Nutzen Sie die Vorsorgeangebote. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen." Das Ehepaar Marquardt steht mit seiner Geschichte für eine wichtige Botschaft: Vorsorge rettet Leben – und manchmal auch das der Liebsten.
Darmkrebsvorsorge: Gesetzliche Regelungen angepasst
Anfang 2025 wurden die gesetzlichen Regelungen zur Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer vereinheitlicht: Alle ab 50 Jahren können im Abstand von 10 Jahren zweimal eine Darmspiegelung durchführen lassen. Alternativ zur Darmspiegelung können Frauen und Männer ab 50 Jahren alle zwei Jahre einen Stuhltest machen, um verborgenes Blut zu entdecken.
Darmkrebszentrum am Klinikum Traunstein
Das Klinikum Traunstein wurde 2007 von der Deutschen Krebsgesellschaft zum Darmkrebszentrum zertifiziert und ist seither eines der aktuell ca. 40 zertifizierten Darmkrebszentren Bayerns (ca. 310 in ganz Deutschland). 2021 wurde Traunstein auch als Pankreaskrebszentrum zertifiziert und darf sich seither „Viszeralonkologisches Zentrum“ nennen. Jährlich wird das Zentrum rezertifiziert und muss einen umfassenden Anforderungskatalog erfüllen (Mindestfallzahlen, Erfahrung der Operateure u.v.m.). Auch 2025 steht die jährliche Re-Zertifizierung an, mit im Jahr 2024 etwa 150 durchgeführten Darmkrebsoperationen werden die Mindestanforderungen dafür weit übertroffen (Mindestanforderungen: 20 Operationen am Enddarm, 30 am Dickdarm). Seit 2023 werden viele Darmoperationen robotisch assistiert mit dem DaVinci OP-Roboter durchgeführt. Im angegliederten Studienzentrum wird regelhaft geprüft, in welche aktuellen klinischen Studien geeignete Patienten eingeschlossen werden können, um die individuelle Prognose ggf. noch weiter zu verbessern und die Darmkrebstherapie insgesamt weiterzuentwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Facharztpraxen der Region und den Kooperationspartnern des Zentrums wird eine reibungslose Weiterbehandlung der Patienten gewährleistet. In Planung ist in Traunstein auch die Bildung eines ASV-Teams (ambulante spezialfachärztliche Versorgung), wodurch die ambulante Versorgung der Darmkrebspatienten am Klinikum noch weiter verbessert werden wird.
Geleitet wird das Viszeralonkologische Zentrum von Dr. Björn Lewerenz, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin/Gastroenterologie. Stellvertretender Leiter des Zentrums ist seit Juni 2024 Prof. Dr. Christian Jurowich, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Dr. Birgit Reinisch aus der chirurgischen Abteilung und Dr. Helen Bauer aus der gastroenterologischen Abteilung fungieren weiterhin als Koordinatorinnen des Darmkrebszentrums und stehen den Patientinnen und Patienten als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
03.03.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Darmgesundheit im Fokus – Darmkrebsmonat März
Sofortige, präzise Diagnose und sichere Vorsorge durch hochauflösende Endoskopie

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland – und eine der am besten vermeidbaren. Dank moderner Endoskopie können Ärzte Veränderungen der Darmschleimhaut immer präziser beurteilen. Doch wie genau funktioniert das heute, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz, und wie profitieren Patienten im Landkreis Berchtesgadener Land von der engen Zusammenarbeit mit dem Darmkrebszentrum am Klinikum Traunstein? Wir haben mit PD Dr. Andrej Wagner, Chefarzt der Gastroenterologie und Diabetologie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, darüber gesprochen. mehr...
Herr Dr. Wagner, wie zuverlässig können Sie bei einer Darmspiegelung heute beurteilen, ob eine Veränderung harmlos oder gefährlich ist?
PD Dr. Wagner: Die Endoskopie hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Dank hochauflösender Optik und spezieller Färbemethoden können wir heutzutage die Darmschleimhaut bis ins kleinste Detail betrachten. So finden wir bereits bei der Hälfte unserer Vorsorgepatienten Polypen. In vielen Fällen reicht unser geschultes Auge bereits aus, um zu erkennen, ob es sich um eine harmlose oder eine potenziell bösartige Veränderung handelt.
Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
Die hochpräzise Diagnostik bedeutet vor allem, dass wir schneller und gezielter handeln können. Früher mussten wir oft Gewebeproben entnehmen und einige Tage auf die Laborergebnisse warten. Heute können wir bereits während der laufenden Untersuchung eine fundierte Diagnose abgeben und meist sogar direkt entscheiden, ob und wie eine Veränderung entfernt werden muss oder nicht. Das bedeutet mehr Sicherheit für die Patienten und in vielen Fällen können wir auf zusätzliche Eingriffe verzichten, da wir sofort behandeln können.
Welche Rolle spielt dabei die künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz ist eine echte Revolution in der Endoskopie und wird die Ärztinnen und Ärzte künftig unterstützen. Grund ist, dass KI-gestützte Systeme Veränderungen der Darmschleimhaut in Echtzeit analysieren können und diese mit optischen Markierungen kennzeichnen. Besonders hilfreich ist das bei sehr kleinen oder schwer erkennbaren Veränderungen, die dem menschlichen Auge möglicherweise entgehen könnten. Studien zeigen, dass die Trefferquote bei der Erkennung von Polypen durch den Einsatz von KI gesteigert werden kann. Dennoch ist weiterhin die minutiöse Untersuchung nach internationalen Standards durch erfahrene Endoskopiker bei guter Vorbereitungsqualität der Goldstandard.
Was passiert nach der Diagnose? Wie geht es für die Patientinnen und Patienten weiter?
Für Patientinnen und Patienten mit unauffälliger Darmspiegelung heißt es in der Regel: Entwarnung! Je nach persönlichem Risiko sollte die nächste Kontrolle nach fünf oder zehn Jahren erfolgen. Wer jedoch Polypen hatte oder ein erhöhtes familiäres Risiko besitzt, sollte öfter eine Darmspiegelung vornehmen lassen.
Patientinnen und Patienten, bei denen wir eine verdächtige Veränderung feststellen, erhalten eine fundierte Behandlungsempfehlung und engmaschige Betreuung. Viele, auch größere Polypen im Darm lassen sich mit modernen Methoden im Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall endoskopisch sicher entfernen. Falls aufgrund des Befundes notwendig, erfolgt zudem eine weitere Abklärung oder Therapie im zertifizierten Darmkrebszentrum am Klinikum Traunstein unter der Leitung von Dr. Björn Lewerenz, Chefarzt der Gastroenterologie, und dem stellvertretenden Leiter Prof. Dr. Christian Jurowich, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Wir arbeiten eng mit den Kolleginnen und Kollegen dieses Bereichs zusammen, denn das Zentrum bietet modernste Behandlungsmöglichkeiten und interdisziplinäre Expertise. Jeder Fall wird dann unmittelbar persönlich mit dem Darmkrebszentrum besprochen und den Patientinnen und Patienten ein zeitnaher Vorstellungstermin angeboten. Hierbei können die Kolleginnen und Kollegen aus dem Klinikum Traunstein direkt auf unsere Befunde zugreifen. Patienten aus dem Landkreis Berchtesgadener Land werden damit optimal versorgt – ohne weite Wege auf sich nehmen zu müssen.
Welche Bedeutung hat die enge Zusammenarbeit mit dem Darmzentrum am Klinikum Traunstein?
Die Versorgung von Patienten mit Darmkrebs erfordert ein Zusammenspiel vieler Spezialisten. In unserem Klinikverbund arbeiten deshalb Gastroenterologen, Chirurgen, Onkologen und Radiologen Hand in Hand. Durch unsere regelmäßigen Fallkonferenzen stellen wir sicher, dass jeder Patient und jede Patientin die individuell beste Therapie erhält. Damit profitieren sie von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernster Technik. Am wichtigsten ist uns jedoch, dass sich die Patienten nicht selbst um Anschlusstermine kümmern und Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Wir koordinieren die Therapie so, dass den Menschen unnötige Untersuchungen erspart, die Wartezeiten verkürzt und die Heilungschancen somit verbessert werden.
Zum Schluss: Wie wichtig ist eine regelmäßige Darmkrebsvorsorge?
Enorm wichtig! Darmkrebs ist eine der wenigen Krebsarten, die sich fast vollständig verhindern lässt. Früh entdeckte Polypen können wir unkompliziert entfernen, bevor sie sich zu Krebs entwickeln. Deshalb ist es so entscheidend, dass Menschen die Vorsorgeangebote wahrnehmen. Die moderne hochauflösende Endoskopie hat die Darmkrebsvorsorge sicherer, genauer und effizienter gemacht. Wer ab 50 zur Vorsorge-Darmspiegelung geht, kann sein Risiko für Darmkrebs drastisch senken – und das sollte wirklich jede und jeder wahrnehmen.
Vortrag im Rahmen der Reihe GesundheitAKTIV am 3. April von 16 - 17:30 Uhr in der Kreisklinik Bad Reichenhall
PD Dr. Andrej Wagner spricht zum Thema: „Von Darmpolypen und Magengeschwüren - wann Vorsorgeendoskopie Sinn macht und welche Therapiemöglichkeiten es gibt“
27.02.2025
Die KSOB ist jetzt Ausbildungsstätte für Kardiologen
Zusatzqualifikation durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie ermöglicht Weiterbildung in interventioneller Kardiologie

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) hat der Kardiologischen Abteilung der Kliniken Südostbayern (KSOB) die Zusatzqualifikation als „Stätte Interventionelle Kardiologie“ zuerkannt. Ziel der neuen Qualifikation ist es, eine strukturierte interventionelle Ausbildung für Kardiologinnen und Kardiologen anzubieten. Die Berechtigung gilt sowohl für das Klinikum Traunstein als auch für die Kreisklinik Bad Reichenhall. mehr...
Die Zusatzqualifikation untermauert das breite Angebot der KSOB, die alle verfügbaren Verfahren der Koronarintervention vorhält, um eine optimale Patientenversorgung zu erreichen.
Leiter der neuen zertifizierten Stätte ist Prof. Dr. Michael Lehrke, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein und der Kreisklinik Bad Reichenhall. Die stellvertretende Leitung haben der Leitende Oberarzt PD Dr. Niklas Boeder sowie die Oberärztin Dr. Andrea Streicher und der Oberarzt Dr. Alexander Galland.
26.02.2025 - Kliniken Südostbayern
Fachlich stark, menschlich nah
Top-Ergebnis für die Ausbildung an den KSOB in aktueller Studie der DQGB

Die Kliniken Südostbayern (KSOB) gelten laut einer aktuellen Studie der Deutschen Qualitäts- & Bewertungsgesellschaft (DQGB) als eine der gefragtesten Ausbildungsstätten in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein. mehr...
In Zeiten des Fachkräftemangels entscheiden sich junge Talente für Unternehmen, die ihnen mehr bieten als eine bloße Lehrstelle. Die KSOB hat dies erkannt: Wer eine Ausbildung beginnt, stellt sich nicht nur die Frage nach dem richtigen Beruf, sondern auch nach dem besten Ausbildungsbetrieb. Laut der aktuellen Studie „Deutschlands beliebteste Ausbildungsbetriebe 2025“ rangiert die KSOB mit an der Spitze der beliebtesten Ausbildungsstätten in der Region – und das aus gutem Grund.
Was macht die KSOB so beliebt? Junge Menschen erwarten heute mehr als nur eine solide Fachausbildung. Sie suchen eine Unternehmenskultur, die sie ernst nimmt, die Entwicklungsmöglichkeiten bietet und ein Umfeld schafft, in dem Arbeiten und Lernen Freude machen. Genau hier punktet die KSOB: Sie setzt auf moderne Ausbildungskonzepte, eine praxisnahe Wissensvermittlung und individuelle Förderung der Auszubildenden. Die Kliniken Südostbayern AG bietet ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und schafft damit Perspektiven für unterschiedlichste Interessen und Talente. Steffen Köhler, Leiter des Geschäftsbereich Personal und Bildung freut sich: „Wir sehen in dieser Bewertung eine starke und wertvolle Bestätigung unserer steten Bemühungen um eine gute und fundierte Ausbildung für alle unsere Azubis. Die Auszeichnung ist Ansporn für uns, auch weiterhin an der Entwicklung der Ausbildungsberufe zu arbeiten und damit beste Perspektiven zu bieten.“
Dass die KSOB damit den Nerv nicht nur der jungen Generation trifft, zeigt sich in der DQGB-Studie, die auf mehreren Säulen beruht: die Ergebnisse wurden erzielt durch eine breite Bevölkerungsbefragung, eine KI-gestützten Online-Analyse und eine Unternehmensbewertung per Fragebogen. In diesem umfassenden Verfahren konnte sich die KSOB gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen.
Wer eine Ausbildung mit Zukunft sucht, sollte also nicht zögern: Die Kliniken Südostbayern AG bietet erstklassige Chancen, praxisnahe Erfahrung und eine sichere Perspektive für den Berufseinstieg als ersten Schritt in eine erfolgreiche Karriere.
25.02.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Kein Tabuthema: Beschwerden im Analbereich
Ursachen und Behandlungen – Gesundheit-AKTIV Vortrag

Beschwerden im Enddarm- und Afterbereich sind weit verbreitet, aber selten Gesprächsthema. Dabei betrifft das Thema nahezu jeden Erwachsenen im Laufe seines Lebens. Viele Betroffene zögern aus Scham, einen Arzt aufzusuchen. Dabei gibt es mittlerweile moderne und schonende Behandlungsmöglichkeiten, erklärt Dr. Steffi Lasch, Leitende Oberärztin der Abteilung Allgemein-, Viszeral- und Minimal-Invasive Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall mehr...
Häufige Symptome sind Brennen, Jucken, Schmerzen oder auch Blutungen. Hierfür gibt es vielfältige Ursachen von Hämorrhoiden, Perianalvenenthrombosen, Abszesse, Fisteln, Ekzemen und vieles mehr. Aber auch Obstipation mit Stuhlentleerungsstörungen und Stuhlinkontinenz können sich so äußern.
Allen Erkrankungen des Enddarmes ist in der Behandlung gemeinsam, eine sogenannte Basistherapie mit einer korrekten Hygiene und Stuhlregulation. Einige der Erkrankungen bedürfen einer spezifischen ärztlichen und auch teils operativen Therapie. Die geplante Patientenveranstaltung soll Aufklären, nicht nur was es für Erkrankungen gibt und wie sie behandelt werden, sondern was man selbst tun kann und wann der Arzt nötig ist.
Hämorrhoiden und Co
Eine der häufigsten Ursachen für anale Beschwerden kann ein Hämorrhoidalleiden sein. „Jeder Mensch hat Hämorrhoiden – aber nicht jeder hat Probleme damit“, stellt Fr. Lasch klar. Beschwerden entstehen erst, wenn sich das Gefäßgeflecht im Analkanal stark vergrößert oder nach außen tritt. In vielen Fällen lassen sich krankhafte Hämorrhoiden anfänglich ohne Operation behandeln, etwa durch eine Stuhlregulation und eine lokale Salben- bzw. Zäpfchentherapie. Die Behandlung von vergrößerten Hämorrhoiden erfolgt nach einem Stufenkonzept in Abhängigkeit von der Größe und den Beschwerden von Stadium 1-4. In den Anfangsstadien kommen auch Verödungen und Gummibandligaturen zum Einsatz. Ab Stadium 3 ist der Chirurg gefragt. Wo früher vergrößerte Hämorrhoiden radikal entfernt wurden, setzt man an der Kreisklinik Bad Reichenhall auf schonendere Verfahren. „Wir haben unser Spektrum erweitert und bieten jetzt modernste Techniken an, darunter die Behandlung mit dem Diodenlaser. Dadurch können wir Hämorrhoiden viel schonender veröden, ohne dass die Schließmuskelfunktion beeinträchtigt wird“, erklärt Fr. Lasch. Durch die Lasertherapie bleibt die Funktion des Gefäßgeflechts erhalten, was insbesondere mit Blick auf die langfristige Kontinenz entscheidend ist.
Neben Hämorrhoiden gibt es viele weitere Erkrankungen im Afterbereich, die oft mit ihnen verwechselt werden – etwa die Perianalvenenthrombose. Dabei handelt es sich um ein schmerzhaftes Blutgerinnsel am Afterrand. „Es ist zwar ungefährlich, kann aber sehr schmerzhaft sein“, so Fr. Lasch. Die Behandlung umfasst in der Regel kühlende Maßnahmen und Schmerzmittel. Nur bei sehr großen Thrombosen kann ein kleiner chirurgischer Eingriff nötig sein.
Beckenbodenerkrankungen
Neben diesen meist harmlosen, aber unangenehmen Enddarmerkrankungen gibt es auch ernste Beckenbodenprobleme wie Stuhlinkontinenz oder Stuhlentleerungsstörungen. Viele Betroffene leiden still, dabei gibt es effektive Behandlungsmöglichkeiten. „Die ersten Anzeichen sind oft das unkontrollierte Entweichen von Luft oder Schwierigkeiten, flüssigen Stuhl zurückzuhalten“, erläutert Fr. Lasch. „Leider kommen viele Patienten erst in einem späten Stadium zu uns, wenn es bereits zu ungewolltem Stuhlabgang kommt.“ Ein zentraler Ansatz in der Therapie ist das gezielte Training des Beckenbodens. „Muskeln können trainiert werden – aber das braucht Zeit und Geduld. Ein Training bringt nichts, wenn man es nur zwei oder drei Wochen macht. Es muss kontinuierlich über Monate erfolgen“, erklärt Fr. Lasch. Biofeedbacktraining mit Elektrostimulation kann dabei helfen, den Schließmuskel gezielt zu stärken. „Diese Therapie wird von den Krankenkassen für eine Probezeit von drei Monaten übernommen. Bei Erfolg kann sie verlängert werden“, so die Expertin. In manchen Fällen reicht Training allein aber nicht aus. In diesen Fällen sind noch Optionen eines Schrittmachers oder eines Schließmuskelersatzes zu prüfen.
Bei starken Beckenbodensenkungen, die häufig mit Entleerungsstörungen einhergehen, kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein. „Wenn sich der Enddarm nicht mehr in die richtige Position aufrichten kann oder sich nach außen ausstülpt, müssen wir operativ korrigieren. Dies betrifft überwiegend Frauen, die mal Kinder bekommen haben, oder Patienten mit schweren Muskelschwächen“, erklärt Fr. Lasch.
Große Wirkung: Flohsamenschalen
Ob Hämorrhoiden und Co., Beckenbodensenkung oder Stuhlinkontinenz – viele Beschwerden können mit gezielten Maßnahmen erheblich verbessert werden. Eine wichtige Rolle spielt die Ernährung. „Wir empfehlen Flohsamenschalen, um die Stuhlkonsistenz zu regulieren. Diese können sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall helfen. Sie sind ein natürliches Mittel, das zu keiner Gewöhnung des Darmes führt“, rät Fr. Lasch. Die richtige Hygiene ist ebenfalls wichtig: Ideal ist die Bidet-Anwendung nach dem Stuhlgang, ein feuchter Waschlappen ist eine gute Alternative. Von feuchtem Toilettenpapier rät die Medizinerin dringend ab. Weichmacher und Duftstoffe gefährden die natürliche Immunbarriere der Haut.
Grundsätzlich gilt, eine frühzeitige Diagnose ermöglicht oft eine schonende Behandlung. Viele Patienten zögern jedoch aus Scham. „Wir haben daher in unserer Sprechstunde einen speziellen Fragebogen entwickelt, der es den Patienten erleichtert, ihre Beschwerden zu beschreiben, ohne sie direkt aussprechen zu müssen“, so Fr. Lasch. Dadurch können wiederum Ärzte gezielter nachfragen und schneller eine geeignete Therapie einleiten.
Das Fazit der Medizinerin: „Die meisten Beschwerden im After- und Beckenbodenbereich sind behandelbar – je früher, desto besser. Niemand sollte aus Scham auf eine bessere Lebensqualität verzichten.“
In dem Vortrag „Enddarm und Beckenbodenerkrankungen“, geben Steffi Lasch, Leitende Oberärztin und Oberarzt Diego Castro von der Abteilung Allgemein-, Viszeral- und Minimal-Invasive Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall im ersten Teil einen Überblick über die häufigsten Erkrankungen im Afterbereich sowie modernste Behandlungskonzepte. Der zweite Teil des Vortrags behandelt die Probleme des Beckenbodens mit Stuhlentleerungsstörungen und Stuhlinkontinenz. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen. Die Veranstaltung findet am 6. März von 16:00 bis 17:30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhall statt und ist Teil der Reihe ‚Gesundheit Aktiv‘ der Kliniken Südostbayern (KSOB). Der Eintritt ist frei.
18.02.2025 - Klinikum Traunstein
Präziser, wirksamer, schonender: Die neue Generation der Krebstherapien gibt Hoffnung
Neueste Erkenntnisse vom Weltkrebstag 2025
Die Fortschritte in der Krebstherapie sind vielversprechend: Immer präzisere Diagnoseverfahren und personalisierte Behandlungsansätze erhöhen die Überlebenschancen von Krebspatienten deutlich. Dr. Thomas Kubin, Chefarzt der Onkologie / Hämatologie und Sprecher des Onkologischen Zentrums am Klinikum Traunstein, gibt einen Einblick in die neuesten Entwicklungen. mehr...
Wie hat sich die Diagnostik von Tumoren im Hinblick auf die Therapie in der letzten Zeit verändert?
Dr. Kubin: Die Diagnostik in der Krebstherapie hat sich grundlegend gewandelt. Wir können auf Basis von Gen-Tests der einzelnen Krebszelle immer präziser, personalisierter und zielgerichteter behandeln. Da geht es bereits in der Diagnostik um ganz bestimmte Untertypen von Krebserkrankungen und wir können sehen, welche Veränderung in der Erbinformation dieser Zellen stattgefunden hat. Auf dieser Basis wird eine Strategie entwickelt, wie diese krankhaften Änderungen blockiert und quasi abschaltet werden können. Für diese hochspezialisierte Diagnostik wurde im Onkologischen Zentrum am Klinikum Traunstein ein molekulares Tumorboard unter Mitwirkung von internistischen Onkologen, Molekularpathologen, Humangenetikern und Biologen etabliert. Um unsere Erfahrungen aus diesen Gen-Tests weiter zu entwickeln, sind wir, zusammen mit der TU München, einer der ausgewählten Partner in einem staatlich geförderten Projekt zur Entwicklung vernetzter molekularer Tumorboards in Bayern.
Welche neuen Therapieformen haben besondere Fortschritte gemacht?
Dr. Kubin: Während früher oft nur die Chemotherapie als Standardbehandlung galt, setzen wir heute verstärkt auf passgenaue, personalisierte Behandlungskonzepte. Dadurch können wir effektiver behandeln und Nebenwirkungen reduzieren. Die großen Säulen der Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen sind weiterhin die Chirurgie, die Strahlentherapie und die internistisch-medikamentöse Therapie.
Operiert wird heute aber, wenn möglich, nur noch durch “Knopflochchirurgie”, also gewebeschonend durch kleine Schnitte mit Hilfe von Laparoskopen oder noch schonender mittels roboterassistierter Chirurgie.
Die Strahlentherapie kann heutzutage durch computergestützte 3D-Planung extrem genau ein Zielfeld definieren und dieses durch verschiedenste Techniken gewebeschonend millimetergenau bestrahlen und, wo gewünscht und sinnvoll, mit einer einzeitigen Bestrahlung zerstören (stereotaktische Bestrahlung oder Radiochirurgie).
Die Behandlung von Krebs durch Medikamente zeigt seit langen Jahren die größte Dynamik für innovative Neuerungen. Hierbei wird die klassische Chemotherapie immer seltener und kürzer eingesetzt und ist mittlerweile für manche Krebserkrankungen komplett verzichtbar. Im Gegenzug wird die Therapie immer mehr durch biologische Therapeutika wie Antikörper, zielgerichtete Substanzen und Immuntherapeutika erweitert.
Können Sie die Immuntherapie näher erläutern?
Dr. Kubin: Die Immuntherapie ist eine der spannendsten Entwicklungen der letzten Jahre und hat die Behandlung von Krebs de facto revolutioniert. Sie ist die neueste entwickelte Säule im Kampf gegen Tumoren. Hierbei wird das körpereigene Abwehrsystem mit Hilfe von speziellen Antikörpern stimuliert, selbst aggressiv gegen Tumorzellen im Körper vorzugehen. Sie ist in den Anfängen seit knapp 10 Jahren verfügbar und hat die Therapie vieler solider Tumoren deutlich verbessert. Durch den Einsatz kann nicht nur das Leben von vielen Patienten deutlich verlängert werden, sondern es kommt auch bei einem kleinen Teil der Patienten wahrscheinlich zu einer Ausheilung des Krebsleidens, auch schon im metastasierten Krankheitsstadium. Solche überraschend guten Verläufe haben wir früher nie gesehen, das stimmt uns sehr optimistisch. Zu diesem Gebiet läuft ganz viel Forschung, um die Immuntherapie noch weiter zu verbessern, damit der Körper sich eines Tages mit gezielter Lenkung selbst von seinem Krebs befreien kann – das ist das Ziel.
Wie sieht die Krebsbehandlung für den einzelnen Patienten denn aus?
Dr. Kubin: Heutzutage erfordert die Behandlung von Krebs ein Team aus Spezialisten verschiedener Fachrichtungen. In unserem Onkologischen Zentrum führen wir regelmäßig große Tumorkonferenzen durch, bei denen Onkologen, Chirurgen, Strahlentherapeuten, Radiologen und Pathologen sowie je nach Krankheitsbild auch Gastroenterologen, Urologen, Gynäkologen, Thoraxchirurgen, Neurochirurgen und andere Experten gemeinsam die beste Strategie für jeden einzelnen Patienten entwickeln. Wir haben spezialisierte Organzentren, die sich intensiv mit den jeweiligen Krebsarten befassen und dadurch eine hochspezialisierte individuelle Behandlung ermöglichen.
Wichtig ist uns auch, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten durch verschiedenste Angebote deutlich zu steigern. Dazu gehören neben der Therapie gegen den Krebs selbst auch die intensive Behandlung von Beschwerden und die Stärkung der Restgesundheit sowie, wo nötig, eine palliativmedizinische Begleitung. Wir bieten auch eine Beratung für soziale Belange an und Unterstützung zu Hause bis hin zur psychologischen Gesprächstherapie. Für uns ist der ganze Mensch wichtig und wir möchten auf ganzer Linie helfen, die Angst erfolgreich zurückzudrängen und wieder gut ins Leben zurückzukommen. Hier hilft im ambulanten Bereich zusätzlich der Verein „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“ mit vielen guten Angeboten.
Können die Menschen in Zukunft eine noch bessere Heilungsrate erwarten?
Dr. Kubin: Die Fortschritte der letzten Jahre lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken: Die Errungenschaften der modernen Medizin können nicht nur viele Krebserkrankungen in den verschiedensten Stadien teilweise sogar ausheilen, sondern können auch das Leben mit Krebs wenigstens um Monate oder um viele Jahre verlängern und die Lebensqualität deutlich steigern. Heute überleben bereits rund 60 % der Patienten ihre Krebserkrankung langfristig. Durch weitere Innovationen, eben insbesondere in der Immuntherapie und der personalisierten Medizin, wird diese Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen. Unser langfristiges Ziel ist es, Krebs immer häufiger heilbar zu machen oder zumindest in eine chronische, gut kontrollierbare Krankheit zu verwandeln. Besser als einen Krebs zu behandeln ist aber, die Entstehung von Krebs zu verhindern.
Was können die Menschen selbst tun, um ihr Krebsrisiko zu senken?
Dr. Kubin: Krebs ist eine potenziell tödliche Erkrankung die jedem, den diese Diagnose ereilt, Angst macht. Angst ist aber der schlechteste Berater im Umgang mit einer Krebserkrankung. Daher sollte man unbedingt zu den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen gehen, um Krebs frühzeitig zu erkennen und diesen damit gegebenenfalls deutlich besser behandeln zu können. In Deutschland gibt es daher ein gesetzliches Krebsfrüherkennungsprogramm gegen fünf verschiedene Krebsarten. Hierzu gehören die Vorsorge gegen Darmkrebs und Hautkrebs, für Frauen zusätzlich Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs, für Männer Prostatakrebs. In Anbetracht steigender Krankheitsraten kommt der Prävention, also der möglichen Verhinderung des Auftretens von Krebserkrankungen, eine immer größere Bedeutung zu. Man schätzt, dass rund 40 % aller Krebsfälle durch eine gesündere Lebensweise vermieden werden könnten. Dazu gehören der Verzicht auf Rauchen, geringer oder gar kein Alkoholkonsum, eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie wenig rotes oder verarbeitetes Fleisch, regelmäßige Bewegung, besser noch regelmäßige sportliche Betätigung, und das Meiden von übermäßiger UV-Strahlung sowie Limitierung von Übergewicht.
14.02.2025 - Klinikum Traunstein
Neues Nierenkrebszentrum am Klinikum Traunstein
Angebot des Onkologischen Zentrums wird im Sommer erweitert

Mit der geplanten Eröffnung eines spezialisierten Nierenkrebszentrums im Sommer erweitern die Kliniken Südostbayern ihr onkologisches Leistungsspektrum. Unter der Leitung von Prof. Dirk Zaak, Chefarzt der Urologie und Leiter des Prostata- und Hodenkrebszentrums, wird das Zentrum modernste Diagnose- und Therapiemethoden anbieten, um Patientinnen und Patienten in der Region wohnortnah optimal zu versorgen. Die Zertifizierung nach höchsten medizinischen Standards ist in Vorbereitung. mehr...
Das neue Zentrum ergänzt die bestehenden spezialisierten Organzentren des Onkologischen Zentrums. „Mit dem Nierenkrebszentrum schließen wir eine wichtige Versorgungslücke und stärken die wohnortnahe onkologische Versorgung jetzt auch für Nierenkrebspatienten“, betont Reinhold Frank, Koordinator des Onkologischen Zentrums in Traunstein.
Nierenkrebs wird häufig zufällig bei Routineuntersuchungen durch niedergelassene Haus- oder Fachärzte entdeckt, da er in frühen Stadien oft keine Beschwerden verursacht. Die Therapie richtet sich individuell nach Größe, Lage und Ausbreitung des Tumors. „Jede Diagnose ist anders – unser Ziel ist es, für jeden Patienten individuell die beste und schonendste Behandlungsmethode zu finden“, erklärt Prof. Dirk Zaak.
13.02.2025 - Klinikum Traunstein
Ein zweites Leben
Eine Patientengeschichte über ärztliches Können, den Wert psychologischer Betreuung, hingebungsvolle Pflege und nicht nachlassenden Glauben an die Heilung

Es war ein schöner Abend bei der Hochzeitsfeier der Freunde Ende April 2024. Wieder zuhause, möchte Daniela Z. nur noch kurz etwas nachsehen und stürzt auf der Kellertreppe. Kurze Zeit später findet Herr Z. seine Frau auf dem Boden liegend, benommen, aber äußerlich unverletzt. Am nächsten Morgen fühlt sich die 42jährige so schlecht, dass sie beide ins Krankenhaus fahren. In der Kreisklinik Bad Reichenhall folgt die erschütternde Diagnose: schwere Blutungen im Schädel. Die Ainringerin wird sofort mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen. Ankunft 12:41 Uhr, das interdisziplinäre Team der Intensivmedizin, Neurochirurgie und Neuroradiologie erwartet sie bereits. mehr...
„Ich erinnere mich genau: Frau Z. war leicht desorientiert, aber ansprechbar“, berichtet Dr. Andreas Mangold, Leitender Arzt der Neuroradiologie am Klinikum Traunstein. „Doch ihre Bewusstseinslage verschlechterte sich zusehends, und wir mussten sofort handeln.“ Die Patientin wird intubiert und beatmet, und erhält von Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger, Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Traunstein, eine Drainage zur Ableitung des Nervenwassers, um den Hirndruck zu senken. Neben einem Bruch des zweiten Halswirbels bestätigt das CT eine Schädel-Hirnverletzung mit ausgedehnter Blutung im Schädelinneren. Die daraufhin eingeleitete Katheteruntersuchung der Gehirnarterien zeigt ein Aneurysma, also eine Gefäßaussackung, die durch einen Einriss der inneren Gehirnschlagader verursacht wurde.
Mutige Entscheidungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Aufgrund der dramatischen Diagnose entscheidet sich Dr. Mangold zu einer ungewöhnlichen Behandlungs-Methode: Er setzt einen sog. Flow-Diverter ein, um das gerissene Gefäß von innen abzudichten. „Es ist ein Verfahren, das in derart seltenen Fällen keinen Routineeingriff darstellt – eine Art Stent für die Gehirnarterie. Ich wusste, dass es Risiken barg, aber es war ihre einzige Chance“, sagt er. Die ersten 48 Stunden nach der Operation sind entscheidend und der Zustand von Daniela bleibt kritisch. Im weiteren zeitlichen Verlauf wird er sich durch Krämpfe der Blutgefäße, sogenannte Vasospasmen, noch verschlechtern. Diese führen zu einer Minderdurchblutung des Gehirns, die schwerwiegende Infarkte auslösen kann. Dr. Mangold entscheidet sich erneut für eine unkonventionelle Behandlung: in weiteren fünf Katheteroperationen kann er die durch die Krämpfe verengten Gefäße medikamentös und mechanisch mit Ballons und Stents erfolgreich erweitern. „Wir haben mit unseren Entscheidungen alles darangesetzt, ihr Leben zu retten.“
Priv.-Doz. Dr. Rachinger und Dr. Mangold führen insgesamt zehn Operationen durch. „Es war eine enge Zusammenarbeit. Jeder Eingriff wurde im Team und gemeinsam mit ihrem Ehemann besprochen“, sagt Priv.-Doz. Dr. Rachinger. Und Dr. Mangold ergänzt: „Der Ehemann befürwortete unseren Plan offensiv und hatte volles Vertrauen in uns, obwohl damals niemand vorhersagen konnte, ob es funktioniert oder nicht. Das waren wirklich schicksalsbestimmende Operationen und ich bin sehr froh, dass wir immer wieder aufs Neue an den Erfolg geglaubt haben.“
Pflegerische und psychologische Unterstützung für die Patientin und ihre Angehörigen
Von Beginn an spielt die enge Beziehung zwischen der Betroffenen und ihrer Familie sowie dem Behandlerteam, bestehend aus Fachärzten, hochqualifizierten Pflegekräften und therapeutischen Mitarbeitern, eine Schlüsselrolle. Zum therapeutischen Team der Intensivstationen zählt am Klinikum Traunstein auch der Psychologische Dienst um Gisela Otrzonsek. Deren Wirken ist jedoch keine Regelleistung der Krankenkassen und kann nur aufgrund der finanziellen Unterstützung der Eva Mayr-Stihl-Stiftung angeboten werden.
„Die figurative Begleitung der Aufwachphase solch einer Patientin ist aufwendig aber unbedingt notwendig. Wir waren jeden Tag bei Frau Z., auch während sie im Koma lag“, erzählt Gisela Otrzonsek. „Gemeinsam mit der Pflege suchten wir nach kleinsten Zeichen von Bewusstsein, nach einer Regung im Gesicht oder einer Bewegung, um das Aufwachen und Re-Orientieren sanft unterstützen zu können. Um die vielen kleinen und großen Schritte der Genesung für sie festzuhalten, begann die Pflege, unter Einbeziehung von Familie und Freunden, ein Intensivtagebuch zu schreiben.“
Zum Behandlungsprozess gehört auch die Einbeziehung der Familie der Patientin. Ihr Ehemann ist von Anfang an in alles involviert. Für ihn ist es selbstverständlich, seinen Tagesablauf so anzupassen, dass er jede freie Minute bei seiner Frau verbringen kann. „Trotz aller Belastungen war Herr Z. in der Lage, die Situation mit seinen Kindern tapfer zu meistern. Durch die enge Begleitung des Teams wusste er, dass er uns zu jeder Zeit als Ansprechpartner hatte. Auf seinen Wunsch sprachen wir über Hoffnungen und Ängste in der Familie und darüber, mit welchen Einschränkungen seine Frau würde leben können und wollen.“, sagt Otrzonsek und fährt fort: „Es ging darum, den Themen der Angehörigen einen sicheren Raum anzubieten und deren eigene Bewältigungsstrategien zu stärken. Er war ja, besonders in kritischen Phasen, 24 Stunden am Stück bei ihr. Dann wurde er von den Pflegekräften aufgefangen und durch Gespräche unterstützt. Das kleine Angehörigenzimmer auf der Intensivstation bot in dieser Situation einen willkommenen Rückzugsort für ihn, um zur Ruhe zu finden und Kraft zu tanken.“ In einer „angehörigenfreundlichen Intensivstation“ wie der am Klinikum Traunstein geht das.
Danielas Weg zur Genesung
Nach zwei Monaten auf der Intensivstation wird Daniela in die Rehabilitationsklinik nach Bad Aibling verlegt. Sie benötigt weiterhin Unterstützung beim Atmen durch eine Kanüle, kann nicht sprechen, hat eine Hirnwasserdrainage und ist rechtsseitig gelähmt. Niemand weiß, ob sie jemals wieder laufen oder sprechen kann. „Sie zeigte einen unglaublichen Willen“, erinnert sich Gisela Otrzonsek. In der Reha durchläuft sie Lungentraining, Physio-, Logo- und Ergotherapie sowie neuropsychologische Unterstützung. Im November 2024 kehrt sie nach Hause zurück.
Dankbarkeit und neue Perspektiven
Nur wenige Wochen später, am 6. Dezember, besucht sie die Intensivstation am Klinikum Traunstein und überrascht alle: Sie kommt auf eigenen Beinen, nur gestützt auf eine Krücke und mit einer Fußheberschiene. „Ihr Anblick machte kurz sprachlos. Wir waren überwältigt, dass man sich von so einem Zustand so rasch erholen und körperlich verbessern kann“, sagt Otrzonsek. „Sie hat sich aus einer physisch und mental äußerst schwerwiegenden Situation herausgekämpft.“
Bis heute stellt das Intensivtagebuch für die Patientin eine Unterstützung bei der Verarbeitung des Erlebten dar. Darin sind Bilder, Berichte und Erinnerungen von allen Personen festgehalten, die Teil ihres langen Wegs waren. „Es half mir, die fehlenden Stücke zu verstehen. Dieses Buch zeigte mir, wie viele Menschen an mich geglaubt haben“, sagt Daniela gerührt.
Ein Beispiel für Hoffnung und Stärke
Dr. Mangold betont: „Es sind Momente wie diese, die unsere Arbeit so besonders machen und uns auch bei schwierigen Fällen Mut machen, nicht aufzugeben.“ Die Patientin kommt an Weihnachten ein weiteres Mal auf die Intensivstation, um sich bei dem Team zu bedanken und gibt dabei auch die Parole für ihre Zukunft aus: „Wenn Ängste oder Zweifel aufkommen, ob es noch Besserung für mich gibt, dann weiß ich heute ganz genau, auf wen ich zählen kann. Aufgeben war nie eine Option für mich. Ich bin mir sicher, dass ich mit allem umgehen kann, egal was kommt. Auf, in mein zweites Leben!“
12.02.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Besuch des Kindergartens Sankt Nikolaus in der Kreisklinik Bad Reichenhall
Es gab viel Spannendes zu sehen

Die Kinder des Kindergartens Sankt Nikolaus hatten kürzlich einen aufregenden und lehrreichen Ausflug in die Kreisklinik Bad Reichenhall unternommen. Dort durften sie in der Notaufnahme das "Orchester des Körpers" kennenlernen – ein spannendes Projekt, bei dem sie spielerisch erfuhren, wie der menschliche Körper funktioniert und zusammenarbeitet. Besonders begeistert waren die Kinder von den verschiedenen Geräuschen, die der Körper erzeugt, und konnten dabei viel über die faszinierenden Abläufe im Inneren des Körpers lernen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung der Rettungswägen des BRK. Sie waren beeindruckt von den Geräten und Fahrzeugen, die bei Notfällen zum Einsatz kommen, und durften sogar einige der Geräte selbst ausprobieren.
11.02.2025 - Klinikum Traunstein
Über 40.000 Notfallpatienten in der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Traunstein
Neuer Rekord im Jahr 2024

Zum ersten Mal in der Geschichte des Traunsteiner Klinikums hat die Zentrale Notaufnahme mehr als 40.000 Notfallpatienten in einem Jahr behandelt. Dies zeugt für die hohe Leistungsfähigkeit des Klinikums in der Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und deren großes Vertrauen, hier Hilfe zu bekommen und gut versorgt zu werden. Allerdings stellt der gestiegene Versorgungsbedarf das Klinikum vor immer neue personelle und strukturelle Herausforderungen. mehr...
Exakt 40.315 Notfallpatienten mit Verletzungen und Erkrankungen aller Art im Alter zwischen 0 und 105 Jahren wurden in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Traunsteiner Klinikums im Jahr 2024 behandelt. Dabei wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Krankenhauses die Marke von 40.000 Notfallpatienten überschritten und damit ein neuer Rekord aufgestellt. Rechnet man die Patienten dazu, die sich mit geringfügigen Erkrankungen am gemeinsamen Tresen der Zentralen Notaufnahme und der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) vorgestellt haben und zu den entsprechenden Öffnungszeiten vom KVB-Bereitschaftsarzt (siehe Infokasten) behandelt wurden, wurden im vergangenen Jahr in den Räumlichkeiten der ZNA 47.500 Bürgerinnen und Bürger medizinisch versorgt. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung der Notfallpatienten zwischen 5 und 8%, was äquivalent zum bundeseinheitlichen Durchschnitt ist.
Dr. Maximilian Wiedemann, Chefarzt der Abteilung für Akut- und Notfallmedizin und damit auch der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Traunstein, sieht diese hohen Patientenzahlen von zwei Seiten: „Egal ob am Heiligabend, in der Silvesternacht oder am Ostersonntag, wir sind immer für die Menschen da. So bezeugen die Zahlen das Vertrauen unserer Patientinnen und Patienten in die exzellente medizinische Versorgung und hohe Leistungsfähigkeit des Klinikums und zeigen, welch wichtige Rolle die Zentrale Notaufnahme in der Versorgung der Einwohner des Landkreise Traunstein und teilweise auch der umliegenden Landkreise spielt. Gleichzeitig wird die Abteilung aber vor immer größere Herausforderungen gestellt, die Patientinnen und Patienten umfassend zu versorgen.“
Die Notaufnahme des Klinikums Traunstein erfüllt die Kriterien einer so genannten „umfassenden Notfallversorgung“. Dies bedeutet, dass sämtliche lebensbedrohliche Erkrankungen, wie ein akuter Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, ebenso wie schwerstverletzte Patienten behandelt werden können. Kliniken, die an der Notfallversorgung teilnehmen, müssen u.a. definierte Kriterien bezüglich fachlicher Qualifikation des eingesetzten Personals, vorgehaltener Strukturen, diagnostischer Mittel und Fachabteilungen erfüllen.
Aber woher kommen diese hohen Patientenzahlen in den Notaufnahmen? „Das ist tatsächlich die häufigste Frage, die mir als Chefarzt gestellt wird!“ berichtet Dr. Wiedemann. Die genaue Antwort kenne er nicht, die Gründe seien sicherlich vielfältig. Ein wesentlicher Punkt sei die demographische Entwicklung mit zunehmend älter werdender Bevölkerung und damit auch der Zunahme an Krankheitsfällen.
Aber natürlich hat sich auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger selbst verändert. So besteht in unserer modernen Gesellschaft teilweise der Anspruch, auch bei leichten, nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen nicht auf die Sprechstunde des Hausarztes am nächsten Werktag warten zu wollen, sondern sich unmittelbar an die Notaufnahme zu wenden. Patienten, die sich nach Rückkehr aus dem Urlaub noch in der Nacht mit einem Sonnenbrand vorstellen, gehören inzwischen ebenso zum Alltagsbild einer Notaufnahme, wie Patienten, welche nach einer Schmerztablette verlangen, weil ihnen der Weg zur Notdienstapotheke zu weit ist.
Durch Arbeitskreise und regelmäßige Treffen besteht im Landkreis Traunstein eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Ärztinnen und Ärzten der ambulanten Versorgung und der Klinik. Beide Seiten haben den Anspruch, sich stets gegenseitig zu unterstützen. „Und nicht zuletzt ist es meinem Team und mir ein großes Anliegen, unseren Patientinnen und Patienten in Notfällen zu helfen und sie medizinisch gut zu versorgen. Bei geringfügigen Erkrankungen bitten wir jedoch, die Sprechstunden der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wahrzunehmen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 in Anspruch zu nehmen.“, so Dr. Wiedemann.
05.02.2025 - Kreisklinik Trostberg
Frostige Zeiten für Schmerzpatienten
Interview mit Richard Strauss, Leitender Arzt der Stationären Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg und Experte für interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie.

Wenn Kälte weh tut: Winterzeit ist für viele Menschen mit chronischen Schmerzen eine besonders herausfordernde Zeit. Doch warum nehmen Schmerzen bei Kälte und Dunkelheit oft zu? Ein Interview mit Richard Strauss, Leitender Arzt der Stationären Schmerztherapie an der Kreisklinik Trostberg. Der Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, ist Experte für interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie. Er erklärt die Zusammenhänge und gibt wertvolle Tipps. mehr...
Viele Schmerzpatienten klagen im Winter über verstärkte Beschwerden. Woran liegt das?
Einer der Hauptfaktoren ist natürlich die Kälte. Niedrige Temperaturen führen dazu, dass sich die Blutgefäße verengen. Dadurch wird die Durchblutung in Muskeln und Gelenken reduziert, was wiederum die Schmerzempfindlichkeit erhöhen kann. Zudem spannen sich viele Menschen bei Kälte unbewusst an, was Muskelverspannungen und damit Schmerzen begünstigt.
Spielt auch der Lichtmangel eine Rolle?
Weniger Tageslicht im Winter bedeutet, dass der Körper weniger Serotonin produziert – das sogenannte Glückshormon. Ein niedriger Serotoninspiegel kann wiederum die Schmerzverarbeitung im Gehirn beeinflussen und das Schmerzempfinden verstärken. Zudem kann Lichtmangel zu einer verstärkten Ausschüttung von Melatonin führen, was zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit beiträgt. Deswegen empfehle ich, unbedingt auch gerade im Winter spazieren zu gehen, wenn die Sonne scheint – das hilft dem Körper, Vitamin D zu produzieren. Und das wiederum hebt die Laune.
Gibt es auch psychologische Faktoren, die Schmerzen im Winter verstärken?
Viele Patienten leiden in der dunklen Jahreszeit unter saisonalen Stimmungstiefs oder sogar Depressionen. Diese psychische Belastung kann Schmerzen intensiver erscheinen lassen. Auch weniger Bewegung im Winter, etwa weil Spaziergänge bei Schnee und Regen unangenehmer sind, trägt dazu bei. Bewegung, am besten bei Sonnenschein, ist jedoch essenziell für Menschen mit chronischen Schmerzen.
Gibt es bestimmte Patientengruppen, die besonders betroffen sind?
Ja, vor allem Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, Arthrose oder Fibromyalgie berichten über verstärkte Schmerzen in den Wintermonaten. Aber auch Patienten mit chronischen Rückenschmerzen oder Migräne sind oft stärker betroffen, da Wetterumschwünge und Luftdruckveränderungen eine Rolle spielen können.
Was können Betroffene tun, um die Beschwerden zu lindern?
Es gibt einige hilfreiche Maßnahmen. Wärmetherapie, wie Wärmepflaster oder warme Bäder, kann Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern. Auch Bewegung – trotz der Kälte – ist wichtig, da sie den Stoffwechsel anregt und Endorphine freisetzt, die als natürliche Schmerzhemmer wirken. Zudem empfehle ich Tageslichtlampen oder eben regelmäßige Spaziergänge, um den Serotoninspiegel zu steigern. Wer zu depressiven Verstimmungen neigt, sollte außerdem nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Gibt es Möglichkeiten für die Patientinnen und Patienten, sich schon vorab auf den Winter vorzubereiten?
Eine gesunde Lebensweise mit regelmäßiger Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Schlaf kann helfen, den Körper besser auf den Winter einzustellen. Auch Achtsamkeitsübungen oder Entspannungstechniken, wie Yoga oder Meditation, können helfen mit Stress und Schmerzen besser umzugehen. Zudem kann eine frühzeitige Anpassung der Medikation in Absprache mit dem Arzt sinnvoll sein.
Wie kann die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie den Menschen helfen?
Wir in der Kreisklinik Trostberg verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie ist weiterhin der Goldstandard in der Behandlung chronischer Schmerzen. Sie kombiniert verschiedene Therapieformen, um den Patienten individuell zu helfen. Unsere Zielsetzung ist, einen besseren Umgang mit der chronischen Schmerzerkrankung mit all ihren Facetten, sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene, zu erlangen. Dazu zählen gezielte medizinische Behandlungen sowie komplementär therapeutische Verfahren, wie z. B. Akupunktur und Neuraltherapie. Durch Bewegungstherapie und aktivierende Maßnahmen wird sowohl die Beweglichkeit als auch die Kraft-Ausdauer gefördert und Bewegungsangst abgebaut. Zusätzlich werden in der Psychotherapie schmerzverstärkende Gedanken, Gefühle und/oder Verhaltensweisen identifiziert und ein bio-psycho-soziales Schmerzverständnis vermittelt. Davon ausgehend können dann individuelle Bewältigungsstrategien erarbeitet werden, z. B. für den Umgang mit Grübelgedanken oder für die Verbesserung der Selbstfürsorge. Das Lernen eines Entspannungsverfahrens kann darüber hinaus helfen Stressfaktoren auszubalancieren. Durch diesen umfassenden Ansatz können wir die Lebensqualität der Betroffenen deutlich steigern und ihnen helfen, den Winter zu überstehen.
31.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Zertifiziertes Hernienzentrum Berchtesgadener Land
Medizinische Expertise mit Zertifikat in der Kreisklinik Bad Reichenhall

Seit 1. Januar 2025 ist die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Minimal Invasive Chirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie zertifiziert. Die Auszeichnung durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) unterstreicht die hohe medizinische Qualität und die langjährige Expertise in der Kreisklinik Bad Reichenhall. Patientinnen und Patienten im Berchtesgadener Land profitieren von modernsten Behandlungsmethoden und einem interdisziplinären Team, das individuelle Therapieansätze ermöglicht. mehr...
Langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklung
Unter der Leitung von Chefarzt Dr. Thomas E. Langwieler wurde die Hernienchirurgie in der Kreisklinik Bad Reichenhall seit 2015 kontinuierlich weiterentwickelt und die Therapiemöglichkeiten verfeinert. Seit Mai 2021 beteiligt sich die Abteilung an der Qualitätssicherungsstudie „Herniamed“ und erhielt in diesem Rahmen das Qualitätssiegel der Deutschen Hernien Gesellschaft, das 2023 erneuert wurde. Diese fortlaufenden Verbesserungen führten zur Gründung des spezialisierten Hernienzentrums unter der Leitung von Oberarzt Stefan Buchholz und zur anschließenden Zertifizierung durch die DGAV.
Umfassende Behandlungsmethoden für Hernien
Im Hernienzentrum Berchtesgadener Land werden diverse Hernienarten behandelt, darunter Leisten-, Schenkel-, Narben-, Nabel- und Bauchwandbrüche sowie Zwerchfellbrüche, die oft mit chronischem Sodbrennen einhergehen. Dabei stehen sowohl minimalinvasive als auch konventionelle Operationsverfahren zur Verfügung und es wird für jeden Patienten ein individuell abgestimmtes Behandlungskonzept erstellt. Besonders hervorzuheben ist die spezialisierte Therapie für Zwerchfellbrüche, die in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für Gastroenterologie und Diabetologie unter Leitung von Chefarzt PD Dr. Andrej Wagner erfolgt.
Individuelle Patientenbetreuung in der Herniensprechstunde
Das Zentrum bietet eine Herniensprechstunde an, in der die Patientinnen und Patienten individuell untersucht und beraten werden. Nach einer ausführlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung erfolgt eine weiterführende Diagnostik mittels Sonographie. Im Anschluss werden die gegebenenfalls notwendigen operativen Behandlungsoptionen detailliert erklärt und auf das jeweilige Krankheitsbild abgestimmt.
Mit der Zertifizierung als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie setzt die Kreisklinik Bad Reichenhall ein starkes Zeichen für medizinische Qualität und Patientenorientierung. Das Hernienzentrum Berchtesgadener Land ist damit eine wichtige Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten in Stadt und Umland.
30.01.2025 - Klinikum Traunstein
Wenn die Leber streikt
Warum eine frühe Diagnose und die Behandlung in zertifizierten Zentren wichtig sind
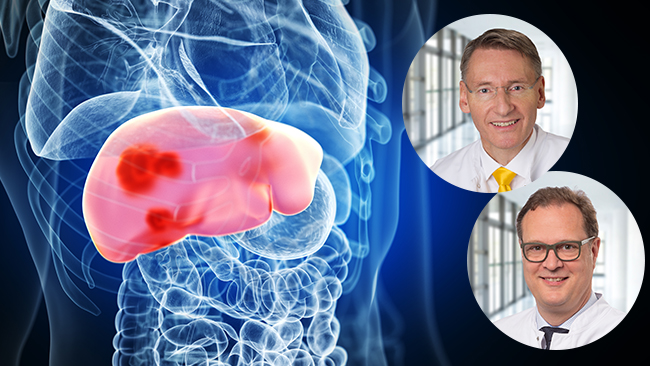
Leberkrebs ist eine stille Gefahr. Oft bleibt er lange unentdeckt, da Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder Druckgefühl im Oberbauch unspezifisch sind. Anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar haben wir mit dem und Chefarzt der Hämatologie und Leiter des Onkologischen Zentrums am Klinikum Traunstein, Dr. Thomas Kubin, und dem Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Traunstein, Prof. Dr. Christian Jurowich, über Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Prävention dieser weit verbreiteten Krebsart gesprochen. mehr...
Ursachen und Risiken
„Die häufigste Ursache für Leberkrebs ist eine Leberzirrhose“, erklärt Dr. Kubin, der Leiter des Onkologischen Zentrums. „Diese wiederum entsteht meist durch chronischen Alkoholmissbrauch oder Infektionen mit Hepatitis B und C.“ Auch die sogenannte nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, häufig ausgelöst durch Übergewicht und Diabetes, spielt eine wachsende Rolle. Alkohol aber steht bei den Ursachen, die die Leber nachhaltig schädigen, ganz oben auf der Liste. „Das eine Glas Wein am Abend wird oft in seiner Wirkung unterschätzt“, so die beiden Experten. „Denn langfristig sind es genau diese kleinen Mengen, die in Summe die Leber schädigen und letztlich Leberkrebs begünstigen können.“
Behandlung und Therapie
Der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Prof. Dr. Christian Jurowich, betont, wie wichtig eine individuelle Therapie ist: „Die Behandlung von Leberkrebs hängt von der Größe des Tumors, seiner Ausbreitung und dem Allgemein-Zustand der Leber ab. In vielen Fällen ist eine Operation die beste Option, bei der wir den Tumor und das geschädigte Gewebe entfernen. Wir können im Klinikum Traunstein alle Behandlungsoptionen anbieten, außer einer Lebertransplantation.“ Zusätzlich kommen Methoden wie lokale Abtragung durch Radiofrequenztherapie oder ein Verschluss der Tumorgefäße über Katheter (TACE) zum Einsatz. Seit wenigen Jahren hat auch die medikamentöse Therapie einen festen Stellenwert. „So können wir heute mit modernen Immuntherapien oder der Kombination von Immuntherapie und Mitteln gegen die Blutgefäßentwicklung von Tumoren (Antiangiogenese) auch Patienten in fortgeschrittenen Stadien deutlich besser helfen und die Erkrankung manchmal jahrelang stoppen“, fügt Dr. Kubin hinzu.
Warum ein zertifiziertes Zentrum wählen?
„Zertifizierte Zentren wie unseres bieten den Vorteil, dass Spezialisten verschiedener Disziplinen eng zusammenarbeiten“, erklärt Dr. Kubin. „Um die beste Therapie für jeden einzelnen Patienten zu ermitteln, sprechen in der interdisziplinären Tumorkonferenz des Onkologischen Zentrums die Kolleginnen und Kollegen der Hämatologie und internistischen Onkologie, der Gastroenterologie, der Chirurgie, der Gynäkologie, der Urologie, der Radiologie, der Strahlentherapie und der Pathologie regelmäßig miteinander. Außerdem gibt es interdisziplinäre Arbeitsgruppen. So stellen wir von der Diagnostik bis zur Therapie gemeinsam sicher, dass jeder Patient die bestmögliche individuelle Behandlung erhält.“
Prävention: Wie Sie sich schützen können
Vorbeugung beginnt mit einem gesunden Lebensstil. Weniger oder besser gar kein Alkohol, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung entlasten die Leber und wirken auch gegen die Entstehung vieler weiterer Krebserkrankungen. Zudem sollten Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes und Hepatitis-Infektionen ernst genommen werden. Impfungen gegen Hepatitis B und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten.
29.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Unfallchirurgische Expertise für die Kreisklinik Bad Reichenhall

Zum 1. Dezember 2024 hat Dr. Florian Zoffl die Position des Leitenden Arztes der Unfallchirurgie / orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall übernommen. Zuvor war er langjährig als Leitender Oberarzt im Klinikum Traunstein tätig. mehr...
Prof. Dr. Kolja Gelse, Chefarzt Unfallchirurgie / Orthopädische Chirurgie am Klinikum Traunstein, freut sich darüber, dass Dr. Florian Zoffl die Leitung der Unfallchirurgie in Bad Reichenhall übernimmt und die Position somit aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte: „Mit Dr. Zoffl bekommt das Haus in Bad Reichenhall einen ausgesprochen erfahrenen Unfallchirurgen als Leitenden Arzt. Wir pflegen – nicht zuletzt durch unsere gemeinsame Zeit hier in Traunstein – eine sehr enge Zusammenarbeit.“ Und Dr. Zoffl ergänzt: „Die gute Kooperation mit Prof. Dr. Gelse und seinem Team ist auch deswegen so wertvoll, weil die Unfallchirurgie in Bad Reichenhall sehr eng mit dem Klinikum Traunstein als zugelassene SAV-Klinik für die Behandlung von Arbeitsunfällen mit schwersten Verletzungen zusammenarbeitet. Besonders im Bereich meines Schwerpunktes, der Wirbelsäulenchirurgie, kann ich auf eine optimale Kooperation mit dem Wirbelsäulenzentrum von Prof. Dr. Gelse zurückgreifen.“
Nach seinem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität absolvierte der gebürtige Münchener seine Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus in Landshut-Achdorf. Seine Promotion im Fachgebiet Neuroradiologie erlangte er an der TU München. In Landshut-Achdorf wurde er zum Oberarzt berufen und wechselte im April 2020 als Oberarzt in das Klinikum Traunstein in die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Kolja Gelse. Im November 2022 wurde er zum Leitenden Oberarzt ernannt.
An seiner neuen Wirkungsstätte in Bad Reichenhall liegt dem Vater von drei Kindern die Versorgung von akuten Verletzungen bei Kindern und Erwachsenen sowie insbesondere die Revisionsendoprothetik bei betagten Patientinnen und Patienten am Herzen. Dr. Zoffl erklärt: „Durch die steigende Lebenserwartung, aber auch durch andere Faktoren kommt es gehäuft zu Frakturen im Bereich der Prothese, welche eine große Herausforderung für den Unfallchirurgen darstellen. Mit operativen Eingriffen kann ich diesen Patientinnen und Patienten wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen.“
28.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Bewegung statt Schmerz - Ursachen und Behandlung von Rückenschmerzen
Vortrag im Rahmen der Reihe Gesundheit AKTIV
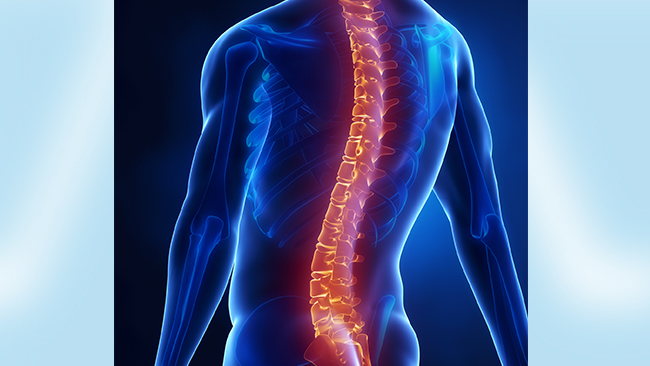
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden in Deutschland. Sie beeinträchtigen Menschen aller Altersstufen. Doch warum sind sie so weit verbreitet, und wie kann man sie wirksam behandeln? Dr. Florian Zoffl, Leitender Arzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall, erklärt Hintergründe und gibt Hinweise zur Prävention und Therapie. mehr...
„Es gibt gesellschaftliche und berufliche Trends, die zur Verbreitung von Rückenschmerzen beitragen“, sagt Dr. Florian Zoffl. „Rückenschmerzen entstehen nicht, wie häufig angenommen, durch körperlich schwere Arbeit, sondern durch Fehlhaltungen. Unser Körper ist nicht für langes Sitzen gemacht, sondern benötigt einen Ausgleich durch Bewegung. Ansonsten kommt es zu Verspannungen und muskulären Dysbalancen. Nehmen sie Treppen statt Aufzüge, bauen Sie kurze Spaziergänge in den Alltag ein und lassen Sie das Auto häufiger stehen – all das kann helfen, Rückenschmerzen vorzubeugen“, so der Mediziner.
Unterschiedliche Ursachen je nach Alter
Die Ursachen von Rückenschmerzen variieren stark mit dem Lebensalter. Zwischen 30 und 45 Jahren sind häufig Bandscheibenvorfälle und funktionelle Rückenschmerzen verantwortlich. Funktionelle Rückenschmerzen treten ohne Schmerzausstrahlung in die Beine auf, und oft ist in bildgebenden Verfahren keine klare Ursache erkennbar. Bei älteren Menschen ab 60 Jahren stehen altersbedingte Veränderungen im Vordergrund, wie die Verengung des Wirbelkanals (Spinalkanalstenose) oder osteoporotische Wirbelkörperfrakturen, das sind Brüche, die auf einer Osteoporose basieren. Letztere können zunächst mit Schmerzmedikamenten behandelt werden, mit dem Versuch die Mobilität zu erhalten. Denn, so Dr. Zoffl: „Wenn ältere Menschen nur noch liegen können, ist das Gift. Wer nicht mehr aus dem Bett kommt, baut sehr schnell ab, das kann im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden.“ Doch sollte eine Schmerzmedikation nicht ausreichen, könne für diese Patienten eine minimalinvasive Operation wie die Kyphoplastie sinnvoll sein. Dabei wird In einer kurzen Narkose mit einem Ballon der zusammengedrückte Wirbelkörper wieder aufgerichtet und in den entstandenen Hohlraum spezieller Knochenzement eingebracht.
Konservative Therapie als Grundlage
Wenn keine eindeutige Ursache für Rückenschmerzen erkennbar ist, setzt die Behandlung oft auf konservative Maßnahmen. Physiotherapie und Rückenschule sind zentrale Bestandteile, begleitet von vorübergehender Schmerztherapie. Diese kann helfen, Verspannungen zu lösen und den Schmerz zu lindern. „Es geht darum den Schmerzkreislauf mit Medikamenten und Physiotherapie zu durchbrechen“, so Dr. Florian Zoffl. Wichtig sei, dass Beschwerden und Befunde übereinstimmen, bevor invasive Verfahren wie Injektionen oder Operationen in Betracht gezogen werden. „Man sollte niemals einen Patienten nur auf der Basis seiner Kernspin- oder Röntgenbilder operieren, sondern immer den Menschen in seiner Gesamtheit betrachten, mit all seinen Beschwerden und Begleiterkrankungen.“ Grundsätzlich habe die Wirbelsäulenchirurgie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Minimalinvasive Verfahren ermöglichen es, über kleine Schnitte effektiv zu operieren, die Patienten schneller zu mobilisieren und aus dem Krankenhaus zu entlassen.
Sofort handeln
Es gibt Rückenschmerzen, die umgehend ärztlich abgeklärt werden sollten, da sie auf ernsthafte Erkrankungen hinweisen können, etwa wenn die Rückenschmerzen von einer ausgeprägten Ausstrahlung in ein Bein begleitet werden. Das ist ein typisches Anzeichen für einen Bandscheibenvorfall, bei dem eine Nervenwurzel abgedrückt wird. Ein absoluter Notfall ist gegeben, wenn akute Blasen- oder Mastdarmstörungen auftreten, etwa, wenn Wasser oder Stuhl nicht mehr gehalten werden können. „Das deutet auf einen großen Bandscheibenvorfall hin, der massiv auf das Rückenmark drückt. Das muss sofort operativ behandelt werden“, so Dr. Zoffl. Ansonsten gilt: „Bleiben Sie aktiv, bewegen Sie sich – ein Leben lang, in jedem Alter“. Rückenschmerzen seien in den meisten Fällen gut behandelbar, vor allem, wenn frühzeitig reagiert werde. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie sie zwischen Kreisklinik Bad Reichenhall und dem KSOB-Wirbelsäulenzentrum am Klinikum Traunstein unter Leitung von Chefarzt Professor Dr. Kolja Gelse gelebt werde, sei entscheidend. „So ermöglichen wir jedem Patienten die beste Therapie“.
In dem Vortrag „Rückenschmerzen! – wie werde ich sie wieder los?“, informiert Dr. Florian Zoffl, Leitender Arzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall über Ursachen in allen Altersstufen, stellt konservative und operative Therapieoptionen und -möglichkeiten vor und wird anhand von Fallbeispielen verschiedene Diagnosen und deren Behandlungsstrategien besprechen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „GesundheitAktiv“ der Kliniken Südostbayern am 6. Februar von 16 bis 17.30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhall statt. Der Eintritt ist frei.
17.01.2025 - Klinikum Traunstein
Klinikum Traunstein hat herausgehobene Stellung im Schlaganfallnetzwerk TEMPiS Südostbayern
Schnelligkeit und Erfahrung

Im Jahresbericht 2024 des Schlaganfallnetzwerks TEMPiS Südostbayern wird das Klinikum Traunstein besonders hervorgehoben: Das Klinikum ist nicht nur eine von 25 Partnerkliniken im Schlaganfallnetzwerk, sondern ist auch als einer von nur zwei Standorten im gesamten südostbayerischen Raum zertifiziert für die Durchführung von Thrombektomien. Die mechanische Entfernung eines Blutgerinnsels, gilt, neben der medikamentösen Therapie, mittlerweile als Behandlung der Wahl. mehr...
Schnelligkeit und Erfahrung
Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Traunstein, ist überzeugt, dass nicht nur die Schnelligkeit in der Versorgung, sondern auch die Expertise der Ärztinnen und Ärzte Leben rettet: „Zeit ist Gehirn, so sagt man, aber nicht nur, sondern auch Erfahrung ist für die erfolgreiche Behandlung von Schlaganfällen von größter Bedeutung. Als Thrombektomie-Standort im TEMPiS-Schlaganfallnetzwerk haben wir in Traunstein sowohl erfahrene Neurologinnen und Neurologen als auch, mit dem Team um den Leitenden Arzt Dr. Andreas Mangold, Neuroradiologen vor Ort, die die anspruchsvolle Methodik der endovaskulären Schlaganfall-Therapie beherrschen. Einen weiteren Vorteil haben die Patientinnen und Patienten unseres Klinikums dadurch, dass wir die einzige überregionale Stroke-Unit im weiten Umkreis im Haus haben. Dort sind Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten in den ersten Stunden und Tagen einfach am besten aufgehoben, denn dort werden sie rund um die Uhr engmaschig betreut.“
Bei großen Gerinnseln überlegen
Besonders im Fall von Verschlüssen großer, hirnversorgender Gefäße durch große Gerinnsel ist die mechanische Entfernung der medikamentösen Auflösung überlegen, denn dadurch kann die Entstehung eines großen Hirninfarkts verhindert werden. Dies wiederum kommt besonders Patienten mit schweren Schlaganfällen zugute, die sonst zu Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder zum Tod führen können. Mit der endovaskulären Schlaganfall-Behandlung kann in über 90 Prozent der Fälle das Gefäß wiedereröffnet werden.
In spezialisierten Schlaganfallzentren, wie dem am Klinikum Traunstein, ist die Thrombektomie als Therapiestandard schon seit mittlerweile acht Jahren fest etabliert. Im Jahr 2024 wurden erstmals über 100 Thrombektomien im Klinikum Traunstein durchgeführt. Die Bevölkerung profitiert also von Schnelligkeit UND Erfahrung – wohnortnah.
14.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Positive Entwicklung der Geburtenzahlen in der Kreisklinik Bad Reichenhall
„Born im BGL“ setzt Ausrufezeichen entgegen bundesweitem Trend

Die Kreisklinik Bad Reichenhall blickt auf ein erfreuliches Jahr 2024 zurück: Insgesamt erblickten 443 Babys das Licht der Welt. Dies bedeutet einen Anstieg um 13 Geburten bzw. um 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit diesem Ergebnis schwimmt die Kreisklinik gegen den überregionalen und bundesweiten Trend, der vielerorts einen deutlichen Rückgang der Geburtenzahlen zeigt. mehr...
Die Zunahme an Geburten wird als positives Signal für die Attraktivität und das Vertrauen in die Geburtsstation der Kreisklinik Bad Reichenhall gewertet. „Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs und sehen darin eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, werdenden Eltern eine hochwertige Betreuung und ein sicheres Umfeld für die Geburt zu bieten“, erklärt Stefan Prawda, KSOB-Standortleiter an der Kreisklinik Bad Reichenhall.
Das Team der Reichenhaller Geburtsstation – bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, Hebammen sowie Pflegekräften – steht für eine familiäre Atmosphäre und eine individuelle Betreuung. Die Ausstattung der Klinik sowie moderne medizinische Standards tragen ebenfalls dazu bei, dass sich viele Familien für die Kreisklinik Bad Reichenhall entscheiden.
Das Statistische Landesamt hat bisher noch keine Gesamtzahlen zu den Geburten im Landkreis Berchtesgadener Land für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Kreisklinik Bad Reichenhall wird aber natürlich alles daransetzen, werdenden Eltern und Neugeborenen auch künftig die bestmögliche Versorgung zu bieten – mit Herz, Kompetenz und Engagement.
10.01.2025 - Kliniken Südostbayern
15 Jahre Engagement für Familienfreundlichkeit
Kliniken Südostbayern feiern Mitgliedschaft im Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

Die Kliniken Südostbayern (KSOB) blicken auf 15 Jahre Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ zurück. Dieses Jubiläum unterstreicht das langjährige Engagement der KSOB für eine familienorientierte Personalpolitik, die sowohl Mitarbeitenden als auch deren Familien zugutekommt. mehr...
Als einer der größten Arbeitgeber in der Region setzen die KSOB auf eine nachhaltige Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dies zeigt sich in vielfältigen Maßnahmen wie der Optimierung von Arbeitszeitmodellen, Kinderbetreuungsangeboten (auch in Ferienzeiten), Programmen zur Führungskräfteentwicklung (auch in Teilzeit), wertschätzende Aktionen für Beschäftigte in Elternzeit oder über individuelle Lösungen für pflegende Angehörige. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Mitarbeitenden gerecht wird.
Vor diesem Hintergrund ist Familienfreundlichkeit an den KSOB ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur und ein wichtiger Beitrag für die Zukunft der Region. Mit der Mitgliedschaft im Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ fördern die Kliniken aber nicht nur ihre eigene Attraktivität als Arbeitgeber, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag dazu, Familienbewusstsein als Markenzeichen in der Wirtschaft zu etablieren.
Die KSOB danken allen Beschäftigten und Partnern, die diese Entwicklung möglich gemacht haben.
03.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Husten, Schnupfen, Heiserkeit: gesund durch den Winter
Vortrag im Rahmen der Reihe Gesundheit AKTIV

Saisontypisch breitet sich in Deutschland eine Welle von Erkältungskrankheiten aus. Während Rhinoviren und Influenza zunehmen, sind Corona-Infektionen derzeit leicht rückläufig. Prof. Dr. Tobias Lange, Pneumologe und Chefarzt der Kreisklinik Bad Reichenhall, erklärt, wie sich Infektionen vermeiden lassen, warum die Influenza keine Lappalie ist und welche Maßnahmen bei ersten Krankheitsanzeichen helfen. mehr...
Die Erkältungslage in Deutschland ist nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit, erklärt Prof. Dr. Tobias Lange, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Kreisklinik Bad Reichenhall. „Im Moment ist knapp jeder zehnte Bundesbürger erkrankt, die Zahl steigt weiter an, bewegt sich aber im normalen Bereich“, so der Experte. Rhinoviren, die meistens einen „banalen grippalen Infekt“ auslösen, dominieren noch, jedoch nehmen auch die Fälle von Influenza – der „echten“ Grippe - langsam zu. RSV-Viren, die Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Erwachsene betreffen können, sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Dagegen scheinen Corona-Infektionen derzeit „eher auf dem Rückzug“ zu sein.
Grippale Infekte nehmen alljährlich bis kurz vor Weihnachten zu und erreichen ihren Höhepunkt erfahrungsgemäß in der 51. Kalenderwoche. „Ein zweiter Peak lässt sich dann meist in den ersten fünf, sechs Wochen des neuen Jahres erkennen“, sagt Dr. Lange. Dieser Verlauf könnte mit dem Verhalten der Menschen und der Anzahl der Kontakte zusammenhängen: „Viele haben über Weihnachten und den Jahreswechsel Urlaub und Anfang Januar steigen die Begegnungen auch im Berufsleben wieder an und Viren können in einem größeren Kreis weitergegeben werden.“ In der Vergangenheit habe die Covid-Pandemie jedoch diesen typischen Verlauf verändert: „Im Winter 2020/2021 gab es viel weniger grippale Infekte, weil die Menschen zu Hause geblieben sind oder Masken getragen haben.“ Auffällig sei auch, dass sich die Influenza-Saison stetig weiter nach hinten verschoben hat: „Mittlerweile treten die meisten Fälle in der Zeit nach Weihnachten bis Ostern auf, früher waren November und Dezember die Hauptmonate“, so der Pneumologe.
Prävention, Impfungen und ärztliche Abklärung
Um Erkältungen vorzubeugen oder erste Anzeichen abzumildern, empfiehlt Prof. Dr. Lange gesunde Lebensgewohnheiten. „Zur Vorbeugung und wenn man merkt, es ist was im Busch, der Hals kratzt und man muss ständig niesen, sollte man sich gesundheitsbewusst verhalten: einfach mal früher ins Bett gehen, warmen Tee trinken, Gemüse und Obst essen, auf Alkohol verzichten, Bewegung an der frischen Luft – und sich häufiger die Hände waschen.“ Bei schwereren Erkrankungen wie Influenza oder Corona stehen mittlerweile Medikamente zur Verfügung. Eine Impfung gegen Influenza wird ab 60 Jahren empfohlen, da die Grippe schwerwiegende Verläufe nehmen kann. „Eine Influenza ist keine Lappalie, das ist eine ernsthafte Erkrankung, bei der auch junge, gesunde Menschen ins Krankenhaus und sogar auf die Intensivstation und ans Beatmungsgerät kommen können.“ Er betont die Wichtigkeit der regelmäßigen Auffrischung: „Es gibt keine dauerhafte Immunisierung. Der Impfstoff wird jedes Jahr angepasst, weil sich die Viren ständig verändern.“
Wer an einer schweren Virusinfektion erkrankt, sollte unbedingt den Arzt aufsuchen. „Bei einer Influenza hat man hohes Fieber, und zwar über Tage, das kann bis 39, 40 Grad hochgehen. Da sollte man medizinisch abklären lassen, worum es sich handelt.“ Dies sei auch deshalb wichtig, da im Zuge einer Virusinfektion oft bakterielle Sekundärinfektionen auftreten können.
Erkältungen im Alltag
Die Frage, ob man mit einer Erkältung arbeiten oder Sport treiben sollte, beantwortet Prof. Lange differenziert. „Grundsätzlich ist es möglich, zur Arbeit zu gehen, wenn man sich nicht schlecht fühlt, allerdings besteht das Risiko, andere anzustecken. Wir bitten unsere Mitarbeiter im Krankenhaus, einen Mundschutz zu tragen, bis die Erkältungssymptome weg sind.“ Bei sportlicher Aktivität gelte: „Definitiv keinen Sport machen, wenn man Fieber hat und sich abgeschlagen fühlt – das sollte einem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand sagen.“ Andernfalls könne eine Herzmuskelentzündung drohen, die schwerwiegende Folgen haben kann.
Mit diesen Hinweisen betont Prof. Lange die Bedeutung von Prävention, verantwortungsbewusstem Verhalten, der rechtzeitigen Abklärung schwerer Symptome sowie der Impfung. „Wer mal eine echte Influenza gehabt hat, der weiß, dass sie um ein Vielfaches schwerer ist als ein grippaler Infekt.“
In dem Vortrag „Husten, Schnupfen, Heiserkeit – was kann ich tun“, informiert Pneumologe Prof. Dr. Tobias Lange über verschiedene virale Atemwegserkrankungen, wie man ihnen vorbeugen und wie man sie behandeln kann. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „GesundheitAktiv“ der Kliniken Südostbayern am 9. Januar von 16 bis 17.30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhall statt. Der Eintritt ist frei.
02.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Neue Dioden-Laser-Technologie für schonende Hämorrhoiden- und Fistel-Operationen
Minimal-invasive Eingriffe verbessern Lebensqualität
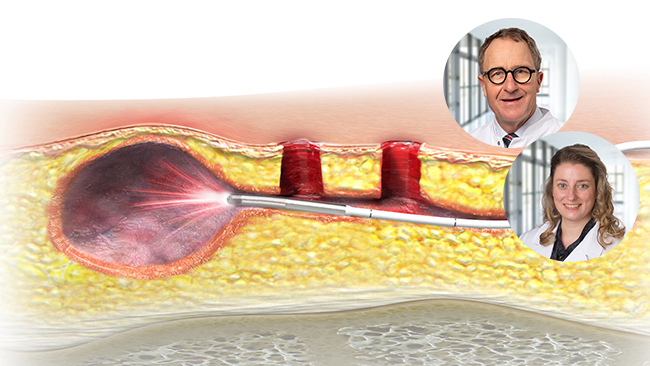
Mit der Anschaffung eines innovativen „LEONARDO®“-Diodenlasers können in der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall unter der Leitung von Dr. med. Thomas E. Langwieler nun minimal-invasive Eingriffe bei Hämorrhoiden, Analfisteln und Steißbeinfisteln durchgeführt werden – und das mit entscheidenden Vorteilen für die Patientinnen und Patienten. Die Einsatzmöglichkeiten für die individuelle Behandlung von Patientinnen und Patienten werden dabei im Rahmen der Proktologischen Sprechstunde durch die Leitende Oberärztin Steffi Lasch und Oberarzt Diego Castro geprüft. mehr...
Schonende Behandlung von Hämorrhoiden
Hämorrhoiden sind ein weit verbreitetes, aber oft tabuisiertes Leiden, das viele Menschen betrifft. Mit der neuen Laserhämorrhoidoplastie bietet die Kreisklinik Bad Reichenhall eine hochmoderne und minimal-invasive Lösung an. Anstatt das empfindliche Gewebe um die Hämorrhoiden chirurgisch zu entfernen, wird dieses durch gezielte Laserenergie geschrumpft. Diese Methode erhält die natürliche Funktion der Hämorrhoidenpolster und schont die empfindliche Analhaut.
Vorteile für die Patientinnen und Patienten:
- Kein Gewebeverlust, winzige Schnitte
- Minimale Wundfläche und dadurch reduzierte Schmerzen
- Schnelle Erholung und kurze Arbeitsunfähigkeit
- Bestmöglicher Erhalt der Kontinenz
Effektive Lasertherapie bei Analfisteln
Analfisteln, die oft durch entzündete Drüsen entstehen und häufig wieder auftreten, sind ein weiteres Anwendungsgebiet des neuen Lasers. Hier bietet die Klinik eine nahezu schmerzfreie Alternative zu herkömmlichen chirurgischen Eingriffen. Die Lasersonde wird in den Fistelgang eingeführt, um das entzündete Gewebe gezielt zu veröden und den Gang zu verschließen.
Die Vorteile der Laserbehandlung:
- Maximale Schonung des Schließmuskels und somit Erhalt der Kontinenz
- Keine Spaltung oder Entfernung des Fistelgangs nötig
- Deutlich schnellere Wundheilung
- Kombinierbarkeit mit anderen Behandlungsmethoden
- Reduktion von Rezidivfisteln
Minimal-invasive Behandlung von Steißbeinfisteln
Steißbeinfisteln können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und erfordern oft aufwendige chirurgische Eingriffe. Mit der Lasertherapie wird das entzündete Gewebe durch eine präzise Verödung entfernt, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.
Die Vorteile für die Patientinnen und Patienten:
- Minimaler Eingriff mit geringer Belastung
- Keine großflächige Entfernung von Gewebe
- Schnelle Rückkehr zu alltäglichen Aktivitäten
- Deutlich geringeres Risiko für Rückfälle (Rezidive)
- Verbesserte Lebensqualität durch modernste Technik
„Der neue Laser ermöglicht es uns, unseren Patientinnen und Patienten hochmoderne, schonende und effektive Behandlungen anzubieten“, erklärt der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. med. Thomas E. Langwieler. „Wir setzen auf minimal-invasive Verfahren, die nicht nur die Heilung beschleunigen, sondern auch die Lebensqualität nachhaltig verbessern.“
Die Kreisklinik Bad Reichenhall unterstreicht damit ihren Anspruch, medizinische Innovationen für eine schnellere Genesung, geringere Schmerzen und eine deutlich verbesserte Lebensqualität der Patientinnen und Patienten einzusetzen.
02.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Molkerei Berchtesgadener Land spendet 23.800 Euro für die Notaufnahme der Kreisklinik Bad Reichenhall
Neues Videolaryngoskop zur schnelleren und sichereren Intubation von Notfallpatienten finanziert
Die Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG haben eine großzügige Spende in Höhe von 23.800 Euro an die Notaufnahme der Kreisklinik Bad Reichenhall übergeben. Zur offiziellen Übergabe war der Geschäftsführer der Molkerei, Bernhard Pointner in die Kreisklinik gekommen, wo er von Philipp Hämmerle, Vorstand der Kliniken Südostbayern, sowie von der Chefärztin der Notaufnahme, Dr. Verena Kollmann-Fakler und Standortleiter Stefan Prawda, herzlich empfangen wurde. mehr...
Im Mittelpunkt des Termins stand die Präsentation eines neuen Videolaryngoskops, das durch die Spende finanziert werden konnte. Dieses Gerät ermöglicht eine sichere und schonende Intubation bei Patienten, die nicht mehr selbständig atmen können. Es erleichtert die Atemwegssicherung und erhöht somit auch die Patientensicherheit.
Bernhard Pointner begrüßte die Anschaffung und erklärte seine Motivation zu einer Spende für die Notfallversorgung in der Region mit den gelebten Werten der Molkerei: „Gemeinschaft hat in unserer Genossenschaft einen hohen Stellenwert. Darum leisten wir sehr gerne einen Beitrag zum Wohl unserer Region. Ernährung und Gesundheit sind eng verbunden, und wenn wir zur Notfallversorgung auch etwas beitragen können, dann machen wir das sehr gerne“.
Phillip Hämmerle, Vorstand der Kliniken Südostbayern sprach seinen Dank aus: „Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und im Namen der Kliniken Südostbayern bedanke ich mich ganz herzlich. Wir freuen uns sehr über die Verbundenheit und die großzügige Spende, mit der wir unser engagiertes Team in der Notaufnahme in ihrem wertvollen Dienst unterstützen können.“
Zur konkreten Bedeutung des neuen Geräts äußerte sich die Chefärztin Dr. Verena Kollmann-Fakler: „Das neue Gerät kommt uns und unseren Patienten besonders dann zugute, wenn die Intubation in einer schwierigen Lage durchgeführt werden muss. Weiterhin können wir mit diesem Gerät auch unsere jungen Mitarbeiter leichter schulen und damit mehr Mitarbeiter befähigen, in einer Notsituation schnell und sicher zu intubieren.“
Die Molkerei Berchtesgadener Land befindet sich im Besitz von rund 1.600 Landwirt:innen, deren Betriebe im Durchschnitt 27 Kühe halten. Soziale Verantwortung und nachhaltiges Handeln sind Werte, denen sich das heimische Unternehmen schon lange verpflichtet fühlt. Dies zeigt sich nicht nur im Engagement für die Region, sondern auch in ihrem Bekenntnis zu fairen Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt- und Geschäftsethik.
Mit der aktuellen Spende unterstreichen die Milchwerke einmal mehr ihr Engagement für die Heimat und das Gemeinwohl. Als bedeutender Arbeitgeber in der Region ist die enge Verbundenheit mit der Heimat und das Ziel, die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu fördern, ein unverrückbarer Kern der Unternehmensphilosophie.
01.01.2025 - Kreisklinik Bad Reichenhall
Zwei Neujahrsbabys in Reichenhall
Herzlichen Glückwunsch

Zwei Neujahrsbabys wurden in der Kreisklinik Bad Reichenhall geboren. Um 12:12 Uhr erblickte Severin Simon Stöckl mit einem Geburtsgewicht von 3525 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt. Für seine Eltern Theresa Katharina und Korbinian Stöckl aus Bischofswiesen ist es das zweite Kind.
Isabella Ostermaier wurde um 13:42 Uhr geboren. Sie war 3170 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Die Eltern Magdalena und Christian Ostermaier aus Anger freuen sich über ihr erstes Kind.
01.01.2025 - Klinikum Traunstein
"Franz und Lia" heißen die Neujahrsbabys in Traunstein
Herzlichen Glückwunsch

Um 1:40 Uhr am Neujahrstag erblickte das erste Kind im Klinikum Traunstein das Licht der Welt. Die stolzen Eltern Regina Bliemel und Michael Dolzer aus Amerang freuen sich über ihr erstes Kind. Der kleine Franz brachte bei der Entbindung 3404 Gramm auf die Waage und ist 52 Zentimeter groß.
Lia Fischer ist ebenfalls an Neujahr zur Welt gekommen. Bei der Entbindung wog sie 3066 Gramm ist 51,5 cm groß.
Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich.
| Kontakt |
Ansprechpartner Kommunikation und Marketing:
Allgemeine E-Mail-Adresse der Abteilung
Für Bewerbungen wenden Sie sich bitte an
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
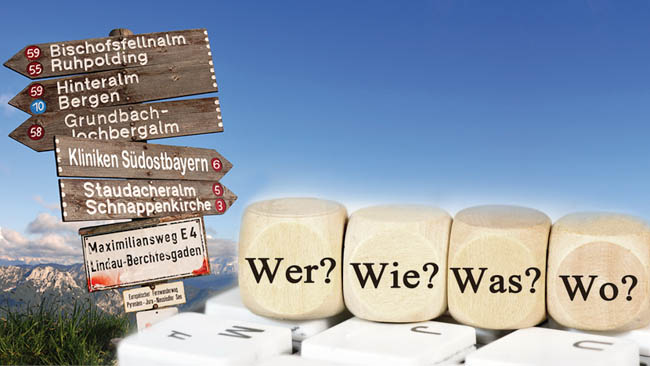












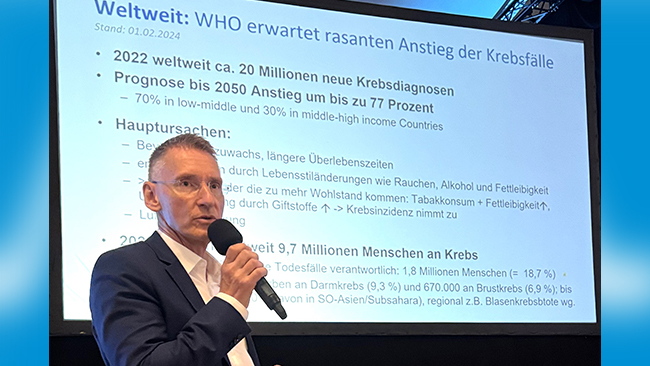


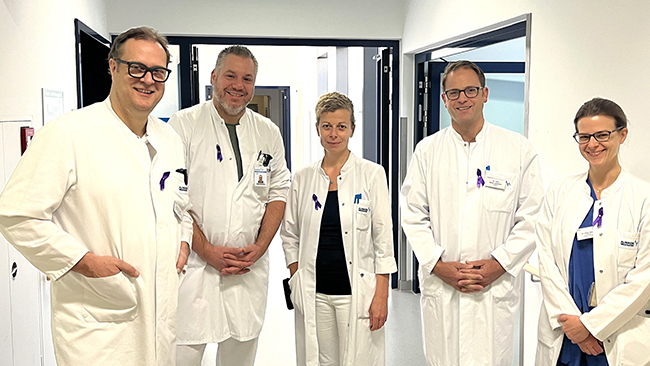

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken